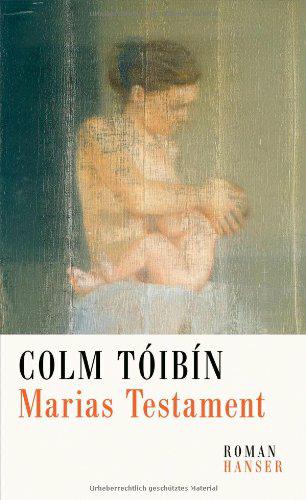Paradigmen theologischen Denkens |
Mater dolorosa auf der CouchBemerkungen zu Colm Tóibín: Marias TestamentWolfgang Vögele
Den verzweifelten Blick richtet sie trauernd auf den Boden. Nur so kann sie dem Stieren der Gaffer und Zuschauer ausweichen. Schüchtern hat sie die Hände gefaltet. Sie sieht aus als wäre sie am liebsten gar nicht da. Über den Kopf hat sie sich das große rote Schultertuch gezogen, als könnte sie sich in einem Zelt verbergen. Diese Maria folgt ihrem Sohn nicht mehr staunend von Wunder zu Wunder, von Predigt zu Predigt. Diese Maria mag gar nicht mehr auf das Kreuz schauen, an dem ihr Sohn gerade hingerichtet wird. Sie ist ganz Klage, ganz Trauer, Zurückgezogenheit, Verlassenheit. Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des beherrschenden Kreuzes, steht der Lieblingsjünger, dessen Namen niemand kennt, Maria ebenbürtig und doch ganz anders, offensiver in Trauer, Gebet und Glauben. Aber gegen das Grauen des überdimensionalen Kreuzes in der Mitte müssen sie beide, Mutter und Jünger zurückstehen. Zu den wichtigsten Kunstwerken der Karlsruher Kunsthalle gehören die beiden Tafeln des Tauberbischofsheimer Altars von Matthias Grünewald (1470-1528). Entstanden ist das Spätwerk vermutlich in den ersten Jahren der Reformation Martin Luthers, zwischen 1523 und 1525. Die Tafel mit der Kreuztragung wird gerade in langwieriger Arbeit restauriert, die Kreuzigungstafel ist zu besichtigen. Es mag offen bleiben, ob sich in Grünewalds Werk Spuren reformatorischer Theologie finden. Grünewald jedenfalls konzentrierte sich auf die Spuren des menschlichen Gekreuzigten, dem alle Anzeichen späterer Verherrlichung durch Gott noch fehlen. Um dieses Kreuz schweben keine fürsorglichen Engel mehr. Und zu dieser Dornenkrone passt kein Heiligenschein. Darin kommt eine Theologie zum Ausdruck, die das Menschsein des Gottessohnes gerade in seiner Hinrichtung und in seinem Tod ohne Abstriche ernst nimmt.
Unabhängig davon markiert das Bild einen Wendepunkt in der Betrachtung der Passionsgeschichte. Denn das theologische Interesse verlagerte sich im ausgehenden Mittelalter vom triumphierenden auferstandenen Christus, dem Richter auf Gottes Thron, zum leidenden, kranken, gedemütigten und gefolterten Jesus. In der Kreuzigungsszene wird das auf erschreckende Weise deutlich. Grünewald hat alles Überflüssige weggelassen. Massenszenen, römische Soldaten, die beiden mitgekreuzigten Verbrecher fehlen in der Darstellung, die sich auf drei Personen beschränkt: den von Folterwunden übersäten Leib des gekreuzigten Jesus, zur seine Linken seine Mutter Maria, zu seiner Rechten der Lieblingsjünger, dessen Namen das Johannesevangelium nicht preisgibt. Innerhalb dieses Dreiecks, das nicht zufällig an die göttliche Trinität erinnert, entsteht mit ungeheurer malerischer Kraft einer neuer Dialog zwischen dem Gekreuzigten, der trauernden Mutter und dem zu Tode erschrockenen Jünger. Grünewald radikalisiert den Gekreuzigten, indem er ihn vermenschlicht. Als Maler steht Grünewald dabei wohl in der Nähe des Theologen Luther und seiner theologia crucis, welche gerade in der Gottesferne des Kreuzes einen Beleg für die Solidarität Christi mit den Kranken und Schwachen fand. Dabei ist weitgehend unbeachtet geblieben, dass der Maler neben der Humanisierung des Gottessohnes auch die Figur der trauernden Maria vermenschlicht. Sie ist nicht mehr die idealisierte, sanftmütige und duldende Mutter, die sündlose, geschlechtslose Frau mit unbefleckter Empfängnis, die Frau ohne feminine Attribute, schon gar nicht die bittstellende Himmelskönigin. Grünewald verbildlicht das Leiden der Mutter Jesu. Grünewalds Maria mag gar nicht hinschauen, während ihr Sohn, derjenige, den sie im Leib trug und den sie geboren hat, am Kreuz hängt. An ihm sind keine Anzeichen des Gottessohns oder des göttlichen Richters zu finden. Das sind spätere und frühere Attribute, die zu dieser Kreuzigung nicht passen. Es zeigt Grünewalds malerische und theologische Meisterschaft, dass er, was Maria angeht, den entscheidenden Moment dieser Mutter-Sohn-Beziehung eingefangen hat. Maria verliert ihren Sohn, wie andere Mütter ihren Sohn durch Erwachsen- und Selbständig werden verlieren. Das ist ein Moment des psychologischen Bruchs, der Trennung und der Demütigung. Genau um diese Mutter-Sohn-Beziehung kreist auch der kleine Roman des irischen Schriftstellers Colm Tóibín, „Marias Testament“. Der Schriftsteller hat darin eines seiner erfolgreichen Theaterstücke zu einem Roman verarbeitet. Maria erzählt Jahrzehnte nach seinem Tod die Geschichte ihres Sohnes, von der Hochzeit zu Kana über die Auferweckung des Lazarus bis zu Folter und Kreuz. Maria ist aus Palästina geflohen und lebt in der griechischen Stadt Ephesus. Regelmäßig erhält sie Besuch von zwielichtigen Männern, denen sie nicht richtig traut. Diese, christliche Funktionäre, vielleicht frühere Jünger, fragen sie aus. Ganz bestimmte Geschichten wollen sie hören, besonders diejenigen, die in ihr überschwängliches Bild von Jesus als dem Sohn Gottes, als dem Triumphator passen. Sie legen ihr die Worte in den Mund. Maria kann das annehmen, dass andere etwas über ihren Sohn wissen wollen. Aber sie spürt auch den Wunsch, den überbordenden Massen von Groll und Bitterkeit in ihrem Herzen Luft zu machen. Sie wehrt sich gegen die klerikal-offizielle Deutung der Heilsgeschichte des Sohnes. Diese Maria glaubt nicht mehr an den Gott der Bibel. In Ephesus hat sie sich eine Statue der Jagdgöttin Artemis gekauft und unter der Bettdecke versteckt. Dieser Statue vertraut sie in schlaflosen Nächten flüsternd ihren mütterlichen Schmerz an. Über die Artemisstatuen, die in Ephesus verkauft wurden, gibt schon die Apostelgeschichte Auskunft (Apg 19). Alle Menschen der Antike waren sich der religiösen und ökonomischen Konkurrenzen sehr wohl bewusst. Maria will sich von den spröden dogmatischen Sätzen der klerikalen Besuchsabordnungen nicht beeindrucken lassen, sie leistet Widerstand gegenüber ihrer ideologischen Aufdringlichkeit, und dieser Widerstand speist sich aus dem, was sich im Herzen aufgestaut hat. Jesus von Nazareth hat sich in ihrer Erzählung und Erinnerung vom Gottessohn zum Muttersohn verwandelt. Das heißt, sie hätte gerne gehabt, dass er auch als junger Mann mehr auf seine Mutter gehört hätte. Maria hätte sich Enkel gewünscht, hätte sich gewünscht, dass ihm der brutale Hinrichtungstod am Kreuz erspart geblieben wäre. Sie verachtet die Jünger, hält sie für Dummköpfe. Der nicht ausgesprochene Vorwurf lautet: Ihr habt mir meinen Sohn entfremdet. Gleichzeitig beneidet sie die Jünger um die Sicherheit ihrer Überzeugungen und um die psychologische Kraft, die sich darin ergibt. Der Erzähler Tóibín vermeidet es, die schwierigen Themen unmittelbar anzugehen: Statt von der Auferstehung erzählt seine Maria von der Wiederbelebung des Lazarus, immer schon eine verstörende Geschichte, denn innerhalb der Logik des Neuen Testaments Muss Lazarus ja der eine und einzige Mensch sein, der zweimal gestorben ist. Trotzdem waren alle gerade auf ihn brennend neugierig, besonders auf seine Erzählungen aus dem Totenreich. Maria erzählt, wie enttäuschend es für alle war, dass der wiederbelebte Lazarus kein Wort sprach. Tóibín hat dieser Maria alles Sanfte, Duldsame und Unaufdringliche ausgetrieben. Stattdessen rücken Zorn, Verbitterung und mütterliche Eifersucht in den Vordergrund. Maria hätte ihren Sohn gern bei sich behalten, nur mit großer Skepsis sah sie zu, wie er sich schon als pubertierender Junge dem Elternhaus entfremdete. Gerade darum kann sie seine Rolle als Gottessohn und Heiland nicht akzeptieren. Dafür aber kämpfen die Jünger. Mit der Verspätung von Jahrzehnten kämpft Maria um den Sohn und belebt ihre Mutterrolle wieder. Mit den christlichen Funktionären streitet sie um die Deutungshoheit über ihren Sohn. Sie will sich nicht ein zweites Mal vereinnahmen lassen und sich der offiziellen, klerikalen Version fügen. Diese offizielle Deutung aber wird langsam zum Dogma. Deswegen bleibt Maria den Jüngern gegenüber seltsam verdruckst. Konsequent stellt sie ihre Familie über den Glauben. Aber die Familie – kein Wort über Josef – leidet unter dem Bruch mit dem Sohn. So prekär ist dieses Verhältnis zwischen Mutter und Sohn geworden, dass Maria seinen Namen nicht mehr ausspricht, im Gegensatz zu den Evangelien, in denen es vor Hoheitstiteln nur so wimmelt. Wer einen Namen auch nur ausspricht, übt psychologische Macht aus, und manchmal schwingt diese Macht ins Religiöse hinüber, vor allem dann, wenn es um die richtigen Gottesnamen geht. In der jüdischen Religion Jesu war nur ein einziger Gottesname (JHWH) zugelassen, während Römer und Griechen in großzügiger polytheistischer das Göttliche mit vielen Götternamen bezeichneten und auch Mehrfachbezeichnungen zuließen, wenn es politisch opportun war. Tóibíns Maria lässt sich auf diesen antiken Polytheismus ein, weil sie darin das Unbegreifliche und Unfassbare des Göttlichen wieder findet. Sie kauft die Statue der Artemis, aber sie zeigt diese Statue nicht offen, sondern versteckt sie. Sie betet nicht zu der Statue, sondern sie flüstert mit ihr nachts. Das Klagegebet wird zur religiösen Psychoanalyse. Zwei Geschichten rücken nun in den Vordergrund, beide aus dem Johannesevangelium, die Hochzeit zu Kana (Joh 2) und die Auferweckung des Lazarus (Joh 11). Die Hochzeit zu Kana erzählt Tóibín als eine Art misslungene Familienzusammenführung. Maria würde gerne ihren Sohn zur Vernunft bringen, aber der verwandelt verrückterweise Wasser in Wein, er provoziert Ordnungsmächte, Spitzel und Agenten für die Römer. Die Heilung des Lazarus gerät ihm zu einer Art metaphysischen Slapstick. Die Erscheinung des wiederbelebten Toten mutet gespenstisch an. Maria staunt über die Sehnsucht der Menschen, Details über das Leben nach dem Tod zu erfahren. Maria erscheint in diesem Roman nicht die verständnisvolle Gottesmutter, zu der sie spätere Generationen gemacht haben. Man kann sich nicht vorstellen, dass diese Frau stellvertretend für die Menschen Gebetsanliegen vor Gott und Jesus Christus bringt. Die Gottesmutter Maria ruht auf der Annahme, dass die mütterliche Maria bestimmt nicht so streng sein wird wie der gerechte und unbarmherzig richtende Gottessohn. Die Mutter Maria in Tóibíns Roman grantelt, widerspricht und protestiert. Trauer und Schmerz nach dem Kreuzestod bleiben bestehen, aber er bekommt ein protestierendes, eigenständiges Gegengewicht an die Seite gestellt. Maria verwandelt sich von der Dulderin in eine selbstbewusste Persönlichkeit, die mit der eigenen Trauer kämpft. Von den Jüngern hat diese Maria keine hohe Meinung. Sie hält sie für ungebildet, grob und streitsüchtig. Sie belästigen ihren Sohn mit Machtspielchen. Mit Befremden registriert diese Maria, dass er sich auch selbst für Gottes Sohn hält. Auf der anderen Seite lässt sie Bewunderung für ihn durchblicken, weil er sich konsequent weigerte, das So-Sein der Wirklichkeit anzunehmen. Er vertraute der Kraft des Gottes, dessen Allmacht die brutale Wirklichkeit, auch die der späteren Kreuzigung, überwindet. Die Jünger und die Evangelisten hatten genau das verstanden, aber deswegen übertrieben sie es in Marias Perspektive auch mit ihren Hoffnungen und Erwartungen. Maria hält das, was ihren Sohn ausmacht, für „zur Schau gestellt Männlichkeit“ (S.62), aber diese Formulierung ist schon Ausdruck der Entfremdung zwischen Mutter und Sohn. Denn Maria kann sich nun ausgerechnet an Männlichkeit schlecht stören, wenn sie als Mutter einen Sohn – und keine Tochter - geboren hat. Wie alle Mütter hat Maria Schwierigkeiten, ihren Sohn in ein erwachsenes selbständiges Leben zu entlassen. Diese Maria fürchtet sich zusätzlich vor der göttlichen Macht ihres Sohnes, sie ist ihr unheimlich, gerade weil diese Macht ihre eigene Mutterrolle beschnitten hat. Maria würde am liebsten gerne weiter Mutter sein – und wird dann mit Folter und Kreuzigung konfrontiert. Denn das Kreuz bestreitet nicht nur die göttliche Macht ihres Sohnes. Es setzt nicht nur die Brutalität der Wirklichkeit gegen Gottes Allmacht, es bestreitet auch den mütterlichen Einfluss von Maria selbst. Sie beobachtet die grausame Vollstreckung des Todesurteils von weitem. Und sie wird selbst dabei von den Häschern und Polizeiagenten beobachtet, die sie gar zu gerne gefangen nehmen würden. Für ihren hingerichteten Sohn kann sie nichts mehr tun. Nichts mehr tun zu können - das ist das Schicksal von Müttern, die das Leben ihrer Söhne freigeben müssen, aber eben in diesem Fall nicht zu einem selbständigen Erwachsenenleben, sondern zur Erfahrung von Folter und vollständiger Machtlosigkeit. Sie Muss sich eingestehen, dass sie unter dem Kreuz selbst machtlos war. Sie Muss einräumen, dass es „sein Schmerz war und nicht meiner“ (S.103). Später träumt sie davon, dass sie ihren toten Sohn nochmals in die Arme genommen hat. Tóibín erzählt nichts von einer Auferstehung Jesu. Gerade das interessiert die Jünger, die ihr so hartnäckig Besuche abstatten: Sie wollen von den Wundern hören, vom Sensationellen, von allem, was sich für Missionszwecke ausbeuten lässt. All diesen Ansinnen verschließt sich Maria, sie traut den klerikalen Spielen nicht, dem Herumrücken der heiligen und weniger heiligen Stühle. Der Auferstandene erscheint Maria dann doch, aber im Traum, ein Mensch mit Wundmalen: Wasser spült den Toten aus der Tiefe des Grabes an das Licht der Wirklichkeit. Diesen Traum kann Maria annehmen und bejahen, aber den Jüngern erzählt sie nichts davon. Sie will nicht das vierte Rad am Wagen der Trinität sein. Sie will sich nicht als Heilige, Gottesmutter, Fürsprecherin vereinnahmen lassen. Sie kämpft um die Beziehung zu ihrem Sohn, obwohl sie den Kampf um die theologische Deutungshoheit längst verloren hat. Sie wünscht sich den Sohn als Familienmitglied zurück, und weiß doch, dass er längst einen ganz anderen Platz in der Kirche eingenommen hat. Die Jüngerkirche mit ihren Spitzeln und dokumentierenden Evangelisten empfindet sie als Fortsetzung und Verlängerung der Kreuzigung. Tóibín hat für das Klerikale an der Kirche zu Recht wenige Sympathien übrig, und er kratzt heftig am Lack dieser Madonna. Unter dem Lack des theologischen Deutungskampfs wird eine verbitterte und verzweifelte Frau sichtbar, der der einzige Sohn in mehrfacher Weise genommen wurde. Die Bindung zwischen Mutter und Sohn und die Beziehung zwischen (Gott)-Vater und Sohn vertragen sich nicht miteinander. Genau darum kauft sich diese Maria auch eine Statue der Jagdgöttin Artemis, denn diese ist ja eine Heldin, die jagend, kämpfend und tötend mit den göttlichen Männern mithalten kann, eine selbstbewusste, selbständige Frauengöttin, die nicht auf eine männliche Ergänzung oder Erweiterung angewiesen ist. Tóibíns Maria wäre gerne weiter Mutter gewesen, diese Mutterschaft wurde ihr vom Sohn, von den Jüngern und von Gott selbst geraubt. In Jesus triumphierte die Erlösung über die Familie. Maria passt das alles nicht: Sie musste den Sohn loslassen, sie verstand seine Predigten nicht, mochte seine Freunde nicht, und die Geschichte nahm ein bitteres, demütigendes Ende. Sie hätte es sich anders gewünscht. Und sie lässt sich auch von den Jünger-Spitzeln nicht davon überzeugen, dass es so, wie es dann kam, wirklich besser war. Natürlich ist dieser Roman Tóibíns Fiktion, aber er ist sehr nah entlang den Evangelien erzählt, besonders entlang des Johannesevangeliums, und er gewinnt seine Kraft daraus, dass er ernst nimmt, was der Evangelist Lukas schon am Anfang seines Evangeliums über Maria sagt. Sie nahm das alles, was sie über Jesus hörte (und sah), wach und aufmerksam wahr, behielt es in der Erinnerung und bewegte Taten und Worte „in ihrem Herzen“ (Lk 2,19 vgl. 2,51). Tóibín hat sich in diese Herzensbewegungen eingefühlt und seine eigene psychologische Sicht dieser Frau vorgelegt. Und darauf war er gut vorbereitet, denn mehrere seiner Romane haben sich mit dem Verhältnis von Müttern, Großmüttern, Töchtern und Söhnen auseinandergesetzt.
Man wird dem Roman nicht gerecht, wenn man ihn als Provokation und Destruktion der katholisch-traditionellen Marien-Biographie liest. Die Artemisstatue passt nicht zur Heiligenbiographie. Tóibín hat sich als Kritiker der irischen katholischen Kirche einen Namen gemacht und hervorragende Essays[3] über sexuellen Missbrauch von Priestern, verdeckte Homosexualität und den Zustand der klerikalen Hierarchie in Irland geschrieben. Einiges davon fließt zweifellos in seine Darstellung der frühen, antiken Jünger-Kirche ein. Marias Erzählung lebt vom Misstrauen gegenüber den Vertretern des offiziellen Christentums, das sich damals nur im Verborgenen ausbreiten konnte. Tóibín denkt sich empathisch in Marias Herzensangelegenheiten hinein. Das ist Phantasie, aber gerade darin wird deutlich, was den katholisch beglaubigten Mariendarstellungen fehlt. Dennoch kommt die Interpretation gerade dieses Romans nicht ohne den Verweis auf die Vielfalt von Mariendarstellungen aus, nicht nur in Kirche und Dogma, sondern auch in der Bildenden Kunst und in der Musik. Tóibín selbst hat in einem Essay[4] darüber Auskunft gegeben, dass ein Marienbild von Tizian in Venedig und zwei Arien aus Bach-Kantaten ihn in besonderer Weise inspiriert haben. Das Bild Tizians zeigt das genaue Gegenteil von dem, was Tóibín in seinem Buch geleistet hat: Tizian malt die Aufnahme Mariens in den Himmel, während Tóibín sie zurück unter die Menschen holt. Aber wer über Maria schreibt und – noch mehr – Maria fiktiv erzählen lässt, muss sich bewusst sein, dass er einen Dialog führt mit einem riesigen, überbordenden Strang der Kulturgeschichte.
Genau dieser Dialog ist Tóibín auf hervorragende Weise gelungen: Seine Maria behauptet sich gegen Jünger und frühe Dogmatiker, aber auch gegen die Künstler von Jan van Eyck bis Raffael, gegen die Madonnenmaler und –schnitzer, gegen Mariologen und Exegeten, gegen feministische Theologinnen und die gesamte katholische Marienfrömmigkeit. Wohlgemerkt: Tóibín schreibt nicht gegen die genannten Richtungen an, aber er setzt all diesen Marienbildern ein eigenes, menschliches Bild von Maria entgegen, das sich gegen diese zu behaupten vermag und in seiner Menschlichkeit einen sympathisch protestantischen Zug trägt, der auch schon im eingangs erwähnten Bild Grünewaldts zu finden ist. Letzteres wurde im Übrigen ungefähr zu derselben Zeit gemalt wie die Tizians kolossale Mariendarstellung. Tóibín legt seine Maria sehr behutsam auf die Couch des Psychoanalytikers. Er gibt ihr freundlich Gelegenheit, sich einmal auszusprechen. Der Leser darf mithören, was sie der Statue der Artemis heimlich zuflüstert. In dieser Fiktion wird deutlich, was in all den dogmatischen und klerikalen Deutungen der Gottesmutter verloren gegangen ist oder noch verbirgt. Ein Mensch. Eine Frau. Eine Mutter. Anmerkungen[1] Colm Tóibín, Das Feuerschiff von Blackwater, München 2001 (1999). [2] Colm Tóibín, Mütter und Söhne. Erzählungen, München 2009. [3] Z.B. Colm Tóibín, Among the Flutterers, LRB 32, Nr.16, 2010, 3-9, http://www.lrb.co.uk/v32/n16/colm-toibin/among-the-flutterers. [4] Colm Tóibín, The Inspiration for the Testament of Mary, The Guardian 19.10.2012, http://www.theguardian.com/books/2012/oct/19/inspiration-testament-mary-colm-toibin. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/88/wv08.htm
|