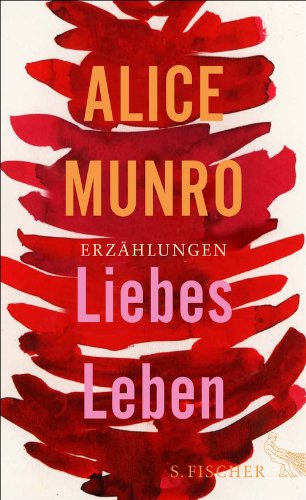Exotheologie |
Kirche und Religion als Staffage und HaltZu Alice Munros Erzählband ‚Liebes Leben‘Hans-Jürgen Benedict
Nach ihrer Heirat ging sie ganz im presbyterianischen Glauben ihres Mannes auf und „stürzte sich kopfüber in die presbyterianischen Wettbewerbe um Rechtschaffenheit.“ So weigerte sie sich, die von ihrem Sohn am Sonntag gefangenen Fische zu braten. Wohl getreu dem alttestamentlichen Sabbatgebot, dass das Vieh eines Israeliten am Sabbath nicht arbeiten solle (Dt 5, 14). Schon Heinrich Heine bemerkte 1854 in Geständnisse: „Im Norden von Europa und Amerika, namentlich in den skandinavischen und anglosächsischen Ländern hat sich das Palästinatum so geltend gemacht, daß man sich unter die Juden versetzt glaubt. Z.B. die protestantischen Schotten, sind sie nicht Hebräer, deren Namen überall biblisch, deren Cant sogar etwa jerusalemitisch-pharisäisch klingt, und deren Religion ein Judentum ist, welches Schweinefleisch frisst?“ Andererseits bemerkt Munro nüchtern über den Alltag der Farmer in Canada (ihr Großvater war Farmer in Huron-County): sie „sahen ihr Leben lang keinen einzigen freien Tag. Nicht einmal die schottischen Presbyterianer; Kühe achten den Sabbat nicht.“ Sprich sie müssen gemolken und versorgt werden. Soviel zur Praxistauglichkeit des deuteronomischen Sabbatgebots für das liebe Rindvieh, obwohl der Esel, wenn er, wie der Esel Bileams sprechen könnte, es gelobt haben wird, weil er keine Lasten tragen musste am Sabbat. Aber wie gesagt: wenigstens keine am Sonntag gefangenen Fische. Ihr Großvater war Farmer, ein Presbytarianer und Liberaler. „Geboren, um gegen die englische Kirche, den Familienkompaktwagen, Bischof Strachan und Wirtshäuser zu sein.“ Er trat für weltweites Wahlrecht ein, aber nicht für Frauen, freie Schulen, verantwortliche Regierungen und das Bündnis zur Erhaltung des Sonntags. Auch Alice Munro wuchs auf einer kleinen Farm auf, die ihr Vater aber für seine Zucht von Silberfüchsen und Nerzen benutzte. Er machte sein jugendliches Hobby, die Fallenstellerei, zu seinem Beruf. Ihre Mutter, eine Lehrerein, lebhaft, hartnäckig und hübsch, interessierte sich für die Füchse, sah darin einen neuen Erwerbszweig und betätigte sich später als erfolgreiche Verkäuferin der Pelze an US-Amerikaner. Das konnte den Niedergang aber nicht aufhalten, im Krieg ging das Geschäft zurück und der Vater musste sich eine neue Tätigkeit suchen, er arbeitete in einer Eisengießerei. Und bei einem Besuch in der Gießerei erteilt er ihr eine Lektion über die Würde der dort hart und gefährlich arbeitenden Männer, die weder die Schutzbestimmungen beachteten noch Gewerkschaften haben wollten (auch dies ein protestantisches Erbe). Die junge Alice hatte inzwischen die Silberfuchszucht, auch wegen des grausamen Tötens der Tiere, in Frage gestellt. Später sprach sie leichthin mit ihrem Vater über dieses (Luxus-)Gefühl. „Im selben Geist sagte er, er glaube, in Indien gebe es eine Religion, die behaupte alle Tiere kämen in den Himmel. Stell dir vor, sagte er, wenn das wahr wäre – was für ein Rudel zähnefletschender Füchse ihn dort erwarten würde, ganz zu schweigen von all den anderen Pelzträgern, die er gefangen hatte, und den Nerzen und einer Herde donnernder Pferde, die er wegen ihres Fleisches geschlachtet hatte. Dann sagte er, nicht so leichthin: ‚Man gerät in etwas hinein, weißt du, man macht sich gar nicht recht klar, in was man hineingerät‘.“ Der Tierschutz, der im jüdischen Sabbatgebot anklingt und der die entschieden presbyterianischen Vorfahren Munros zumindest als Ausnahmeregel noch beeinflusste, hat inzwischen Verfassungsrang, ohne das massenhafte Töten auch nur im Geringsten eingeschränkt wird. Munro, die Nachfahrin schottisch-presbyterianischer Einwanderer, deren Reformator John Knox Schulbesuch zur Pflicht machte, damit jedes Kind in der Bibel lesen könne, auch das eine Parallele zum Judentum (wunderbar dazu Amos Oz / Fania Oz-Salzberger, Juden und Worte), Buchhändlerin zunächst, dann Autorin von Kurzgeschichten, in gut 10 Bänden über Jahrzehnte hinweg zur Freude ihrer Leserschaft in schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht und schließlich mit 82 Jahren Nobelpreisträgerin, hat ihr christliches Erbe in ihren Kurzgeschichten im Alltäglichen, seinen Zufällen und Wendungen versteckt. Ein Satz aus der Erzählung Tieflöcher bringt es auf den Begriff: „Aber es ist doch schon etwas, den Tag überstanden zu haben, ohne daß er zur absoluten Katastrophe wird.“ Ihre Heldinnen sind zumeist Frauen, die oft in unsicheren Verhältnissen leben, denen häufig Schlimmes widerfährt, bei denen es sich aber auch wie in der alttestamentlichen Josephsgeschichte zum Guten wenden kann, ohne dass dabei noch ein Auctor angegeben wird. Und deren Leben sie auf dreißig, vierzig Seiten so dicht erzählen kann, dass man die Lektüre dicker Romane danach nicht mehr so recht angehen will. Um jetzt auf den letzten Erzählband zurückzukommen er beginnt mit einer Erzählung, in der eine Mutter während einer Zugfahrt in ihrem Abteil ihre kleine Tochter alleine zurücklässt, um mit Greg, einer Zufallsbekanntschaft Sex zu haben. Als sie zurückkommt, ist ihre Tochter verschwunden. Sie findet sie schließlich auf dem rumpelnden Durchgang zwischen zwei Wagons. Und am Ziel wartet völlig wider Erwarten der Mann, dem sie nach einer Party, auf der er sie fast geküsst hätte, geschrieben hatte: „Dir diesen Brief schreiben ist wie einen Zettel in eine Flasche stecken und hoffen, er wird Japan erreichen.“ Zuviel Glück?! Ja, wir sind Sünder und haben manchmal doch Glück. In Liebes Leben steht die Erzählung Abschied von Maverley. Erzählt wird die Geschichte von Leah, die als Kassiererin in dem kleinen Lichtspielhaus der Stadt zu arbeiten beginnt. Sie stammt aus einer streng religiösen Familie, ihr Vater erlaubt es ihr nicht, bei ihrer Tätigkeit auf die Leinwand zu schauen oder die Dialoge anzuhören. Außerdem sollte sie samstags nicht alleine nach Hause gehen. Hier kommt der Nachtwächter Ray ins Spiel, der diesen Begleitdienst übernimmt, weil er gewöhnlich auf seinem Rundgang ins Kino schaut. Ray ist mit Isabel verheiratet, die an einer Herzkrankheit leidet: beide interessieren sich für Leah und bedauern die strengen Regeln, denen sie unterworfen ist. Eines Tages ist Leah plötzlich verschwunden. Nach einiger Zeit wird bekannt, dass sie mit dem Sohn des Pfarrers der Vereinigten Kirche durchgebrannt ist, bei dem Leah gebügelt hatte, einem Saxophonspieler. Nach Jahren taucht sie in der Stadt mit zwei Kindern auf, ohne ihren Mann. Der alte Pfarrer ist inzwischen in den Ruhestand gegangen. Sie wendet sich an den neuen Pfarrer wegen der Kindergartenplätze für ihre Kinder. Zwischen beiden kommt es zu einer ehebrecherischen Beziehung, die der Pfarrer öffentlich auf der Kanzel ausposaunt. Die Kinder werden ihr weggenommen. Isabel ist inzwischen schwerkrank, Dauerpatientin im Krankenhaus, dort trifft Ray Leah, die hier Gymnastik für Krebspatienten betreibt. Isabel stirbt schließlich, Ray hat im Krankenhaus die Formalien erledigt, er geht nach Hause und denkt an Leah, deren Namen er aber vergessen hat. „Er stieg gerade die Treppe hoch, da fiel er ihm ein. Leah. Eine Erleichterung über alle Maßen, sich an sie zu erinnern“, endet die Geschichte. Auffällig an dieser Geschichte ist die negative Konnotierung von Religion, Kirche und Glaube. Gottes Bodenpersonal kommt schlecht weg. Auch Pfarrer sind nur durchschnittliche Leute, begehen Ehebruch, lassen sich scheiden, heiraten wieder, einen anderen Pfarrer, sprich eine Pfarrerin: „ich finde das zum Brüllen“, sagt Leah. Ein homosexuelles Pfarrerpaar kommt noch nicht vor. Was positiv bleibt, ist der Name, der biblische Name einer Frau, die sich im Gebärwettbewerb mit Rahel angestrengt hat. In der Kurzgeschichte Heimstatt erzählt ein junges Mädchen, Tochter eines Missionarsehepaars der Unitarier, das zu Onkel und Tante gegeben wurde, weil die Eltern nach Afrika gegangen sind, um, wie sie sagt, „Gutes zu tun“. Der Onkel, ein Arzt, betet vor Tisch und ist überrascht, dass seine Nichte nicht mitbetet. Auf Nachfrage erfährt er: „Sie (die Eltern) sagen gar nichts.“ „Das willst du mir doch nicht erzählen. Menschen, die keine Tischgebete sprechen, gehen nach Afrika, um den Heiden den Glauben zu bringen – man stelle sich vor!“ Der Onkel hat ein festgefügtes Lebensschema und Präferenzen. Er mag keine Einladungen von Nachbarn und auch nicht die Musik, die seine ältere Schwester Mona, eine Geigerin, in einem in Toronto ansässigen Klaviertrio spielt. Den Kontakt zu ihr hat er aus Gründen, die in ihrer Bevorzugung in der Kindheit liegen, abgebrochen. Dieses Trio spielt nun zufällig in der Stadt. Heimlich lädt die Tante die Nachbarn zu einem kleinen Haus-Konzert mit dem Trio ein, als der Onkel auf der Allgemeinen Jahresversammlung der Kreisärzte ist. Er kommt aber überraschend früher zurück, sieht das Arrangement, geht wortlos an seiner Schwester, die weiterspielt, vorbei in die Küche und holt sich was zu essen. Die Tante sagt am nächsten Morgen: „Das Heim eines Mannes ist seine Feste.“ Nun stirbt die Schwester und die Beerdigung soll in der anglikanischen Hosianna-Kirche stattfinden, etwas außerhalb stattfinden (obwohl Onkel und Tante inzwischen in der Vereinigten Kirche sind). Die Pianistin des Trios sitzt schon an der Orgel und präludiert, als der Onkel, Jasper ist sein Name, mit seinem Dienstmädchen Bernice, die in ihrer evangelistischen Gemeinde die Orgel spielt, hereinkommt, die Pianistin von der Orgel verscheucht, den Cellisten dazu und Bernice an ihre Stelle setzt. Dann wendet sich der Onkel zur Gemeinde und bedeutet mit einer Geste, sie solle singen. Und das tut sie denn auch. Sie singt. Ich will es stets bewahren, das alte schlichte Kreuz, / Bis alle Kunstjuwelen der Tod mir nehmen wird. / Ich will’s in Ehren halten, das alte schlichte Kreuz / Bis eines Tages es mir zur Krone wird. Inzwischen ist der Chor von der Altarseite hereingetreten und hat den Onkel eingekeilt Dieser ist es trotzdem zufrieden. Noch angesichts des Todes seiner Schwester hat er seine Vorstellung von Tradition durchgesetzt. Die Beerdigungsszene entbehrt nicht der Komik, die vor allem durch das störrische Verhalten des Onkels hervorgerufen wird. Das schlichte alte Kreuz. Wahrscheinlich hat er das Lied in der Kindheit mit seiner Schwester gesungen und ruft es ihr jetzt nach, eine geschwisterliche Geste trotz allen Streits. Mit der Nichtteilnahme an einer Beerdigung endet der Erzählband Liebes Leben, endet mit der Titelgeschichte, die vom Leben und Sterben ihrer Mutter erzählt, so persönlich wie nie. Darin erzählt sie von einer der wenigen Freundinnen ihrer Schulzeit, Diane. Aber ihre Mutter verbot ihr den Kontakt mit dem Mädchen. Später fand sie dann heraus, dass Dianes Mutter Prostituierte gewesen und an einer Krankheit gestorben war, die sich Prostituierte holen konnten. Bei der Beerdigung hatte der Pfarrer über das Bibelzitat gepredigt „Der Tod ist der Sünde Sold.“ Es gab darüber Streit, aber ihre Mutter fand es in Ordnung. Ihre Mutter bekam dann die parkinsonsche Krankheit. Die Erzählung schließt mit einer merkwürdigen Begebenheit aus der Zeit, als die Autorin noch ein Baby war, im Kinderwagen vor dem Haus lag und eine alte aggressive Nachbarin um das Haus strich, an den Fensterläden rüttelte und ihre Mutter sie gepackt und um ihr „liebes Leben“ ins Haus gerannt war. Diese alte verwirrt-aggressive Frau war, wie sich später herausstellte, einmal die Besitzerin des Hauses gewesen. Der letzte Absatz ist lakonische Bekenntnis, dass sie nicht nach Haus fuhr, als die Mutter im Sterben lag und auch nicht zu ihrer Beerdigung. Sie hatte kleine Kinder und niemanden bei dem sie sie lassen konnte. Zudem: „Wir hätten uns die Bahnfahrt schwer leisten können, und mein Mann verachtetet konventionelles Verhalten, aber warum ihm die Schuld geben? Ich empfand genauso. Wir sagen von manchen Dingen, dass sie unverzeihlich sind oder dass wir sie uns nie verzeihen werden. Aber wir tun es – wir tun es immerfort.“ Eben das, was sie in den fiktionalen short stories tun kann, dem Leben eine gnädige Wendung geben, und sei es nur den Anschein von Hoffnung, das verbietet das gelebte Leben, wenn etwas tatsächlich versäumt wurde. Aber in Liebes Leben hält die Erzählung vom Vater dem stand. Die Vierzehnjährige kann nachts nicht einschlafen, denkt über sich nach, war nicht mehr sie selbst. Und dann ergreift der Gedanke von ihr Besitz, etwas zu tun, einfach um zu sehen, ob so etwas möglich war. Sie fängt an daran zu denken, daß sie ihre kleine Schwester, die unter ihr schläft, erwürgen könnte. Sie steht auf, läuft im und um das Haus herum. In einer dieser Nächte begegnet sie dem Vater. Sie gesteht ihm ihre mörderischen Gedanken und der Vater sagt: „Kein Grund zur Sorge. Menschen haben manchmal solche Gedanken.“ Derselbe Vater, der sie mit dem Gürtel verprügelt hatte. „An jenem anbrechenden Morgen jedoch gab er mir das, was ich zu hören brauchte (...) Von da ab konnte ich schlafen.“ Das ist der biblische Realismus, der weiß, dass der Mensch auch böse sein kann – von Jugend auf. Und dass er ein verständnisvolles Vater- oder Mutterwort braucht: Ja, das gibt es, dass Menschen solche Gedanken haben. Mach dir keine Sorgen. Geh wieder schlafen. Wozu wollen Sie das wissen? In der Titelgeschichte des zu Beginn erwähnten gleichnamigen Buchs erzählt Munro, wie sie bei einer Autofahrt mit ihrem Mann einen merkwürdig großen Grabhügel auf einem kleinen Dorf-Friedhof entdeckt, ihn sich kurz anschaut, er hat ein Kreuzzeichen über dem Eingang und dann weiterfährt. Ein Jahr später, eine Mammographie hat einen beunruhigenden Befund ergeben und ein Gespräch über eine mögliche Biopsie steht in 14 Tagen an, macht sie sich, wieder mit ihrem Mann, auf die Suche nach diesem Grabhügel in der von eiszeitlicher Geographie bestimmten Landschaft. Mit einiger Mühe finden sie den Friedhof wieder, es ist der einer lutherisch-deutschen Gemeinde, St. Peter in Peabody/Scone. Neben dem großen gibt es noch einen kleineren Hügel. Sie wollen die Pastorin sprechen, doch die ist nicht da. Aber eine in Heimatkunde bewanderte Frau aus der Gemeinde gibt ihnen Auskunft. Es ist die Grabstätte der Familie Mannerow und in dem größeren Grabhügel sei ein dreijähriger Sohn der Familie 1895 beigesetzt worden. Munro schaut sich die Kirche an, in der sie in deutscher Frakturschrift den Spruch entdeckt: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.“ Und auf der anderen Seite: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen.“ Sie sagt: „Die Worte an der Wand rühren an mein Herz, aber ich bin nicht gläubig und werde auch durch sie nicht gläubig.“ Sie entziffert die Symbole in den Kirchenfenstern, von der Taube über den Kelch, das Kronenkreuz und das Lamm Gottes bis zum Pelikan. Schließlich, die Biopsie ist inzwischen abgesagt worden, es soll aber noch ein Gespräch mit der Radiologin geben, suchen sie den letzten Nachfahren der Familie Mannerow auf. Seine Frau erklärt: Als das Gewölbe das letzte Mal geöffnet wurde, für eine Mrs Lempke, hatte sie ein Stück weit ins Innere geschaut. Das stand neben den Särgen ein kleiner Tisch mit einer aufgeschlagenen Bibel darauf. Und neben der Bibel eine Petroleumlampe. „Niemand weiß, warum sie das so gemacht haben.“ Nach dem Gespräch mit der Radiologin, der Knoten sei wohl harmlos, sagt sie auf dem Heimweg vom Krankenhaus unvermittelt zu ihrem Mann: „Meinst du, sie haben Öl in diese Lampe gefüllt?“ So tun es ja die Katholiken auf den Friedhöfen, in symbolischer Aufnahme des Requiemsatzes: Möge das ewige Licht ihnen leuchten. Jedenfalls leuchtet in dieser lakonisch erzählten Geschichte die große Kunst der Nobelpreisträgerin Munro auf, letzte Fragen mit dem Alltag und zufälligen Begegnungen zu verbinden. Die Überbleibsel früherer Glaubensanschauungen werden als melancholische Erinnerung an ehemalige Gewissheiten zur Anfrage an die agnostische Haltung der Autorin. Und sie ist so souverän, diese Infragestellung so stehen zu lassen.
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/89/hjb30.htm
|