
Exotheologie |
Im Auge des BetrachtersBemerkungen zur ART Karlsruhe 2014Wolfgang Vögele 1. Wimmelbild
Leben heißt, sich dem Unübersichtlichen und Unüberschaubaren auszusetzen und sich darin nach Möglichkeit einen kleinen überschau- und berechenbaren Raum der Kenntnis (oder der Ordnung?) zu schaffen, welcher menschlichen Überlegungen, Planungen und Entscheidungen, also rationalem Handeln zugänglich ist. Unübersichtlichkeit ist ein Kennzeichen der Moderne, und ihre Lebenskunst oder Alltagsphilosophie besteht darin, dieser Unübersichtlichkeit kleine lebenserhaltende Räume eigener Gestaltung abzuringen. Das war anders zu Zeiten, die stärker von der Tradition bestimmt waren. Auch damals gab es Unübersichtlichkeit, aber sie ließ sich außen vor halten, denn Tradition gab jedem Menschen wechselnde Räume des Geordneten vor. Und wenn der traditionsgeleitete Mensch die dazugehörigen Regeln beherrschte, konnte er sich in diesen abgegrenzten Räumen der Ordnung frei und entscheidungssicher bewegen. Tradition schuf abgegrenzte Räume des Überschaubaren und damit Verhaltenssicherheit. An ihnen und an den gesetzten Grenzen konnte sich Denken und Handeln orientieren. Zwar wirkten die Räume der Tradition gelegentlich arg beengt, aber der Gewinn der Überschaubarkeit ließ sich nicht bestreiten und verschaffte Sicherheit. Wer sich in der wimmelnden, unübersichtlichen Moderne allerdings dauernd in Räume des Überschaubaren zurückzieht, der läuft Gefahr, Wesentliches und Wichtiges zu verpassen. Die Räume des Überschaubaren erscheinen nicht mehr als Konsense der gesellschaftlichen Tradition, sondern als individuell, um nicht zu sagen: eigenbrötlerisch oder wenigsten milieuspezifisch aufgesuchte Rückzugsräume. Im Angesicht der Moderne verwandelt sich Tradition plötzlich in Fundamentalismus; sie schafft nostalgische Ruinen des Gestrigen, die von den modernen Netzen der Kommunikation abgeschlossen sind und die ihre Bewohner fälschlich für Fluchtburgen halten. Moderne ist unüberschaubar und grenzenlos. Das fasziniert Menschen, aber genauso verwirrt und verunsichert es sie auch. Unübersichtlichkeit ist Segen und Fluch zugleich. Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des modernen Menschen, sich irgendwie an dieser Unübersichtlichkeit abzuarbeiten. Er steht vor der Aufgabe, sich damit zu arrangieren. Und das macht den Unterschied zwischen der Moderne und den alten Gesellschaften der Tradition aus. Im einen Fall ist die Ordnung vorgegeben, die Grenzen sind gesetzt, und das Individuum muss sich daran nur noch anpassen, im modernen Fall muss die Ordnung erst geschaffen werden. Das Individuum muss Grenzen bestimmen, aufrechterhalten und regelmäßig kontrollieren. Der Dschungel der Unübersichtlichkeit wächst nachhaltig von überall her, aus allen Richtungen und in alle Richtungen. 2. Über die Anthropologie des KunstmessebesuchersEine Kunstmesse ist im Grunde nichts anderes als ein arrangiertes, unübersichtliches Chaos, eine gigantische Ausstellung, die nicht kuratiert wurde, wobei konzediert sei, dass es auch Ausstellungen gibt, die ihren Kuratoren zum arrangierten Chaos geraten. Kunstmesse zeigen Kunst, die gegenwärtig zum Verkauf steht. Und das unterscheidet Karlsruhe nicht von Basel, New York, Miami und – wie Kunstsachverständige und Galeristen sagen – Cologne. Bevor ich nun auf die ART Karlsruhe komme, muss ich noch von einer anderen Messe berichten. Ein halbes Jahr vor der ART Karlsruhe fand in denselben Messehallen am selben Ort die Haustiermesse „Tierisch gut“ statt. Hunderte von Tierhändlern stellten Tausende der besten Freunde des Menschen aus, Labradore und Pekinesen, Guppys und Goldfische, Siamkatzen und frisch frisierte Pudel. Den besuchenden Herrchen und Frauchen war es erlaubt, die eigenen Hunde mitzubringen, Impfausweis und Attest vorausgesetzt. Man hätte nun vermuten können, die Hunde in ihrer schieren Menge seien alle in Revier-, Balz- und Territorialkämpfen aufeinander losgegangen. Aber das Gegenteil war der Fall. Selbst Tiere, die so bedrohlich aussahen, dass selbst der Nichtkenner sie für Kampfhunde halten musste, zogen friedlich hinter ihren Herrchen her. Gebell war nicht zu hören, auch kein aufgeregtes Geschrei der Besitzer: "Keine Sorge, der beißt nicht." Pekinesen wie Dobermänner trabten lethargisch und stoisch durch die endlosen Gänge. Die Augen halb geschlossen und die Ohren angelegt, wichen sie nicht von der Seite ihrer Besitzer, die Aufmerksamkeit von den Messeständen völlig abgewandt, obwohl es dort überall für Vierbeiner besonders Interessantes zu sehen gab, von Plastikknochen über Wärmedecken und Hundeleinen in sämtlichen Farben der Malerpalette bis zum Fertigfutter in allen Variationen. Eine Hundetrainerin erklärte das so: Wenn die Hunde von einer komplexen und unübersichtlichen Situation überfordert sind, dann versetzen sie sich in eine Art Standby-Modus. Es macht keinen Sinn, auf jeden Anreiz, auf jede Provokation, auf jeden verlockenden Duft zu reagieren. Also schalten die Tiere erst einmal in den Ruhemodus und warten ab, bis es vorbei ist oder bis die Situation überschaubarer erscheint. Dann kann der tierische Freund immer noch bellen, fressen oder zubeißen. Das Beispiel gibt zu denken, obwohl selbstverständlich nicht Kunstkäufer und Schoßhunde miteinander verglichen werden sollen. Aber es fragt sich, ob der Besucher einer Kunstmesse nicht spätestens nach der zehnten Galerie ebenfalls in eine Art Standby-Modus fällt und seine Aufmerksamkeit nur noch bei künstlerischen Sensationen auf Betriebstemperatur schaltet. Wahrscheinlich ist das doch komplizierter, und der Tierversuch verschafft keine neuen Erkenntnisse für die Kunstpsychologie. Die schiere Überfülle von Bildern und Objekten erschwert die Wahrnehmung auf der Kunstmesse. Allerdings: Wer über die Unübersichtlichkeit von solchen Messen seufzt, dem ist der Vorwurf zu machen, er verhalte sich reichlich altmodisch und als Besucher unprofessionell. Denn jeder weiß, dass sich Aufmerksamkeit nicht dauerhaft aufrechterhalten läßt. Aufmerksamkeit braucht ihre Pausen. Professionell handelt also, wer sich als Besucher von Kunstmessen mit dem Unübersichtlichen als Normalzustand arrangiert. Viel besser als mit Seufzen, Überdruss oder gar Klagen kommt er mit Gelassenheit und Vertrauen auf die zufällige Entdeckung zurecht. (Keinem Kunstmessebesucher muss etwas verlorengehen, es steht ja alles auch auf den virtuellen Galerieseiten im Internet.) Humane Aufmerksamkeitsreserven, visuelle und intellektuelle, sind begrenzt. Darum sind sie sorgfältig zu dosieren, nicht von allem ein bisschen, sondern Konzentration auf das Wenige, das ins Auge fällt, nachdem ein sporadischer Überblick ein wenig Orientierung verschafft hat. Dass der Besucher übersieht, ignoriert und sofort wieder vergisst, das muss er in Kauf nehmen. Im Grunde genügt ein Kunstwerk, an dem der flüchtige suchende Blick hängen bleibt und danach länger verweilt, um der Faszination, den emotionalen wie intellektuellen Gründen für das Verweilen nachzuspüren. Gute Kunstwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie, aus welchen Gründen auch immer, Aufmerksamkeit fesseln und dem ästhetischen Interesse nachhaltig standhalten. Bestimmte Künstler, auch solche, die in Karlsruhe ausgestellt waren, setzen auf die Provokation. Aber Empörung schießt genauso schnell in ungeahnte Höhen wie sie auch wieder versiegt. Unter der Oberfläche des Riskanten und Provozierenden kommt schnell das Banale zum Vorschein. Der Produktion und Rezeption von Kunstwerken liegt ein Spiel mit der Aufmerksamkeit[2] zugrunde, und dieses kann sich selbstverständlich abnutzen oder ins Leere laufen. Kitschige Kunstwerke, die in Karlsruhe ebenfalls präsent waren, sind dadurch charakterisiert, dass der Betrachter sie mit kurzem, flüchtigem Blick registrieren, verstehen und intellektuell einordnen kann. Der Kurzschlüssigkeit des Kitsch entspricht der flüchtige Blick auf der Seite des Betrachters. Deswegen kommen kitschige Werke dem Besucher einer Kunstmesse entgegen, denn sie nehmen Aufmerksamkeit nicht richtig gefangen. Aber wer nur den Kitsch wahrnimmt, der verlässt die Messehallen unbefriedigt. Der Seufzer des Kunstmessebesuchers rührt daher, dass zu viele Kunstwerke seine Aufmerksamkeit beanspruchen. Die Augen des Betrachters verlieren irgendwann die Fähigkeit, den Blick noch scharf zu stellen. Sie haben nicht mehr die Kraft, alle Bilder auch nur mit einem flüchtigen Blick zu bedenken. Spannender als der Kitsch sind Kunstwerke, die eine längere Betrachtung lohnen, weil sie eine gedankliche oder emotionale Aufgabe stellen, Kunstwerke, die es aushalten, wenn sich Blick, Gefühl und Gedanken unter die Oberfläche des Dargestellten richten. Gute Kunstwerke benötigen Konzentration und einen nachhaltig aufmerksamen Blick. Aber bei einer Kunstmesse stoßen das Bedürfnis nach Konzentration und die dauernde, überfordernde Ablenkung zusammen. Eine Kunstmesse verträgt weder den trägen, lethargischen Hundeblick noch den allwissenden Rundumblick des Connaisseurs, der ohnehin schon alles weiß und nicht mehr überrascht werden kann. Wahrnehmung ist Verwandlung von Fülle in Einzelnes und Besonderes, ihr Kern besteht darin, dass sie Komplexität reduziert (Niklas Luhmann): Besser als auf einer Kunstmesse kann man das nirgendwo lernen. Und die Ablenkungen lauern überall. Interessanter als die Kunstwerke können die Menschen sein, die um sie herum stehen. Manchmal ist das Verhalten der Besucher interessanter zu betrachten als das der träge auf ihren Hockern sitzenden Galeristen, die gelegentlich an humorlose oder verbitterte Museumswärter erinnern: Wehe dir, wenn du den Prospekt oder die Postkarte anrührst, dann wirst du mit dem Smartphone ins Kunstgefängnis gebeamt. Wenn sich die Gänge zwischen den Boxen aus den stets gleichen weißen Wänden mit Menschenmassen füllen, dann ist man schnell geneigt, auf jedes Bild, das hinter den Massen sichtbar wird, nur noch einen ganz flüchtigen Blick zu werfen. Aber das Menschengedrängel steigert die Bedeutsamkeit der Messe. Wichtige Dinge finden sich stets dort, wo viele Menschen in der Schlange stehen. Und das ist auch umzukehren: Wo sich viele Menschen drängeln, muss in jedem Fall etwas Wichtiges zu finden sein. Also sammeln alle Prospekte, Post- und Visitenkarten, blättern zerstreut in den herumliegenden Katalogen, die man gegen eine Schutzgebühr erwerben kann. So paradox es klingen mag: Man kann durch die Messehallen gehen, ohne ein einziges Bild zu sehen. Denn neben jedem Bild, das einem Betrachter ins Auge fällt, hängt gleich das nächste Bild, das noch interessanter sein könnte. Die Angst, etwas Besseres und Schöneres zu verpassen, verlässt für die Dauer seines Rundgangs keinen Kunstmessebesucher. Und diese Angst verdünnt jede Wahrnehmung und Beobachtung ins Oberflächliche, ins Hastige und Eilige. Ein Bild oder eine Skulptur, als einziges oder als eines von wenigen aufgehängt oder gestellt, können einem Raum eine besondere Aura verleihen. Mehrere tausend Kunstwerke in einer neutralen Messehalle können keine Aura entwickeln, weil die Kunstwerke sich gegenseitig in ihrer Ausstrahlung behindern, wobei Ausstrahlung hier nicht esoterisch zu verstehen ist. Der Strom des ästhetischen Kontakts kann nicht richtig fließen, der außergewöhnliche Moment der Überraschung und der Faszination dementiert sich ständig selbst. Oder er verlängert und vervielfacht sich ins Uferlose. 3. Moden, RichtungenAuf der ART 2014 dominierte wie in den letzten Jahren die Malerei, obwohl sich die Messeleitung in vorbildlicher Weise darum bemühte, Skulpturen aus Holz und Stein den nötigen Raum innerhalb und außerhalb der Messehallen zu verschaffen. Darüber geht das meiste derjenigen neuen Kunstrichtungen verloren, die für ihre Darstellung die Hilfsmittel des digitalen Zeitalters in Anspruch nehmen. Computer- und Videokunst, in Karlsruhe sowieso eher dem ZKM (Zentrum für Kunst- und Medienkommunikation) vorbehalten, war nur in Ausnahmefällen zu sehen. Erst im Rückblick wird deutlich, dass manche Themen gar nicht oder sehr spärlich besetzt waren. Dazu zählen vor allem alle Formen der Interkulturalität, der Diversität, des Pluralismus. Selbstverständlich stellte eine Galerie die obligatorischen Songline-Bilder der Aborigines aus, aber das blieb doch eine Ausnahme. Und ähnliches wie für das Thema der Interkulturalität gilt für das Thema der Religion. Künstler, Galeristen und Kunstkäufer scheinen in ihrer Mehrheit religiös unmusikalisch zu sein. Von zwei wichtigen Ausnahmen wird weiter unten die Rede sein. Insgesamt kann man nach dem Gang durch die Karlsruher Messe den Eindruck haben, die Künstler beschäftigten sich mehr mit dem Ornamentalen und Schmückenden als mit den Zuständen und Krisen der Gesellschaft. Aber dieses Urteil ist sofort mit Einschränkungen zu versehen, denn was in Karlsruhe gezeigt wurde, war ja keineswegs für den gesamten gegenwärtigen Kunstmarkt repräsentativ. Dennoch lohnt es sich, das Thema wenigstens an einem Beispiel weiter zu verfolgen. Wie im letzten Jahr fiel auf, dass viele Künstler bemalte Holzskulpturen mit „normalen“ Menschen zeigten. Ein Beispiel dafür ist Silvia Siemes. Die in Freiburg geborene Künstlerin zeigt Menschen in alltäglichen Posen, manchmal stark verkleinert, manchmal in Lebensgröße. Die "normalen" Menschen sind das Resultat einer längeren kunstgeschichtlichen Entwicklung: An die Stelle von Engeln, Halbgöttern, Nymphen, Zentauren, von Fluss-, Baum- und Stadtgöttern der Antike, von Sirenen, Nixen, Musen, Kriegern und Helden traten im Mittelalter die bedeutenden Funktionsträger wie Fürsten, Könige, Kaiser, Prinzessinnen und Prinzen, Großherzöge und Feldmarschälle. Sie bestimmten die Porträtmalerei und –skulptur, ganz zu schweigen von den Aposteln, den Christus- und Heiligenfiguren der christlichen Heilsgeschichte. Heute sind an ihre Stelle normale alltägliche Menschen getreten: Spaziergänger, Leserinnen, staubwischende Hausfrauen, Wein- und Espressotrinker. Ihnen fehlen Heiligenschein, Orden, Schwerter und Muskelpakete. An die Stelle der Demonstration von Heiligkeit, Glauben und Frömmigkeit, Kraft und göttlicher Gewalt, von herrschaftlichem Anspruch und Autorität sind Gesten der Zurückhaltung und der Demut getreten. Die modernen Figuren verraten eine gewisse Melancholie, oft eine sehr rigorose Abwesenheit von Humor. Die dargestellten Menschen sind mit alltäglichen Verrichtungen beschäftigt, sie füllen keine Funktion aus und erheben – als Skulptur – keinen stellvertretenden Machtanspruch. Sie zeigen nichts als sterbliche Menschen. Eine Skulptur, die einen Weintrinker darstellt, verrät nichts über die gesellschaftliche Funktion des Dargestellten. In dieser Normalität des Alltags finden sich die Menschen plötzlich als gleiche wieder, sie unterscheiden sich nicht mehr voneinander. Und dennoch wird diese Gleichheit nicht mehr – wie in der politisch engagierten Kunst – gefeiert, sie wird eher mit einer gewissen Nüchternheit zur Kenntnis genommen. Der Weintrinker als farbig bemalte Holzskulptur demonstriert eher eine gewisse resignierte Melancholie. Dieser Normalität kann niemand entkommen, weder die Bundeskanzlerin noch der einfache Angestellte, der um 17.00 Uhr sein Büro verläßt und mit der Straßenbahn nach Hause fährt. Das Außergewöhnliche findet im Alltag nicht mehr statt, nur als „Brennpunkt“ im Fernsehen. In diesem Jahr lief ich durch die vier Hallen und stellte fest, dass ich von denselben Werken und Künstlern fasziniert war wie im Jahr 2013. Je länger ich durch die Gänge schlenderte, desto mehr Werke und Künstlernamen aus dem Essay vom letzten Jahr fielen mir ein. Ich sah einen künstlerisch ambitionierten Film vor mir ablaufen, den ich schon einmal gesehen hatte. Vorlieben und Abneigungen erhalten sich, aber bei manchen Künstlern, die in diesem Jahr mit ganz anderen Bildern als im letzten Jahr vertreten waren, war es frappant, dass mir die neueren Bilder genauso auffielen wie die älteren. Ein Beispiel dafür ist der Leipziger Maler Michael Triegel. 4. Deus absconditusMichael Triegel, der als Porträtist des Papstes Benedikt XVI. bekannt wurde, war auf der ART Karlsruhe mit einem großformatigen Bild mit dem Titel „Deus absconditus“ vertreten. Das Bild zeigt eine Werkstatt oder eine kleine Kapelle. Darin ist vor einem Holztisch ein großes Holzkreuz mit der Figur eines Gekreuzigten aufgestellt. Die Figur des Gekreuzigten verdeckt ein großes, weißes Laken. Dieses Laken ist mit drei Fäden an der Decke aufgehängt. Rechts steht in einem Holzkasten die segnende Figur eines auferstandenen Christus. Links von dem Tisch sitzt Maria, die ihr Haar mit einem weißen Tuch verhüllt und ihr Gesicht von Kreuz und Betrachtern abgewandt hat. Vor ihr, auf dem Tisch, scheint eine Schreibmaschine zu schweben. Rechts am Bildrand kniet eine weiße Gestalt, im Maßstab sehr viel kleiner als Maria. Sie hat die Hände zum Gebet gefaltet und trägt eine weiße Kutte sowie die bekannte Spitzkappe mit Sehschlitzen wie man sie von spanischen Bußbruderschaften aus den Karwochenprozessionen kennt. Links neben dem Kruzifixus unter dem Tisch steht eine weitere Holzkiste mit den Köpfen zweier geschlachteter Tiere. Das Bild ist für jeden Theologen eine Herausforderung. Denn der unbekannte, verborgene Gott ist ja traditionell derjenige Gott, der sich gerade nicht in der Bibel offenbart, die abgedunkelte, unsichtbare Seite Gottes, die den Menschen nicht zugänglich ist. Triegel münzt diese Spannung zwischen sichtbarem und unsichtbarem Gott um auf das Bild des Gekreuzigten. Dieser gekreuzigte Christus (Deus revelatus) wird mit einem Tuch verdeckt. Deswegen ist er verborgen. Und als ob das noch nicht reichen würde, hat Triegel an das weiße Laken unten noch ein besonderes Blatt gemalt, auf dem trinitarische Schemata zu sehen sind. Man muss dafür ganz nah an das Bild herangehen, aber wer sich das traut, wird mit theologischen Informationen überhäuft. Triegel, der keiner christlichen Kirche angehört, war schon immer von den intellektuellen Beständen des christlichen Glaubens fasziniert. Man kann in dem DIN A 4 Blatt mit den trinitarischen Zeichnungen eine Ironie sehen. Das aufgemalte Dreierschema kann niemals der Heilsgeschichte gerecht werden, insbesondere nicht Kreuzigung und Auferstehung. Auf der anderen Seite kann man auch fragen, wieso gerade das Kreuz mit der Christusfigur verdeckt wird. Muss die Holzplastik restauriert werden? Ist der Gekreuzigte in Vergessenheit geraten? Ist er aus dem kulturellen Gedächtnis der wimmelnden Moderne entfernt worden? Das Bild lässt unterschiedliche Auslegungen zu und stellt den Betrachter gerade darin vor die Aufgabe der Auffrischung seiner theologischen Vorkenntnisse. Es wäre ohne Schwierigkeiten möglich, das Bild einer Gruppe von Examens- oder Priesteramtskandidaten als Essayaufgabe für die dogmatische Prüfung vorzulegen. Aber dem Bild ist anzumerken, dass es Triegel um mehr geht als um die Evokation möglichst vieler theologischer und ästhetischer Quellen. Er arbeitet daran, das Alte, Traditionelle – und dazu gehören Theologie, Renaissance samt ihren symbolischen und begrifflichen Bildsprachen – neu zur Diskussion des Betrachters zu stellen. Damit bewegt er sich weit außerhalb der künstlerischen, intellektuellen und philosophischen Öffentlichkeit. Malerisch schließt Triegel an die Renaissancemalerei an, er belebt eine intellektuelle und ästhetische Tradition wieder, die längst in den Museen und Kathedralen erstarrt war. Die entsprechenden Maltechniken hat Triegel perfektioniert und er unterscheidet sich damit erheblich vom Mainstream, dem zum großen Teil dieses Bedürfnis nach Genauigkeit, Präzision und Rückbezug auf das Vergangene abhanden gekommen ist. Triegels großformatiges Bild war für mich eine der faszinierendsten Entdeckungen der gesamten Messe. Nach dem Verkaufspreis erkundigte ich mich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Bild überhaupt zum Verkauf stand. 5. Wer am Holze hängtGanz anders als Triegel, aber nicht weniger interessant, praktiziert der Bildhauer Thomas Hildenbrand den Rückbezug auf die (christliche) Symbol-, Motiv- und Bildgeschichte. Auch er zeigt eine Figur des Gekreuzigten. Aber diese ist, anders als bei Hiegel, ganz menschlich dargestellt. Ihm fehlt Triegels Motiv der theologischen Suche nach dem verborgenen Gott, gekreuzigten Gott (Jürgen Moltmann). Eine Gruppe aus zwei Figuren aus Lindenholz trägt den Titel „Beweinung“. Beide Figuren stehen auf einem silbern angemalten Sockel. Der Gekreuzigte ist bis auf den grauen Lendenschurz nackt, seine Arme sind wie bei einem Gekreuzigten üblich über die Schultern ausgebreitet. Der wehende Faltenwurf des grauen Lendenschurzes wirkt so als sei er direkt von einem mittelalterlichen Altar übernommen. Es ist sicher, dass dieser Tote oder Leidende an einem Kreuz hängt, aber von diesem Kreuz selbst ist nichts zu sehen. Hildenbrand zeigt im Gegensatz zu Triegel einen menschlichen, leidenden Gott. Die zweite Figur steht rechts vor dem Gekreuzigten; sie scheint von dem Geschehen überwältigt. Der Mann, der eine schwarze Hose trägt, greift sich mit beiden Händen an den Kopf, aus einer Verzweiflung heraus, die ihn zur Flucht bewegt. Er macht den Eindruck, als überfordere ihn das Geschehen, als wolle er fliehen, weil er diesen grausamen Tod Jesu nicht mehr aushalten kann. Als könne er die Szene nicht mehr ertragen, als seien ihm die Schmerzen zu viel, als würde das Geschehen ihm einen Anfall von schweren Kopfschmerzen oder Migräne verursachen. Das Geschehen der dargestellten Szene ruht in sich selbst. Die beiden Figuren schauen den Betrachter nicht an. Der Mann, der sich an den Kopf faßt, könnte der namenlose, fliehende Lieblingsjünger aus dem Johannesevangelium sein. Die Gesamtskulptur gewinnt ihre eindrückliche Spannung aus dem Gegensatz zwischen dem flüchtenden Mann, der bereit ist wegzulaufen, und dem hängenden, ruhigen, wahrscheinlich bereits verstorbenen Christus. Hildenbrands Thema ist die Grausamkeit des Geschehens. Den gekreuzigten Gott kann kein Mensch ertragen in dieser Niedrigkeit. Durch die Reduktion des gewählten Motivs auf zwei menschliche Figuren kann Hildenbrand dem Geschehen eine eindrückliche Gestalt geben. Alles Dingliche, jede Art von Kontext, also der Hügel Golgotha, die Stadt Jerusalem im Hintergrund, die beiden mitgekreuzigten Verbrecher, der römische Hauptmann, schließlich sogar das Kreuz als Hinrichtungsinstrument selbst, wird ausgespart. Der Betrachter muss es sich hinzudenken, obwohl in diesem Fall alle zusätzlichen Details doch eher ablenken vom Motiv der Beziehung zwischen dem gekreuzigten Toten und dem trauernden, verzweifelten Menschen, sei er nun ein Jünger oder nicht. Eine zweite Plastik von Hildenbrand trägt den Titel „Corpus“; sie besteht aus nur einer Figur und erinnert an die Kreuzigungsfigur aus der „Beweinung“. Die Haltung, ausgebreitete Arme, gesenkter Kopf, ist dieselbe. Nur trägt dieser Gekreuzigte eine Hose statt eines Lendenschurzes und das Haar ist nicht zur Glatze rasiert, sondern auf kurze Länge geschnitten. Dieser Gekreuzigte ist ganz Leib. Auch hier wählt Hildenbrand wie bei der Beweinung des Verfahren des Ausschnitts und der Reduktion. Bis auf den leidenden, gefolterten Menschen fehlt alles andere. Das Umfeld, den Kontext kann sich der Betrachter aus anderen Bildern und aus der Lektüre der Bibel hinzudenken. Aber Hildenbrand hat nicht nur das Selbstverständliche weggelassen. In der Konzentration auf den Leib des Gekreuzigten steckt auch eine Deutung des Geschehens, die seine Grausamkeit, seine Unmenschlichkeit noch einmal deutlicher zum Ausdruck bringt als andere konventionellere Darstellungen. Und in einem tieferen, theologischen Sinn, den Hildenbrand vielleicht gar nicht beabsichtigt hat, ist auch das eine Darstellung des menschlichen, verborgenen Gottes. 6. KuckucksuhrenVon Stefan Strumbel, dem die ART im Jahr 2013 viel Aufmerksamkeit und Raum gewidmet hatte, waren in diesem Jahr neben anderem die schon bekannten Kuckucksuhren zu sehen. Auch Strumbel setzt sich wie Triegel und Hildenbrand mit der Tradition auseinander und verformt sie. Die traditionelle Kuckucksuhr wird farblich bis an den Rand des Kitschigen gesteigert und mit neu-alten Symbolwelten angereichert. Der Totenkopf ist aus dem Stillleben als Memento mori bekannt, Strumbel nutzt ihn auf dem folkloristischen Zeitmesser, um an die Vergänglichkeit des Menschen zu erinnern. Das Grelle, Spielerische und farblich Schrille seiner Arbeiten unterscheidet ihn von den beiden anderen der hier betrachteten Künstler. Dennoch liegt auch ein theologischer Sinn darin, mit Zeitgebung und Zeitdeutung schrill, humorvoll und ironisch umzugehen. Wem die Stunde so humorvoll schlägt, der kann auch all die Beigaben, den Zierrat, das Überflüssige und Verschwenderische einer Kunstmesse ertragen. Wimmelbilder wirken auf den ersten Blick unübersichtlich. Aber im Unübersichtlichen lassen sich ästhetische und theologische Entdeckungen machen. Anmerkungen |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/89/wv11.htm
|
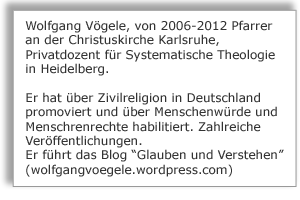 Leben in der Moderne gleicht einem Wimmelbild
Leben in der Moderne gleicht einem Wimmelbild