
Kirche und Theologie |
||
Glaube als Einstellung zum WissenVolker Gerhardt
Wer – als Mensch, versteht sich – wohnen will, muss leben, und wer leben möchte, muss wohnen können. Selbst wenn einer schlecht wohnt, ist er damit noch nicht tot. Die Frage ist nur, ob man schon gut lebt, wenn man nicht so wohnt, wie das Möbelhaus es gerne hätte. Offen bleibt auch, was aus der Firma geworden wäre, wenn der lockere Spruch die Adressaten dazu gebracht hätte, ihr selbstbestimmtes Leben nicht mit dem Zusammenschrauben vorgefertigter Möbelteile zu vertun. Der Reiz des Reklameeinfalls liegt im ironischen Spiel mit dem Doppelsinn von „Leben“, das sich sowohl deskriptiv wie auch normativ verstehen lässt: Leben kann die Tatsache des Noch-nicht-gestorben-seins, aber auch den anspruchsvollen Vollzug des Daseins meinen; es kann das „nackte“ wie das „gute Leben“ bezeichnen. Die Werbung ist offenkundig auf das „gute Leben“ bezogen. Doch niemand käme auf die Idee, seinen Traum vom guten Leben mit den Produkten dieser Firma zu möblieren. Gleichwohl würde keiner in Zweifel ziehen, dass sich mit ihnen leben lässt, solange man sich noch keine richtigen Möbel leisten kann. Die Kunden verstehen das ganz richtig, wenn sie die preiswerten Möbel in dem Bewusstsein kaufen, dass es besser ist, erst einmal zu wohnen. Denn das ist, nach einem anderen Werbespruch des Möbelriesen, „besser als stehen“. Wer pointierte Sprüche variiert, partizipiert am Sprachwitz der ersten Formulierung. Doch wenn man dabei deren Logik verfehlt, geht der Vorteil schnell verloren. So ist es, wenn man „wohnen“ und „leben“ durch „glauben“ und „denken“ ersetzt: „Glaubst du noch oder denkst du schon?“ Im ersten Hören klingt diese von der antiklerikalen Giordano Bruno-Stiftung in Umlauf gebrachte Variation plausibel, und es zeigt sich schnell, dass sie sich mühelos im Gedächtnis hält. Das ist eine günstige Voraussetzung für die mit ihr bezweckte Reklame gegen den Glauben. Aber taugt sie auch als Werbung für das Denken? Sehen wir davon ab, dass vom Hintersinn der ersten Formel nichts bleibt und von Selbstironie keine Rede mehr sein kann: Alles ist auf den unterstellten Gegensatz von Denken und Glauben gegründet: „Schon“ und „noch“ nehmen das Epochenschema des Übergangs vom Zeitalter der Religion zu dem der Metaphysik und schließlich zu dem der positiven Wissenschaft in Anspruch und verkürzen den historischen Dreischritt auf den bereits durch Heben eines Beins zu bewältigenden Fortschritt vom Glauben zum Denken. Und dieser eine Schritt ist mit der zur Selbstverständlichkeit erhobenen Erwartung verknüpft, dass die Zeit des Glaubens endgültig abgelaufen und nunmehr die des Denkens angebrochen sei. Jeder, der „noch“ glaubt, hinkt seiner Zeit hinterher; um aufzuholen, ist er es sich schuldig, nun endlich zum Denken überzugehen. Dabei ist das „schon“ wohl nur dem variierten Werbespruch geschuldet. Denn selbst wenn einer ernsthaft an das „Glaubst du noch oder denkst du schon?“ glauben sollte, kann er nicht der Ansicht sein, Denken sei eine Errungenschaft der letzten Jahrhunderte. Denken und auch Wissen muss es bereits viel früher gegeben haben. Tatsächlich gehört das Denken zu den ältesten Leistungen der Menschheit. Es dürfte lange in Übung gewesen sein, ehe es einen prägnanten begrifflichen Sinn von Glauben möglich gemacht hat. Es muss es aber auch später noch gegeben haben, ehe jemand verstehen konnte, was Glauben und was Denken ist. Wie sollen wir jemanden als gläubig verstehen, wenn wir nicht wenigstens im Ansatz begriffen haben, was das ist? Wie sollte einer vom eigenen Glauben sprechen, der nicht über die Fähigkeit zum Denken verfügt? Was wäre das für ein Glauben, der nicht weiß, dass er sich vom Wissen unterscheidet? Um auf diese und andere Fragen zu antworten, muss man das Verhältnis von Glauben und Wissen einer näheren Betrachtung unterziehen, das auf beiden Seiten freilich immer schon das Denken enthält. 2. Die Unerlässlichkeit des Wissens. Das Wissen gehört zu den konstitutiven Bedingungen des menschlichen Daseins. Zwar kann man in bestimmten Lebenslagen darüber klagen, dass es einem fehlt oder lückenhaft ist. Doch dann geht es um begrenzte Wissensbestände, mit denen man zu wenig oder gar nicht vertraut ist. Aber schon die Klage macht deutlich, wie sehr man auf das Wissen angewiesen ist. Die Angewiesenheit auf das Wissen darf freilich nicht dazu führen, es zum Ausschlusskriterium für menschliches Leben zu erheben. Wer weiß schon, was er im Schlaf tatsächlich noch weiß? Überdies gibt es Fälle von Erschöpfung und Verwirrtheit, von Ohnmacht, Narkose oder Trunkenheit, in denen man seinen personalen Status als Mensch nicht verliert. Das gleiche gilt für jene, die durch ihr Lebensalter, durch gravierende Mängel in der Erziehung oder durch einen psycho-physischen Defekt nicht in der Lage sind, über Wissen zu verfügen. Sie sind und bleiben Menschen. Gleichwohl ist die stets auf eine durchschnittliche Funktion bezogene und zur Norm erhobene Lebensleistung des Menschen an die Fähigkeit zu wissen gebunden. Über sie muss jeder individuell verfügen können. Folglich ist es das Ziel einer jeden Erziehung, dass jeder Wissen erwirbt und es individuell unter Beweis stellen kann, obgleich der größte Teil des Wissens menschheitsgeschichtlich vererbt und kulturell versichert ist. Dennoch kann jeder sein eigenes Wissen haben, mit dem er – meist innerhalb der logischen, grammatischen und pragmatischen Regeln – persönlich umzugehen hat. Es ist wichtig, vor allem anderen auf diesen an das Leben des Einzelnen gebundenen Umstand aufmerksam zu machen. Denn obgleich das Wissen in seinen erkannten und anerkannten Beständen allgemein und öffentlich ist, ist der Zugang zum Wissen stets an individuelle Voraussetzungen der Aufmerksamkeit, der Erinnerung, des Erlebens und des Interesses gebunden. Damit spielen Erwartungen und Überzeugungen der jeweiligen Personen eine große Rolle, die uns am Ende erkennen lassen, warum der letztlich auch nur individuell wirksame Glaube so eng mit dem Wissen verwebt sein kann. Die sokratische Anfangsfrage des Philosophierens macht uns klar, dass es (so lange man bewusst als Mensch unter Menschen lebt) unmöglich ist, dem Wissen zu entkommen. Denn strenggenommen ist die Behauptung: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, ein Widerspruch in sich. Mindestens dies muss ich ja wissen, wenn ich mein Wissen generell in Abrede stelle. Es ist unmöglich, dass man gar nichts von der Welt und von sich selber weiß. Man müsste zumindest wissen, dass man nichts weiß. Also darf man sagen, dass der Mensch konstitutionell auf das Wissen angewiesen ist. Es gäbe viel zu sagen, um diese fundierende, alle technischen, sozialen, kulturellen und politischen Leistungen tragende Rolle des Wissen anschaulich zu machen, und ein Vortrag reichte nicht aus, die Besonderheiten des Wissens, seinen selbst bereits sozial strukturierten, in allem auf Öffentlichkeit und auf Kommunikation angelegten Charakter vor Augen zu führen. Da ich das in anderen Zusammenhängen wiederholt zur Darstellung gebracht habe, setze ich es einfach voraus, springe mitten hinein in die Erörterung des zweiten Themabegriffs, um den es in dieser Vortragsreihe ja hauptsächlich gehen soll, und setze mit einer unscheinbaren, aber folgenreichen Behauptung ein: Auch die Fähigkeit zu glauben, setzt die Fähigkeit zu wissen voraus. 3. Glauben ist personale Einstellung zum Wissen. Man sagt gewiss nicht zu viel, wenn man die Ansicht vertritt, dass jeder Glaube zunächst einen Mangel an Wissen zu kompensieren sucht. Und, gesetzt, es wäre möglich, zu wissen, wo man bislang nur glauben konnte, brauchte vom Glauben keine Rede mehr zu sein. Freilich wissen wir nur zu genau, dass wir nicht alles wissen können, vor allen nicht von dem, was wir nur zu gern wissen möchten. Die Klügeren haben sich auf die Notwendigkeit des Glaubens so sehr eingestellt, dass ihnen das Angebot, alles wissen zu können, erst gar nicht seriös erscheinen kann. Wer nicht gerade einer atheistischen Kampforganisation wie der Giordano Bruno-Stiftung angehört, kommt gewiss erst gar nicht auf die Idee, sich den Glauben in der Münze des Wissens auszahlen zu lassen. Aber man kann dem Gläubigen immerhin die Frage stellen, ob er denn meint, auch unter den Bedingungen des ewigen Lebens, gleichsam im Himmel, noch glauben zu müssen, oder ob im Angesicht Gottes nicht alles in das klare Licht des Wissens getaucht sein wird. So gefragt, dürfte auch der mit dem größten Ernst in seinem Glauben verwurzelte Mensch das Zugeständnis machen, dass dem Wissen ein Primat eingeräumt werden muss. Also gilt: Nur sofern wir Wissen haben, haben wir auch Glauben, der sich mit der Hoffnung auf eine sachliche Bedeutung, einen persönlichen Wert und seine praktische Wirksamkeit verbindet. Und da es, zumindest unter den Kritikern des Glaubens, niemanden gibt, der nicht überzeugt ist, etwas zu wissen, kann auch niemand bestreiten, dass er selbst den Glauben nötig hat. „Wissen“, so sagt Nietzsche, „ist auf Glauben gegründet“. Also glaubt jeder Mensch, der etwas weiß, und er glaubt ausnahmslos, dass ihm dieses Wissen etwas bedeutet. In diesem Glauben verlässt er sich auf sein Wissen und vertraut darin zugleich sich selbst – zumindest sofern er sein Wissen (suchend, fragend, behauptend) zur Geltung bringen kann. Das aber kann er nur, solange er glaubt, auch von anderen verstanden werden zu können. Damit setzt er auf ein Minimum an sozialer Verbindlichkeit: Er hat die Hoffnung, dass sein Wissen auch anderen etwas bedeutet – zunächst und vor allem als Wissen von Sachverhalten, die auch von anderen erkannt werden können. Darüber hinaus kann das geäußerte Wissen als Selbstaussage begriffen werden, in denen ein Individuum über sich selber Auskunft gibt – selbst dann wenn es nur über belanglose Dinge oder über abstrakte wissenschaftliche Theorien spricht. Diese auf Sachverhalte gestützte Möglichkeit zur Verständigung mit sich und seinesgleichen bietet das Wissen unter allen vorkommenden Fällen. Die Dreiheit aus Selbst, Gemeinschaft und Welt gehört zur Struktur des Wissens, die sich bei allen Menschen findet. Nur die Art, in der sie ihr Vertrauen in das Wissen zum Ausdruck bringen, differiert nach den Kulturen und den Individuen, die sich durch ihr Wissen zu verbinden, aber auch zu unterscheiden suchen. Die basalen Elemente eines jeden Wissens, nämlich das Vertrauen in die zum Gegenstand gemachte Welt, in die Verständlichkeit innerhalb der menschlichen Gemeinschaft sowie in den Wissenden selbst, sind in allen Fällen gegeben. In diesen drei sich allererst im Wissen eröffnenden Dimensionen kommt das Wissen zur Geltung. Es stammt aus einer Anteilnahme an den Dingen, aus dem Bedürfnis nach Mitteilung sowie aus dem Verlangen nach Selbstbestätigung des Wissens. Das Interesse an der Welt, die einem bewusst erst in der Erkenntnis gegenübersteht, an der Gemeinschaft, zu der man selbst gehört, und am Selbst, das man erhalten und entfalten möchte, ist die Triebkraft, aus der die stets gesuchte objektive Sicht der Dinge hervorgeht. Und in allen drei Motivkomplexen wirkt ein Glaube an die Verbindlichkeit im Wissen selbst. Durch die bloße Tatsache des Wissens wird die gleichermaßen kindliche wie vernünftige Erwartung, dass sich im Leben alles zusammenfügt, gestärkt. Wenn sich, wie es im Wissen der Fall ist, alles mit allem in einen begrifflichen Kontext bringen lässt, hat der Wunsch nach Einheit in der Vielfalt einen logischen Anhaltspunkt. So gewinnt das Selbst- und Weltvertrauen einen rationalen Charakter, der durch Einwände aus dem Arsenal des Wissens nicht erschüttert werden kann. Denn wie soll es gehen, dass man das Wissen grundsätzlich durch Wissen entkräftet? In der unvermeidlichen Vielfalt des Wissens, das unablässig seine eigenen Grenzen sprengt, gibt es drei Garanten seines inneren Zusammenhalts, die das Vertrauen in das Wissen stärken: erstens die Einheit des Wissenden mit sich selbst, zweitens seine sachhaltige Verbindung mit seinesgleichen und drittens die begriffliche Verknüpfung mit seiner Welt. Das sind die tragenden Elemente unserer Gewissheit im Wissen. Sie begründen die durch kein Argument abzuschwächende Überzeugung von der Tragfähigkeit des Wissens. Denn jeder Einwand gegen ein Wissen, muss sich, wie gesagt, auf ein Wissen stützen. Damit sehen wir, worin der Glaube an das Wissen, der, genau besehen, ein Glauben im Wissen ist, besteht: nämlich in dem Vertrauen auf die jedes Wissen tragende Verbindung von Ich, Wir und Welt, die uns in der Form eines begrifflich zugänglichen Sachverhalts gegenübersteht. Alles, was wir erkennen (oder auch nur zu erkennen meinen), wird als Einheit nach Art eines Ganzen gefasst. Sie wird im Wissen gewahrt. Da sie sich uns aber nur unter der Bedingung von Mitteilung erschließt, hat sie eine Bedeutung für die Gemeinschaft, in der wir uns über sie verständigen. Auch darauf ist der Glaube im Wissen gegründet. Schließlich hat er darin ein besonderes Gewicht, dass jeder Einzelne in der kommunikativen Anteilnahme überhaupt erst seine eigene Bedeutung erfährt. Den das Wissen zwangsläufig begleitenden Glauben kann man eine epistemische Überzeugung nennen. Der Ausdruck nimmt den griechischen Terminus für Wissen (epistemē) auf, das schon Platon nicht von der auf eine starke Überzeugung gegründeten Meinung (doxa) trennen konnte. Eine epistemische Überzeugung ist die sich im Medium des Wissens ausbildende affektive Anteilnahme am Wissen, genauer: ein intellektuell grundiertes, zugleich aber emotional fundiertes Interesse an der Leistung des Wissens. In der erhofften Klarheit und Sicherheit des Umgangs mit Dingen und Ereignissen wollen wir uns in ein Verhältnis zu unseresgleichen setzen, in welchem wir selbst zur bestmöglichen Wirkung finden. Dieses Streben bleibt an das Wissen gebunden, kommt aber aus den organischen, sozialen, emotionalen, semantischen, logischen und ästhetischen Tiefen unseres Selbst und kann daher als Gefühl erlebt werden. Es ist ein rationales Gefühl, das Einheit in der Unterscheidung sucht, die in jeder Leistung des Wissens liegt und dennoch in jeder Leistung des Wissens überwunden werden soll. Man greift heraus, trennt und grenzt ab, wenn man etwas weiß, sucht sich aber eben darin mit seinesgleichen zu verbinden, indem man sich (im Vorgriff auf ihr Verständnis) auf etwas bezieht, das den Wissenden gemeinsam vor Augen steht. 4. Der Glaube als Gefühl. Trotz der starken Bindung des Glaubens an das Wissen, spricht nichts dagegen, den Glauben als Gefühl zu begreifen. Denn so sehr er sich auf etwas bezieht, das in der Form eines Sachverhalts auf Distanz gebracht werden kann, schließt der Glauben immer auch ein Bestreben ein, mit dem Geglaubten verbunden zu sein. In seinem Glauben möchte der Gläubige dem nahe kommen, an das er glaubt. Der Glaube hat daher nicht nur die Form einer propositionalen Einstellung zu etwas, das als „Ganzes“, als „Grund“ oder „Sinn“, als „Vater“, „Mutter“ oder „heiliger Geist“, als „Erlösung“, „Heil“ oder „ewiges Leben“ von Bedeutung für den Gläubigen ist. Er schließt vielmehr auch den Wunsch, ja, das Verlangen ein, dem Geglaubten zuzugehören, von ihm gehört, beachtet und angenommen zu werden. Am Ende möchte er mit, durch und in seinem Glauben mit dem eins sein, was ihm sein Glaube als das Erste, Wichtigste und Umfassende eröffnet. Während man das Wissen, so sehr es seine Bestätigung auch in der Anwendung oder in der Weitergabe finden mag, als eine eher theoretische Beziehung auf das Gewusste begreifen kann, nähme man dem Glauben seinen Kern und seine Kraft, wenn er nicht das Streben hin zum Geglaubten einschlösse. Darin ist er der Liebe gleich. Glauben ist somit niemals bloße Theorie, sondern immer auch Praxis. Der junge Nietzsche hat es in einem Schulaufsatz, zwei Jahre vor dem Beginn seines später abgebrochenen Theologiestudiums auf den Punkt gebracht: Der Glaube ist eine „Herzensangelegenheit“[1] und hat somit als Gefühl zu gelten. Doch es wäre voreilig, daraus den Schluss zu ziehen, der Glaube habe mit dem Wissen nichts zu tun, sei von ihm abgetrennt oder stehe ihm sogar entgegen. Das Gegenteil ist der Fall: Der Glaube steht in einer besonderen Beziehung zum Wissen, die so eng und unverzichtbar ist, dass man von einer notwendigen Verbindung sprechen muss. Wissen gibt es nur in Verbindung mit dem Glauben, und ein Glaube verliert seinen Sinn, wenn er keinen Bezug zum Wissen hat. Aus Zeitgründen kann ich nur mit einigen wenigen Bemerkungen illustrieren: Erstens: Gefühle gehören zur sinnlichen Selbsterfahrung des Leibes. Während der einzelne sinnliche Eindruck, den die ausgebildeten Rezeptoren vermitteln, zumeist auf eine irgendwie bestimmbare Quelle außerhalb des Körpers oder auf eine lokalisierbare Ursache im ihm bezogen sind, wird im Gefühl der Leib als Ganzer in Erregung versetzt. Im empfundenen Schmerz mag die Ursache eine Schnittwunde oder eine gerissene Sehne sein; auch ein schriller Ton, der ins Trommelfell sticht, erfüllt noch die Bedingung der Lokalisierbarkeit. Aber als Gefühl durchläuft der Schmerz den Körper ganz und er kann das Bewusstsein beherrschen. Das Gefühl des Hungers scheint seinen Ausgangspunkt auch, örtlich bestimmt, im Magen zu haben. Aber selbst wenn es mehrere Sensoren für ihn gäbe, ist unbestreitbar, dass er alle anderen Empfindungen überlagern und das ganze bewusste Erleben beherrschen kann. Wie Hass, Eifersucht, Neid oder Ehrgeiz, so wichtig sie für die Profilierung individueller und kollektiver Leistungen auch sein mögen, die Wahrnehmungsperspektive einschränken und das Handeln zwanghaft machen können, kann jeder an sich selbst erfahren; sollte er es nicht können, sei ihm ein Blick in beliebige Strafprozessakten empfohlen. Über die Scham hingegen wird man in Prozessakten wenig erfahren; mit ihr ist man jedoch seit der Kindheit vertraut. Ihr Auslöser mag in einer bestimmten körperlichen Blöße liegen; aber in ihrer Wirkung ergreift sie den ganzen Menschen, der sich als Person vor allen bloßgestellt sieht. Auch die Furcht braucht man niemandem zu erklären; wenn sie panisch wird, ist nicht selten von außen zu sehen, dass sie die Menschen ganz ergreifen kann. Um zu wissen, dass die durchschnittlich positiv bewerteten Gefühle der Lust Weltbilder aufhellen und ein ganzes Leben umstimmen können, muss ebenfalls niemand erst Akten studieren. Die Lust ist ein Erregungszustand, in den sich der ganze Organismus versetzt. Er macht ihn zu vielem fähig, ganz gleich ob es um große Abenteuer oder kleine Risiken, lebenslange Leidenschaften oder um den behaglichen Rückzug hinter eine Pralinenschachtel geht. Wo ein Gefühl, wie im Fall der Depression, nicht als Dauerzustand erfahren wird, ist seine situative Bedingtheit in der Regel offenkundig. Man weiß damit von ihrer begrenzten Reichweite und ihrer Flüchtigkeit; im Fall einer Ablenkung können sie rasch vergehen. Deshalb gelten die Gefühle als unberechenbar und unbeständig. Dennoch wohnt ihnen eine Dynamik inne, die darauf dringt, augenblicklich alles ihrem Diktat zu unterstellen. Zweitens. Die überbordende Dynamik der Gefühle wird nur deshalb nicht als fortgesetzt bedrohlich empfunden, weil sich der Leib im Gefühl ein ihn insgesamt repräsentierendes Sensorium zulegt, das wir Selbst oder Seele nennen. Es ist das zumindest sprachlich unvermeidbare Selbst, das gleichsam für den Körper fühlt und für ihn über Tun und Lassen zu entscheiden sucht. Dadurch, dass der Mensch auch noch im Fühlen ein Bewusstsein der Differenz zwischen Körper und Seele haben kann, vermag er auf eine gewisse Distanz zu seinen Gefühlen gehen und aus den Verhaltensdispositionen, die sie auf der Ebene des Leibes sind, Optionen für seine Einstellung zu sich selbst – und damit auch für sein bewusstes Handeln – machen. Zusammen mit der Vielfalt, dem Wandel und der Gegensätzlichkeit der Gefühle kann das Selbst tatsächlich Optionen haben und (natürlich nicht unabhängig von Anlass und möglichen Folgen) Direktiven für die Auswahl geben. Das gilt insbesondere in dem nur zu oft erfahrenen Widerstreit verschiedener Gefühle. Der kann nur begrenzt als angenehm oder aufschlussreich erfahren werden und drängt von sich aus auf eine Entscheidung durch das Selbst, dass sich dadurch profilieren, aber auch in seiner Schwäche verlieren kann. In jedem Fall bieten Gefühle Gelegenheit zur Entscheidung, die sich selbst wiederum nicht ohne ein Gefühl, sei es der Entschlossenheit, der Erleichterung oder der Verzweiflung durchsetzen und durchhalten lässt. Widerstreitende Gefühle, das ist eine zentrale Einsicht, vermögen Entscheidungen zu forcieren; im Vorfeld können sie das Einschätzen und Abwägen fördern und im Ergebnis zur Stärkung (oder zur Schwächung) des Selbst beitragen. Charles Darwin hat das am Beispiel der Furcht illustriert:
Darwin hat eine Gefühlstheorie entworfen, die in einer dem heutigen Naturwissenschaftler vermutlich sträflich erscheinenden Weise, die Rolle des Selbst und damit auch der Seele und des Geistes zur Geltung bringt, ohne die evolutionäre Verbindung zwischen Tier und Mensch in Zweifel zu ziehen. Gefühle kommen nach Darwins Ansicht nur unter Bedingungen der Aufmerksamkeit für sich selbst zur Geltung. Self-attention wird nicht erst für die Beschreibung von Gefühlen benötigt. Sie gehört bereits zur lebendigen Wirksamkeit der Gefühle, die durch die Aufmerksamkeit gegenüber sich selbst modifiziert werden können. Besonders deutlich wird das durch Darwins Hinweis auf die Wechselwirkung zwischen Gefühl, Ausdruck und entschiedener Tätigkeit. Aber die Distanzierung mit Hilfe des Selbst (und wie Darwin ganz unbefangen sagen kann: durch den von ihm natürlich mind genannten „Geist“) geht nie so weit, dass einer ohne Gefühle handeln kann. Vielmehr bleiben die Gefühle die erlebten Antriebe unseres Lebens, ohne die wir uns nicht von selbst bewegen könnten. Die Eigenständigkeit des menschlichen Handelns ist immer auch durch Gefühle motiviert. Das gilt selbst für das autonome Handeln aus Gründen reiner Vernunft, wie niemand besser wusste als Immanuel Kant. Wenn er gleichwohl auf den kategorischen Imperativ setzen konnte, dann deshalb, weil sich Gefühle (wenn auch nicht unbegrenzt und nicht in jeder Lage) lenken lassen. Das hat durch das dirigierende Selbst zu geschehen, das sich auf einsichtige Gründe stützen kann. Auf sie ist der kategorische Imperativ bezogen. Drittens: Gefühle sind das psychische Medium, in dem Tiere und Menschen ihr eigenes Verhalten erleben. Sie sind die innere Atmosphäre, ohne die es kein bewusstes Handeln gibt. Den wechselnden Stimmungen entgeht man noch nicht einmal im Traum. Sie sind, so könnte man sagen, die unerlässlichen Modifikationen des Erlebens und darin die unverzichtbaren Moderatoren allen Tuns. Ohne Gefühl kann schlechterdings gar nichts getan, zugelassen oder verhindert werden. Sie geben die Triebfedern zu erkennen, die zu einem Verhalten führen. Abwehr oder Zustimmung beruhen auf Gefühlen; Misserfolge wirken sich in Stimmungen aus, werden durch neue Erwartungen abgefedert, durch Entschuldigungen, Erklärungen, oft auch nur durch den Faktor der Zeit in neue Hoffnungen verwandelt und können allmählich in die Befriedigung übergehen, viel, ausreichend oder wenigstens etwas erfahren zu haben. Die entscheidende Leistung der Gefühle aber tritt im Verhältnis zur Zukunft hervor. Wir wissen, dass sie kommt, zugleich aber ist es das Wissen, dass die von ihr eröffnete Aussicht problematisch macht: Das Wissen könnte uns, wenn wir es wirklich ernstnehmen wollten und nur für den Fall etwas zu tun gedächten, in dem wir über sicheres Wissen verfügen, in augenblickliche Erstarrung verfallen lassen. Doch das geschieht nicht, weil wir Erwartungen und Überzeugungen haben, die eine fortwährende Verlängerung der Gewissheit in die nächste Situation hinein vornehmen. Im bewussten Zustand sind Gefühle immer gegenwärtig. Sie schaffen die Kontinuität des Erlebens, auf der die Durchgängigkeit bewussten Tuns und Lassens beruht. Vornehmlich ist das die Leistung des Vertrauens, zu der sich zwischen Gefühl und Wissen changierende Einstellungen wie Überzeugungen und Meinungen gesellen. Das Vertrauen in den erfahrenen Stand und Gang der Dinge sowie das zugehörige Vertrauen in die eigenen Kräfte sind elementar. Darin bleiben wir immer wie die Kinder, die sich wie selbstverständlich auf das Dasein einlassen, in das sie hineingeboren werden. Das Wissen ist in der Lage, uns einen Teil dieses Vertrauens zu nehmen; doch ohne Selbst- und Weltvertrauen lässt sich nicht leben; schließlich brauchen wir es allein schon, um uns vom Wissen überzeugen zu lassen. Angesichts seiner begrenzten Reichweite, seiner fortgesetzten Zunahme und der Leichtigkeit, mit der man es vergessen kann, ist es alles andere als selbstverständlich, dass man ihm zutraut, die ganze Last des Lebens zu tragen. Viel wichtiger aber ist, dass diese Wertschätzung des Wissens gar nicht allein auf einem Wissen beruht. Die Option für das Wissen ist auf Hoffnungen gegründet. In sie geht die Faszination durch das rein Sachliche und Exakte ein, zu der auch das Gefühl der Sicherheit gehört, das sich sowohl mit dem höheren Radius der Verfügung wie auch mit dem Distanzgewinn durch das Wissen einstellen kann. Und so ist es das Wissen, das ein Vertrauen begründet, das wir wiederum in das Wissen investieren, ohne uns dabei allein auf das Wissen berufen zu können. Wissen löst Gefühle aus, die uns dann für immer neues Wissen, ja, sogar für das Wissen überhaupt votieren lassen, ohne auch nur zu wissen, was das Ganze des Wissens sein könnte. Kurz: Die starke Option für das Wissen beruht auf einem Gefühl, dass wir, wie sich noch zeigen wird, mit vollem Recht als Glauben an das Wissen bezeichnen können. Dieser Glaube, der gelegentlich wie Ahnungs- oder Bedenkenlosigkeit erscheinen mag, bewahrt uns davor, in ständiger Angst vor dem Kommenden leben zu müssen. Dass der Tod auch zu unserer Zukunft gehört, darf dabei nicht vergessen werden. Jeder braucht das Vertrauen in seine eigenen Kräfte, das die Erwartung einschließt, dass sie in die Welt passen, auf die sie gerichtet sind. Es ist mit dem Glauben verbunden, dass uns das Wissen nicht nur einfach nützlich ist, sondern auch als ein integraler Bestandteil der Bildung angesehen werden kann, auf der unsere vernünftige Selbstschätzung beruht. Dieses Vertrauen und dieser Glaube mögen durch noch so viele gute Gründe gerechtfertigt sein, die sich zu einem Teil auch auf Wissen stützen, doch sie sind und bleiben Gefühle. Viertens: Es wäre ein Irrtum zu denken, Gefühle seien nur durch das disponierende Selbst, durch dessen nach innen wie nach außen gerichtete Aufmerksamkeit, sei es durch die Kenntnis von Gefahren oder die Bewertung von Chancen, mit dem Wissen verbunden. Es ist vielmehr so, dass ihnen selbst ein erheblicher epistemischer Gehalt zukommt. Denn Gefühle sind keine Antipoden des Wissens, sondern sie treiben es an, lassen es nicht ruhen, verstärken, belehren und steuern es, nehmen ihm mitunter die Bedeutung und lassen uns gelegentlich sogar damit zufrieden sein. Damit zeigen sie immer auch Wirklichkeiten an, die nicht nur im bewussten Handeln, sondern auch im Wissen zu berücksichtigen sind. Gefühle sind Indikatoren einer naturalen und sozialen Realität, ohne die das auf objektive Verständigung über diese Realität setzende Wissen schlechterdings nicht verzichten kann. Gefühle eröffnen dem Selbst einen Zugang zu den Triebenergien des Leibes. Sie geben etwas zu erkennen, ohne dabei an die Leistungen des (deiktischen) Zeigens gebunden zu sein. Sie sind auch nicht auf symbolische Zeichen oder Begriffe angewiesen. Vielmehr sind sie selbst das Mittel, durch das ich Zugang zu meinen Schwächen und Stärken erlange. Vor aller medizinischen Diagnose und unabhängig von möglichen Leistungstests, geben sie mir Aufschluss über meine Befindlichkeit; überdies machen sie mir Dispositionen gegenwärtig, unter denen das Verhalten steht. Man kann sie daher auch korporal fundierte und psychisch validierte Einstellungen nennen. Fünftens: Gefühle sind nicht nur dem zugänglich, der sie hat. Schon in ihnen ist das Bewusstsein offen für Einsicht und Nachvollzug durch seinesgleichen. So unwahrscheinlich es angesichts der Subjektivität und Intimität vieler Gefühle auch klingen mag: Zu den Gefühlen gehört eine in ihrer Natur liegende Offenheit, die im Wissen in die Öffentlichkeit der gewussten und gedachten Gehalte übergeht. Das ändert nichts an der Zivilisationen erzeugenden Disziplin des Menschen, Gefühle auch verheimlichen können. Die ursprüngliche Mitteilbarkeit der Gefühle, die im begrifflichen Charakter des Wissens ins Universelle ausgreift, wird durch die prinzipielle Kommunikabilität der Emotionen nur bestätigt. Darauf ist der Glaube wie kein anderes Gefühl gegründet. Und er ist das insbesondere dann, wenn er sich auf etwas bezieht, von dem er annehmen kann, dass er sich auf etwas richtet, das allen gleichermaßen bewusst sein kann. Eben das ist beim religiösen Glauben der Fall, der auch einem letzten Wirkungsmoment des Glaubens eine besondere Bedeutung gibt: Im Gefühl habe ich nicht nur diese oder jene Vorstellungen, sondern ich befinde mich in einem besonderen Zustand, der mich derart in Anspruch nimmt, dass ich selbst die Realität bin, die sich bewegt. Wenn das Wissen, das in seiner epistemischen Stellung darauf angelegt ist, mich zu bewegen oder abzuwarten, dies nicht vermag, ist es tot. „Totes Wissen“ ist eines, an das niemand mehr glaubt und das keinen mehr bewegt. Um als Wissen wirksam zu sein, muss es eine Überzeugung hinter sich haben. Es muss mit einem Glauben verbunden sein. 5. Vom Selbst- und Weltvertrauen zum Glauben an Gott. Nach der kleinen Phänomenologie des Gefühls bleibt nur noch die Beantwortung der Frage, mit der Sie vermutlich hier her gekommen sind: Was bedeutet die Analyse für den Glauben an Gott? Nur um eine Antwort auf diese Frage zu finden, unternehme ich die inzwischen auf den Umfang vor mindestens fünf weiteren Vorträgen angewachsenen Vorüberlegungen. Die will ich Ihnen heute Abend nicht mehr zumuten. Stattdessen wage ich es, auch auf die Gefahr hin, unverständlich zu sein, eine vorläufige Antwort zu umreißen: Glauben gibt es nicht nur im religiösen Kontext. Vielmehr trägt er unser Selbst- und Weltverständnis in allen Lagen, in denen es um das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Daseins, in die Festigkeit menschlicher Beziehungen und vor allem um die Erreichbarkeit der uns wichtigen Ziele geht. Wer immer seine Hoffnung auf Frieden, auf die Zukunft der Kinder, den Vorrang des Wissens, den Wert der Bildung, den Bestand der Kultur oder gar auf einen guten Ausgang der Geschichte richtet, setzt auf die Tragfähigkeit des Sinns, in dem er sein eigenes Leben versteht. Es gibt viele Versatzstücke des Wissens, die eine solche Sinnerwartung nicht unplausibel erscheinen lassen. Es gibt vor allem den Schluss von einer bis zu diesem Augenblick – zumindest für mich selbst – nicht vollkommen katastrophisch verlaufenden Vergangenheit auf ein nicht mit Sicherheit auszuschließendes Gelingen in der Zukunft. Aber verlässliches Wissen über die Zukunft gibt es nicht. Woraus also schöpfen wir das Vertrauen in das Kommende? Zunächst kann man nur sagen: Aus einem Glauben. Alle jene, die nicht schon durch ihre seelische Verfassung, durch ihre Erziehung, durch ihre nicht bezweifelte Überzeugung – fundiert durch die eindrucksvollen kulturellen Traditionen und bereichert durch die großen Lehrbestände der Glaubensgemeinschaften, ganz gleich ob sie sich vom Alten oder Neuen Testament, vom Koran, den Reden Buddhas und der Weisheit eines Konfuzius oder eines Laotse herleiten – also alle jene, die nicht bereits sicher in ihrem Glauben leben, haben sich einzugestehen, dass auch sie nicht ohne Glauben sind. In dem, was immer sie tun, worin sie ernstgenommen werden wollen und was ihnen über den unmittelbar erreichbaren Handlungseffekt hinaus wichtig ist, sind sie auf einen Sinn bezogen, der den Sinn ihrer zahllosen Einzelaktivitäten trägt. Gesetzt, diese Individuen nehmen ihr Leben ernst. Gesetzt, das Leben zwingt sie, es nicht länger so leicht zu nehmen, wie sie es vielleicht bisher genommen haben und wie sie es am liebsten weiterhin gerne nähmen. Gesetzt, sie sehen in die fragenden Augen eines Kindes, eines notleidenden oder schwerkranken Menschen. Gesetzt, sie haben Verantwortung für Viele übernommen und fragen sich, ob sie sich ihr entziehen können: In allen diesen Fällen können sie ausweichen und die Antwort offen lassen. Denn niemand kann gezwungen werden, sich vom Sinn seines Tuns und vom äußersten Verpflichtungsgrund seines Lebens Rechenschaft zu geben – so wie man auch niemanden allein durch gute Gründe nötigen kann, am Leben zu bleiben. Und wir sollten uns auch hüten, jemanden zu blamieren, der sowohl das eine wie auch das andere nicht vermag. Alles kommt hier auf den eigenen Anspruch, die individuelle Freiheit und die persönliche Verantwortung an. Wo aber der Ernst einer Frage gegeben ist, kann man auch an der Tatsache nicht vorbei, dass man sich, indem man ernsthaft lebt, immer schon eine Antwort gegeben hat. Ernsthaft heißt ja nicht, dass einer immer nur mit einer verfinsterten Miene herumläuft, sondern dass er in etwas, wofür er gute Gründe hat, Erfolg zu haben sucht, dass er produktiv, anerkannt, vielleicht sogar beliebt, in jedem Fall geachtet und, wenn irgend möglich, auch geliebt sein möchte. Und in alledem liegt die praktische Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und wer sie sich bewusst zu geben versucht, muss zugestehen, dass es zwar seine Antwort ist, die auf seiner Teilnahme am Leben beruht, die aber Bedingungen untersteht, über die er selbst nur zu einem geringen Teil verfügt. Und da diese Bedingungen sich selbst mit größter Akribie nicht zureichend aus dem durch Wissen zu ermittelnden Kontext der Natur, der Kultur, der Gesellschaft und der Geschichte entnehmen lassen, können sie nur im Ganzen der zahllosen Ganzheiten gegeben sein, in denen wir mit größter Selbstverständlichkeit leben. Die erste und wichtigste dieser Ganzheiten ist die unseres Leibes, von dem ich zeigen kann, dass er schon auf der organischen Stufe den Sinn erzeugt, der sich dann unter den Bedingungen sozialer Mitteilung, emotionaler Korrespondenz, semantischer Bedeutung und hermeneutischen Sinnverstehens stufenweise entfaltet und damit auf das Ganze anderer lebendiger Wesen, sozialer Einheiten, logischer Bedeutung, gefühlter Beziehungen und als vernünftig begriffener Kontexte nicht nur auf das Ganze der Welt, sondern auch noch auf ihren möglichen Grund sowie ihren möglichen Zweck ausgreift. Was aber auf diese Weise zu einer nicht nur an- und hingenommenen, sondern in Konsequenz der eigenen Tätigkeit auch bejahten Einheit kommt, das nenne ich den Sinn des Sinns, weil er die Bedingung für alle Sinnbezüge ist, in denen sich mein in bestem Wissen und Gewissen mehr oder weniger gut bewältigtes Leben vollzieht. So wie ich an den Sinn einzelner Handlungsabsichten nur glauben kann, so kann ich auch an den Sinn, der diesen Sinn möglich macht, nur glauben. Aber spätestens in diesem letzten Schritt ist aus dem mein bewusstes Leben ohnehin tragenden Glauben ein religiöser Glaube geworden. Er ist darauf gerichtet, was ich das Göttliche nenne. In seiner umfassenden Leistung scheint es mir unendlich fern zu stehen; aber dadurch, dass es von mir nur geglaubt werden kann, wenn es meinen Handlungs- und Daseinssinn tatsächlich von innen her trägt, steht es mir ebenso nahe wie ich mir selbst.[3] Das Göttliche, so steht es bei Platon, ist das, was meiner Seele am nächsten ist. „Nach den Göttern“, so heißt die Stelle wörtlich übersetzt, „ist die Seele das göttlichste, da sie der allereigenste Besitz ist.“[4] Göttlich ist das, was uns im Vollbesitz unserer Kräfte, so nahe kommt, wie uns nur etwas kommen kann, das wir lieben. Anmerkungen
|
||
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/90/vg1.htm
|
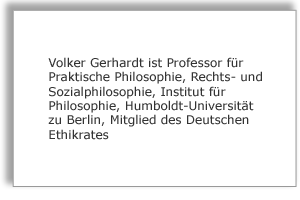 1. Werbung und Abschreckung. Der Witz jener schon ein wenig betagten Werbung eines schwedischen Möbelhauses: „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ beruhte auf einer Alternative, die in Wahrheit keine war und keine ist – und jeder, der den Reklamespruch las, wusste das auch:
1. Werbung und Abschreckung. Der Witz jener schon ein wenig betagten Werbung eines schwedischen Möbelhauses: „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ beruhte auf einer Alternative, die in Wahrheit keine war und keine ist – und jeder, der den Reklamespruch las, wusste das auch: Gerhardt, Volker (2014):
Gerhardt, Volker (2014):