
Kirche und Theologie |
Das Abendmahl der AktenordnerBeobachtungen zum Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung
1.Wer die vermeintlich unschuldige Frage danach stellt, wer denn eigentlich eine Kirche leitet, der muss sich auf eine schwierige Detektivarbeit gefasst machen. Am Ende wird er überrascht vor einer komplizierten Karte stehen. Sie öffnet den Blick auf eine ganze Reihe von Quellen, darunter auch unterirdischen, die dem Blick des Beobachters und der Öffentlichkeit verborgen sind.
Man sollte meinen, dass die Theologie als Wissenschaft bei der Ausübung kirchenleitender Ämter eine Hauptrolle spielt, dass Oberkirchenräte und Synoden sich von theologischen Fakultäten, von Theologen und Experten aus der kirchlichen Praxis beraten lassen. Aber der Blick auf die kirchliche Landschaft zeigt leider, dass hier noch ganz andere Quellen wirksam sind, die langsam, aber sicher die Theologie aus ihrer Orientierungsfunktion verdrängen. Das ist ein merkwürdiger Vorgang, und ihm gelten die Beobachtungen des nachfolgenden Essays. Er erhebt nicht den Anspruch, das Thema bis ins letzte Detail zu vermessen. Vielmehr sollen eine Reihe von Beobachtungen aneinandergereiht werden, welche die Dringlichkeit des Themas verdeutlichen. Blickt man zunächst einmal auf das Verhältnis von anderen Wissenschaften zum Gegenstand ihrer jeweiligen Praxis, so zeigt sich zum Beispiel in der Medizin, dass Krankenhäuser, Arztpraxen, Rehabilitationseinrichtungen, pharmazeutische Unternehmen und medizinische Fakultäten ausnehmend eng zusammenarbeiten. Nicht alle dieser Einrichtungen verfolgen dasselbe Interesse, und die Unternehmen der Pharma-Industrie sind schon oft dafür kritisiert worden, dass sie sich eher am eigenen Umsatz als am Wohl der Patienten orientiert haben. Dennoch hebt der Missbrauch einiger weniger Unternehmen nicht das Ziel einer möglichst engen Verknüpfung zwischen Praxis und Theorie, Lehre und Therapie, einer möglichst engen Kooperation zwischen medizinischen Fakultäten und Krankenhäusern auf. Auch im Recht achtet man auf die gegenseitige Durchdringung von Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Auf den Richterstühlen der oberen Gerichte, angefangen beim Bundesverfassungsgericht sind immer wieder Lehrstuhlinhaber öffentlichen Rechts zu finden, so dass die Kooperation zwischen Rechtswissenschaft und –praxis schon in der Personalunion von Richtern und Dozenten ihren Ausdruck findet. Schon schwieriger wird das Verhältnis von Wissenschaft, Fakultät und Praxis in der Ökonomie, wie sich leicht am Institut der Wirtschaftsweisen feststellen lässt. Die Wirtschaftsweisen, deren Aufgabe es ist, jährlich ein prognostisches Gutachten zum Zustand der Ökonomie zu erstellen, kommen in der Regel von den Universitäten und sind vor allem bewandert in der Ausarbeitung volkswirtschaftlicher Theorien. Doch müssen sie sich für ihre Jahresgutachten oft deutliche Kritik gefallen lassen, die häufig in Vorwürfe der Praxisferne und der Theorielastigkeit münden. Vollends gestört erscheint das Verhältnis von Politikwissenschaften und Politik, beides fällt vollständig auseinander. Wer ersteres mit heißem Bemühn studiert hat, qualifiziert sich noch lange nicht zum Bundestagsabgeordneten oder gar Minister. Nun kann man mit Recht einwenden, dass eine solche Bestimmung des Verhältnisses von Studienfach und Praxis ganz normal sei. Denn ein Studium welcher Fachrichtung auch immer befähigt den Absolventen gerade nicht für eine bestimmte Praxis, sondern „nur“ zur systematischen Reflexion dieser Praxis. Dennoch kommt Unbehagen auf, wenn beides zu sehr auseinanderfällt. Was nun die evangelische Kirche und Theologie betrifft, so geht die Gleichung zwischen examinierten, auslegungsversierten Theologen und guten, vertrauenswürdigen Pfarrern schon lange nicht mehr auf. Die Ausbildungsreferate haben Verdacht geschöpft und geben sich mit dem bestandenen zweiten Examen, also der wissenschaftlichen Ausbildung nicht mehr zufrieden. Sie haben aus der Wirtschaft sogenannte assessment center übernommen, um die Eignung von angehenden Pfarrern zu testen, offensichtlich weil man dem 1. und 2. Examen als wissenschaftlicher Qualifikation nicht mehr traut. Und diese Beobachtung gilt nicht nur beim Einstieg ins Pfarramt, sondern auch für die Spitze der Hierarchie: Nach meinem Eindruck findet man gegenwärtig lange nicht mehr so viele Lehrstuhlinhaber unter den Bewerbern für ein Bischofsamt wie das noch vor zwei oder drei Jahrzehnten der Fall war. Das Thema hat noch einen zweiten Aspekt, der über Kirche und Theologie hinausreicht, sie aber in derselben Weise betrifft. Ich meine die öffentliche Rolle von Intellektuellen, die sich in den Medien zu Wort melden, wenn im Feuilleton oder in der Politik wichtige Debatten geführt werden, die viele Menschen beschäftigen. In solchen Debatten greifen immer weniger Intellektuelle ein, die zugleich an der Universität als akademische Lehrer tätig sind. In der Aufgabe des Wirtschaftsweisen ist diese Rolle ja sozusagen institutionalisiert.
Ein ähnlicher Bedeutungsverlust ist seit einigen Jahren für die evangelischen Kirchen selbst zu beobachten. Nicht wenige nehmen diesen Prozess mit großer Sorge wahr. Wenn sich die evangelische Kirche, vor allen Dingen die EKD plötzlich im grellen Licht öffentlicher Aufmerksamkeit wiederfindet wie zum Beispiel im Sommer 2013, als plötzlich Gemeindeglieder, Theologen und Journalisten über das auch von den Befürwortern für theologisch ganz unzureichend gehaltene Familienpapier debattierten, dann wundert man sich, dass diejenigen, die doch durch das Konzept der öffentlichen Theologie[1], durch ausführliche Denkschriften über den Öffentlichkeitscharakter des Glaubens, der Kirche und des damit verbundenen Handelns auf solche Debatten vorbereitet sein sollten, hilflos in der Defensive verharren und die Blitz- und Donnerschläge öffentlicher Kritik lieber ertragen als dem aktiv und offensiv entgegenzutreten. Zwischen öffentlicher Theologie und Öffentlichkeit hat offensichtlich ein Entfremdungsprozess eingesetzt, dem bisher noch niemand mit Gegenmaßnahmen steuernd begegnet. Und die Diagnose ist eine doppelte: Im Dreieck zwischen Kirche (und ihrer Verwaltung), wissenschaftlicher Theologie und Öffentlichkeit herrscht ein zunehmendes Defizit an öffentlicher theologischer Reflexion und Debatte. Ein ähnlicher Prozess findet – zweitens - in den Kirchenverwaltungen und –leitungen statt: Man traut der eigenen orientierenden Leitwissenschaft nicht mehr. Stattdessen verlegen sich Kirchenleitungen auf hilflose Strategien der Kompensation theologischer Orientierungslosigkeit. Wer die theologische Reflexion suspendiert, begnügt sich mit dem Erregen von Aufmerksamkeit. Marketing tritt an die Stelle von Theologie. Und im Grunde tritt Religionsverwaltung an die Stelle von Religion. Mit Schleiermacher[2], der Theologie für den Inbegriff derjenigen Wissenschaft hielt, die es erst ermöglicht, praktisch Kirche zu leiten, hat das nichts mehr zu tun. 2.Was das Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung angeht, so kommt der Münchener Sozialethiker Friedrich Wilhelm Graf in seiner Abschiedsvorlesung zu einem ernüchternden Ergebnis. Er schreibt, dass „die beiden großen Kirchen im Lande ihre internen Entscheidungsprozesse eher theologiefern und nicht selten auch reflexionsresistent gestalten: Man weiß, was man will, ist an Machterhalt, Einflusssicherung und Weltbild-Marketing interessiert, interveniert in politische Prozesse und legitimiert all dies dadurch, dass man sekundär ein paar mehr oder minder triviale religiöse Formeln als sog. ‚theologische Begründung‘ in Anspruch nimmt. Denn der angemahnte Dialog wird ja bei den entsprechenden Konsultationen zwischen EKD und wissenschaftlicher Theologie durchaus gepflegt und findet seinen Ausdruck in den entsprechenden Texten[4]. Kirchenverwaltungen verstehen sich mit Fakultätsverwaltungen. Dass man sich auf institutioneller Ebene verständigt und gegenseitige Interessen im universitären wie gesellschaftspolitischen Bereich wahrt bzw. verstärkt, widerlegt allerdings nicht den Eindruck, dass sich die Zahl der Konfliktfelder vergrößert hat. In der Vergangenheit führten Kirchenleitungen und Theologie erbitterte Auseinandersetzungen um die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, um die In-vitro-Fertilisation und die Menschenwürde, um die Bibel in gerechter Sprache, auch um die Friedensethik und die Drohung mit Massenvernichtungswaffen. Heute sind es andere Kontroversen, die im Dialog zwischen Kirchenleitungen und Theologie strittig geworden sind. Dazu zählen das kommende Reformationsjubiläum im Jahr 2017, Fragen der Familienpolitik und der Homosexualität, die andauernde Auseinandersetzung um den unter dem Titel "Kirche der Freiheit" aus der EKD angestoßenen Reformprozess, im Zusammenhang damit die gegenwärtig beliebten Milieu-Untersuchungen und anderes mehr. Diese sollen in der Perspektive des schleppenden und behäbigen, manchmal abgerissenen Dialogs zwischen Kirchenleitung und wissenschaftlicher Theologie betrachtet werden. 3.
Dieses berechtigte Anliegen haben die beiden Reformationshistoriker Thomas Kaufmann und Heinz Schilling[6] heftig kritisiert. Sie warfen den Autoren des Papiers vor, unhistorisch zu argumentieren, die Person Luthers zu stark zu betonen und neuere Erkenntnisse der reformationshistorischen Forschung nicht zu berücksichtigen. Insgesamt sahen beide Autoren die geschichtlichen Umstände der Reformation den ideenpolitischen Interessen der evangelischen Amtskirche geopfert. In diesem Konflikt verbirgt sich nun eine außerordentlich spannende Kontroverse, jenseits der üblichen personalstrategischen Kränkungen und auch jenseits der Kränkung, dass in einem Dokument bestimmte ökumenische Fortschritte nicht erwähnt werden.[7] Denn vor diesem Problem stehen alle Institutionen, die ein historisches Ereignis oder Dokument als für die Gegenwart relevant bezeichnen. So ist zu unterscheiden, welche politischen und juristischen Intentionen die Founding Fathers mit der amerikanischen Verfassung von 1787 verfolgten und wie diese Verfassung in den aktuellen juristischen Kontroversen der USA auszulegen ist. Dieselbe Unterscheidung ist, mit geringerem historischen Abstand, für das Grundgesetz und seine Auslegung anzuwenden – und eben auch für die Reformation, unabhängig von den Unterschieden zwischen juristischer und theologischer Hermeneutik. Dieselbe Unterscheidung gilt für die Bibel selbst, die ja bekanntlich ein „garstig breiter Graben“ von der Gegenwart trennt. Wieso sollte sich das bei der Reformation und Martin Luther anders verhalten? Mit der historischen Einordnung, der Bestimmung von Ursachen, dem Nachdenken über die Wirkungen der Reformation ist es nicht getan. Insofern verfolgt das Dokument über Rechtfertigung und Freiheit eine legitime Absicht. Aber die Forderung nach einer historischen Kontextualisierung und einer Hermeneutik reformatorischer Grundentscheidungen schließen sich ja nicht aus. Das gilt es in beide Richtungen zu sagen.
Wer sich für die Reformation interessiert und ihr Jubiläum feiern will, stößt schnellt auf die Alltagsdokumente der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts und kann dort faszinierende Entdeckungen über die Vielfalt der Reformation, ihrer Theologien und über ihr Einsickern in den alltäglichen Glauben und die Frömmigkeitspraxis der Menschen machen. Diese Kirchenordnungen liegen in einer hervorragenden und umfassenden, von Emil Sehling begründeten Edition[8] vor. Sie ist nach Regionen, vom Elsass über Siebenbürgen bis Mecklenburg geordnet und nach über hundert Jahren leider immer noch nicht abgeschlossen. Wer in diesen Bänden liest, der sieht schnell, wie tief die Reformation in das alltägliche Glaubensleben der Menschen eingriff und dieses veränderte, ohne dass in Visitationsbescheiden, fürstlichen Anordnungen und gräflichen Erlassen die großen theologischen Fragen der Reformatoren vom freien Willen über die Rechtsfertigungslehre bis zur Abendmahlstheologie diskutiert wurden. Ein Beispiel mag andeuten, was gemeint ist: An den evangelischen Glocken- und Läute-Ordnungen des 16. Jahrhunderts ist abzulesen, dass die Reformatoren das Läuten vor allem als Einladung zum Gottesdienst verstanden. Die abergläubische Wirkung des Läutens gegen Blitzeinschlag und Hagel, das sogenannte Wetterläuten, lehnten sie ab. Andere Formen des Gebetsläutens (Angelusläuten, Türkenläuten, Läuten vor der Beerdigung) interpretierten sie neu. In solchen kleinen Details des Alltags werden die reformatorischen Veränderungen genauso deutlich wie in den großen theologischen Disputationen von Heidelberg über Leipzig bis Marburg.
Insofern würde man sich wünschen, dass die Kontroverse zwischen den Reformationshistorikern im emphatischen Sinne und den Theologen der Reformation auch richtig ausgetragen wird, beispielsweise nach dem in der Reformation beliebten Modell der Disputation, ohne diese Debatte sofort auf Zustimmung oder Ablehnung der Kirchenpolitik der EKD abzubilden. Wer nach dem letzteren Schema denkt, der versucht, die Theologie mit Hilfe der Kirchenpolitik zu steuern. Und die vergangenen Jahre, es sei erinnert an die Debatten über Menschenwürde, Embryonenschutz, In-vitro-Fertilisation, Homosexualität und Familie, haben leider gezeigt, dass der amtlich organisierte Protestantismus von diesem Mittel viel zu häufig Gebrauch gemacht und damit offene Debatten verhindert hat. Das geschah zum einen auf der personalpolitischen Ebene (Vortragseinladungen, Besetzung von Kammern etc.). Eingeweihte kennen die Namen der klerikalen spin doctors, der Spezialisten für Besetzungs- und Berufungspolitik ganz genau – und schweigen. Aber man staunt ja auch - zum andern - immer, wie viele Adhoc-Kommissionen, Steuerungs- und Arbeitsgruppen neben den offiziellen „Kammern“ wie Mario Götze vor dem argentinischen Tor urplötzlich aus der Tiefe des klerikal-politischen Komplexes auftauchen, um dann neben Synoden, Bischöfen und Hierarchien ihre eigene Version des Protestantismus abzuliefern. Adhoc-Kommissionen erscheinen als Spezialisten für protestantische Eigentore – wie zuletzt an der Orientierungshilfe für Familien zu sehen war. Es hilft ja alles nichts: Was den Protestantismus von der katholischen Kirche unterscheidet, ist seine produktive Vielfalt, die im Übrigen, wie an den von Sehling herausgegebenen Reformationsordnungen zu lernen wäre, schon zu Zeiten der Reformation bestand. Die kirchenpolitische Strategie, diese Vielfalt aus Gründen der Machterhaltung und –erweiterung sowie der Zentralisierung zu kupieren, wirkt sich auf die Dauer verheerend aus. Wie immer man das dreht und wendet, die theologische Spannung und die Notwendigkeit einer Debatte entstehen aus einer doppelten Erkenntnis. Die geschichtswissenschaftliche Forderung zielt auf Einordnung der Reformation in ihren historischen Kontext, jenseits individueller, auf den Reformator Martin Luther konzentrierter und theologiegeschichtlicher Engführungen: Es ist nur eine Perspektive unter vielen, die Reformation aus ihren theologischen Grundentscheidungen zu erklären. Die aktuelle theologische Forderung zielt auf die identitätspolitische Frage nach der bleibenden Bedeutung der Reformation für die Gegenwart und den Protestantismus. Diese Frage ist genauso wichtig wie die historische, und sie kann nicht mit dem Verweis auf bloße Traditionsbewahrung beantwortet werden. Und ein Reformationsjubiläum wäre eine gute Gelegenheit, diese Frage selbstkritisch und produktiv, nicht ängstlich und auf Bestandssicherung bedacht, neu zu stellen und zu diskutieren. Dafür braucht es Freimut (im Neuen Testament parrhesia). Bürokratie jedoch leitet nicht zu Freimut an, sondern zur Gesetzlichkeit: Das (klerikale) Handeln wird am Erfüllen von Vorschriften und Verordnungen orientiert, auch dann wenn es in der Verkleidung moderner Management-Methoden daherkommt. Man entkommt dem sturen Vorschriftengehorsam leider auch dann nicht, wenn die Regeln in Wirtschaftsenglisch (balanced scorecard) oder Seemannsdeutsch (Kirchenkompass) formuliert werden. Ein solcher bürokratischer Protestantismus kann aber langfristig nicht als lebensfähig gelten. Der richtige Ort für eine solche freimütige Diskussion der aktuellen Bedeutung der Reformation wären nicht die theologischen Fakultäten, selbstverständlich auch nicht die Konsistorien, sondern die evangelischen Akademien und der Kirchentag, beides intermediäre Orte - wenn diese ihre Rolle als Foren bleibend hoher theologischer Diskussionskultur noch erfüllen würden. Die Reformationsdebatte zwischen Theologie, Geschichtswissenschaften wäre jedenfalls den Versuch einer Debatte wert, jenseits der starren Gegenüberstellung, auf die sich Historiker und EKD-Theologen eingeschossen haben. Immerhin haben sich nun Theologen und Historiker des Reformationsjubiläums angenommen. Die von der EKD ernannte Botschafterin dieses Jubiläums schreibt derweil Kolumnen in einer Boulevardzeitung. 4.Die gegenwärtige Debatte um das Reformationsjubiläum zeigt: Die evangelische Kirche lässt es an Gewissheit über ihre eigene Geschichte missen. Sie kämpft mit Identitätsproblemen, die angesichts ihres Alters von 500 Jahren erstaunen und die man psychologisch eher in der Adoleszenzphase verorten würde. In diesem Alter sollte man die Scheinselbständigkeit der Entwicklungsjahre überwunden haben. Das wäre nun alles nicht so schlimm, wenn sich nicht gerade aus der Identitätsproblematik eine massive Steuerungsproblematik entwickeln würde. Steuerungsprobleme, im Jargon der Politologen: Probleme der governance, erleben nicht nur die Landeskirchen. Es kennzeichnet einen freiheitlichen Verfassungsstaat, dass er ein komplexes System der „checks and balances“ entwickelt, in dem die Steuerungsinstitutionen von Exekutive, Legislative und Judikative sich wechselseitig austarieren. Man kontrolliert sich gegenseitig, um die eigene Macht zu beschränken und keine Schlagseite der Staatsgewalt zu erzeugen. Aber auch in einer Demokratie stellt sich die Frage: Wer trifft für ein Problem, wenn es in allen Steuerungsinstanzen erschöpfend diskutiert wurde, die letzte, die endgültige Entscheidung? In der amerikanischen Verfassungstheorie und in der entsprechenden politologischen Diskussion ist das als die Alternative zwischen aktivistischem Richterrecht des Supreme Court und den legislativen Mehrheitsentscheidungen des Kongresses diskutiert worden. In der Bundesrepublik wird nach dem Selbstverständnis des Bundesverfassungsgerichts gefragt. Dieses versteht sich als Hüterin des Grundgesetzes, welches Entscheidungen des Parlaments immer wieder als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar zurückweist. Die Grundrechte – und das Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheidet - stehen somit letztendlich höher als die Entscheidungen der parlamentarischen (und damit auch der wählenden) Mehrheit. Parteien, die mit Regierungs- und Parlamentsentscheidungen nicht einverstanden waren, haben deswegen in der Vergangenheit immer wieder das Bundesverfassungsgericht angerufen, um parlamentarische Entscheidungen überprüfen zu lassen. Letztlich steht damit das Urteil des Gerichts höher als die parlamentarische Beschlussfassung. Die Debatte darüber, ob das so richtig und angemessen ist, ist noch nicht geendet. Der Blick auf Politik und Recht leitet auch den Blick auf die kirchlichen Verhältnisse an. Die normativen Dokumente der evangelischen Kirchen verweisen stets auf den reformatorischen Grundsatz der Bibel als oberstem Kriterium von allen Entscheidungen. Darüber sofort mehr. De facto treffen bestimmte kirchliche Institutionen eine Entscheidung darüber, ob eine Entscheidung „schriftgemäß“ ist oder nicht. Als Kandidaten für das kirchliche Steuerruder kommen verschiedene Ämter und Institutionen in Betracht: die Synode, das Konsistorium, davon unterschieden die Rechtsabteilung des Oberkirchenrats sowie die Bischöfe. Der deutsche Protestantismus hat nach dem Zweiten Weltkrieg gut daran getan, die Forderung des reformierten Christen Gustav Heinemann und anderer aufzunehmen, dem synodalen Prinzip in deutschen Landeskirchen stärkere Geltung zu verschaffen. Die Synoden bilden im gelungenen Fall ein wirksames Gegengewicht zu den bürokratischen Entscheidungen der Kollegien. Sie können Initiativen ergreifen, Reformprogramme auf den Weg bringen, kommen aber in der Regel dort an ihre Grenzen, wo sie zwischen Synode und Konsistorium umstrittene Probleme lösen müssen oder wo eine Mehrheitsentscheidung nicht dem entspricht, was als biblisch geboten erscheint, worüber jedoch auch unter Theologen keineswegs Einigkeit herrschen muss. Das Demokratieprinzip wird durch das Schriftprinzip relativiert.
Die Konsistorien verlieren sich in der Regel in endlosen Programmen, Verordnungen und Projekten. In ihrer Orientierung an Vorschriften und Beschlüssen neigen sie zur bürokratischen Gesetzlichkeit. Alle neuen Ideen sind beständig in der Gefahr, zu Tode diskutiert zu werden. Das Gegenüber von Referats- und Projektorientierung erhöht zusätzlich den bürokratischen Aufwand. Trotzdem haben sich die Konsistorien durch ihren Vorsprung an aktuellem kirchenpolitischen Herrschaftswissen und durch eine subtil arrangierte Haushaltshoheit einen Vorsprung gegenüber den anderen Leitungsinstitutionen einer Kirche verschaffen. Dieser kirchlich-strukturpolitische Vorgang kann in seinen Wirkungen und Nebenwirkungen von Ehrenamtlichen und Synodalen nur schwer durchschaut werden.
Wer auf die vielen Verordnungen einen genaueren Blick wirft, der entdeckt schnell, dass an den entscheidenden Schnittstellen stets butterweiche juristische Formulierungen wie "Ermessen" oder "Abwägen" oder „Benehmen“ stehen. Solche Formulierungen führen den Doppelcharakter des Kirchenrechts sehr schön vor Augen: Die meisten Entscheidungen können ja gar nicht in einem strikten Sinne und prinzipiell "geregelt" werden, sie benötigen eine Abwägung von Argumenten, eine Anwendung auf eine konkrete Situation vor Ort, welche Älteste und Pfarrer bei ihren Sitzungen im Presbyterium treffen. Welchen Sinn haben aber dann solche Verordnungen? Die Antwort ist ganz einfach: Sie öffnen der konsistorialen Rechtsabteilung eine Hintertür, um im Konfliktfall der Auslegung willkürlich (dh. entsprechend den oberkirchenrätlichen Interessen) eine bestimmte, und das heißt immer die eigene Auslegung für verbindlich zu erklären. So entsteht auf dem Verordnungswege eine Nebenkirchenleitung, welche sich an den synodalen und konsistorialen Entscheidungsträgern vorbei, aber auch vorbei an jeglichen theologischen Erwägungen vorbei als opake Kirchenherrschaft etabliert. Dass in der übergroßen Menge der Verordnungen und Vorschriften kein Mensch den Überblick behalten kann, sich Verordnungen auch gegenseitig widersprechen, muss als List der Vernunft gewertet werden, welche im entscheidenden Augenblick dann doch die kirchenrechtliche Bürokratie übertrumpft. Die Verpflichtung des Kirchenrechts auf biblische Grundlagen, welche die Grundordnungen deutscher Landeskirchen durchgängig aufgenommen haben, verkommt zu kaschierender, wirkungsloser Präambellyrik, der keine Wirklichkeit entspricht. Und die Bischöfe? Sehe ich richtig, so ist es in den letzten Jahren aus der Mode gekommen, Theologieprofessoren als Kandidaten für Bischofsämter aufzustellen, sieht man einmal vom Gegenbeispiel Bayerns ab. Dieser Sachverhalt erscheint als symptomatisch, erscheint doch gerade das Bischofsamt mit all seinen öffentlichen und innerkirchlichen Wirkungsmöglichkeiten als dasjenige Forum, mit dessen Hilfe der Inhaber des Amtes theologische Impulse setzen könnte, vorausgesetzt der Bischof ist dazu als Theologe auch in der Lage, und er verrennt sich nicht als beflissener, naiver Stichwortgeber politischer Debatten um Ökologie, Arbeitslosigkeit und Kernkraft, weil er ganz genau weiß, dass ihm damit die öffentliche Aufmerksamkeit bereitwilliger folgt als im Hinweis auf das Evangelium. Im Ergebnis zeigt sich das Verhältnis zwischen Schriftorientierung, Synoden, Konsistorium und episkopalem Amt eher als chaotisch denn als ein System der "checks and balances". Je komplexer sich Entscheidungsprozesse gestalten, desto leichter wird es denen, die allein auf Machterhalt spielen, ihre Interessen durchzusetzen und gleichzeitig zu verbergen. Und desto leichter wird es, die theologische Reflexion aus der Entscheidungsfindung auszublenden bzw., wie Graf bemerkte, die harten Sachentscheidungen mit theologischen "Begründungen" zu garnieren oder - automechanisch gesprochen - zu verblenden. Es fragt sich nun, wieso die Theologie in den Landeskirchen die Rolle einer Leit- und Orientierungswissenschaft zu verlieren scheint. Es würde ja auch kein praktischer Arzt auf die Idee kommen, die Bedeutung der Medizin für die eigene Praxisarbeit zu relativieren. Wo wird nun aber theologisch diskutiert? Früher waren dafür die evangelischen Akademien zuständig, diese jedoch klagen seit Jahren über abnehmende Zahlen von Teilnehmern. Und insbesondere die Entscheidungsträger, die funktionalen Eliten aus der Gesellschaft finden den Weg nicht mehr zu den Tagungen, es sei denn, sie sind pensioniert. Das könnte zum einen am Erfolg der Akademie-Idee liegen. Wo in den fünfziger Jahren nur die Kirchen in Loccum, Bad Boll, Tutzing und anderswo Tagungen organisierten, unterhält heute jeder Interessenverband seine eigene Akademie. Zum anderen aber wird nicht mehr richtig deutlich, was denn der theologische und kirchliche Beitrag zu politischen und sozialen Fragen sein könnte, wenn nicht das bloße Wiederholen und Verstärken bestimmter Interessen, die einem sozialliberalen Konsensus im Sinne der politischen Korrektheit entsprechen. Aus den Tagungen in abgelegenen Akademien sind öffentlichkeitswirksame "Kongresse", noch besser: "Zukunftskongresse" geworden. Mit der zunehmenden Öffentlichkeitswirksamkeit steigerte sich jedoch auch das kirchliche Interesse an Selbstdarstellung. Um es pointiert zu formulieren: Wo die Tagungskultur noch für intellektuell anspruchsvolle Debatten sorgte und damit auch der Theologie einen prominenten Ort reservierte, verwandelt sich das Format des Kongresses in eine Marketing-Veranstaltung, wo jedenfalls nicht die intellektuelle und theologische Auseinandersetzung dominiert. Beim Kirchentag lässt sich unter veränderten Bedingungen eine ähnliche Entwicklung ablesen. Das Leitmotiv der kirchlichen Debattenkultur verwandelt sich: Die klassische Akademietagung war am gesellschaftlichen Dialog zwischen Kirche und anderen gesellschaftlichen Gruppen interessiert, dazu an anspruchsvoller Debatte, am Streit der Argumente. Die allenthalben organisierten "Kongresse" dagegen zielen auf öffentliche Wirkung, auf das Verteilen von Flyern und auf die Wertschätzung der kirchlichen Binnenöffentlichkeit. Die Folge ist: Die Akademien werden zum Austragen der von Debatten nicht mehr genutzt, sie leiden an mangelnden Teilnehmerzahlen. Die Theologen ziehen sich in die Fakultäten zurück und konzentrieren sich auf den interdisziplinären Dialog mit anderen Wissenschaften. Der skizzierte Prozess, dem die Kirchen gegenwärtig ausgesetzt sind, ist sicherlich komplexer als es in dieser abgekürzten Darstellung den Eindruck machen mag, aber die entscheidenden Grundlinien und Bewegungen scheinen benannt. Nur findet bislang niemand den Mut, die Initiative zu Veränderungen zu ergreifen. 5.Im Jahr 2006 veröffentliche die EKD ihr Reformpapier "Kirche der Freiheit"[11] . Wieder war an den Kammern vorbei eine Kommission eingesetzt worden, die sich dadurch auszeichnete, dass ihre Zusammensetzung in der undurchsichtigen und dunklen Region klerikaler Absprachen angemischt worden war. Das Stichwort der Reform hört sich ja innerhalb des Protestantismus stets gut an, auch wenn manchem merkwürdig erschien, dass die Reformen nun plötzlich von oben, aus der EKD heraus verordnet wurden. Wieder begegnete man dem merkwürdigen Phänomen, dass man einerseits einen innerkirchlichen Reformprozess anstoßen, gleichzeitig aber diesem Reformprozess eine ganz spezifische inhaltliche Richtung mit klaren ekklesiologischen Vorentscheidungen geben wollte. Diskussionsangebot und Verlautbarungsklerikalismus waren bis zur Ununterscheidbarkeit miteinander vermengt. Man zielte auf eine zentralistische Stärkung der EKD in Hannover, auf eine Konzentration der Landeskirchen zu größeren regionalen Verbänden, möglichst entlang der Grenzen der Bundesländer und auf die Stärkung von Richtungsgemeinden im Gegensatz zur quartiersorientierten Lokalgemeinde.
In dem Kirchenkreis, in dem ich damals arbeitete, führte dieser Prozess dazu, dass in den Gemeinden traditionelle und funktionierende Seniorenarbeiten systematisch kaputtgeredet wurden, während die finanziellen Mittel plötzlich in Projekte flossen, die sich die Generation "Ü50" zur Zielgruppe erkoren hatte. Plötzlich wollte man auf agile, reisefreudige, noch nicht von Alterserscheinungen gequälte "junge Alte" zugehen, wogegen gar nichts zu sagen ist. Aber gravierende Einwände erheben sich, wenn plötzlich deutlich wird, dass hier erstens eine funktionierende Altenarbeit einfach kaputtgeredet wird, zweitens die finanziellen Mittel nur umverteilt werden und drittens, um es vorsichtig zu formulieren, die neuen Altenarbeit sich mit den "jungen Alten" nicht ganz so sehr am Evangelium orientierte wie die klassischen Bibelkreise, die von Senioren traditionell besucht werden. Die Werbung für die Veranstaltung der "Jungen Alten" orientierte sich milieuspezifisch korrekt an der Werbung für Haftcreme, Altersversorgung und Winterurlaub auf Gran Canaria. Von der Milieutheorie gleich mehr. Der Erfolg der "Jungen Alten"-Arbeit wird damit erkauft, dass man die parochiale Gemeindeorientierung preisgibt und eine theologisch anspruchslose Volkshochschularbeit inszeniert, die mit dem evangelischen Auftrag nur im weitesten Sinne zu tun hat. Gegen den Prozess "Kirche der Freiheit" erhob sich schnell Widerspruch, vor allem in der Praktischen Theologie[12] und bei denjenigen, die das Prinzip der klassischen evangelischen Gemeindearbeit nun doch nicht gar so schnell über den Haufen werfen wollten[13]. Ob es nun von den Verfassern beabsichtigt war oder nicht, in dem "geleiteten" Diskussionsprozess ging völlig unter, dass sich mit den Gemeinde- und Strukturreformen auch ein völlig neues Pfarrerbild Bahn brach, das mit einer Reihe von theologischen Defiziten belastet war. Um im Bild zu bleiben: Der neue, "reformierte" Pfarrer sollte zum Leuchtturmwärter, zum Eventmanager, zum kundenorientierten theologischen Animateur und Entertainer werden. Auf lange Sicht wird damit die theologische Professionalität des Pfarrberufs ausgehöhlt und nivelliert. Und die spirituellen Animationsaufgaben können in dieser Perspektive selbstverständlich auch Ehrenamtliche erledigen: Amtsverständnis, Ordination, theologische Kenntnisse treten entsprechend in den Hintergrund. Dasselbe gilt für den Gottesdienst: Er wird zu einem Event neben anderen spirituellen Eventen. Ich räume gerne ein, dass hier verschiedene Lösungsansätze miteinander konkurrieren und der Streit um die richtigen Reformschritte noch nicht bis zu einem klaren Ergebnis ausgetragen ist. Allerdings scheinen mir Gehalt und Gewicht theologischer Expertise zu kurz zu kommen. Es höhlt den guten Sinn des Pfarramts aus, wenn die Wertschätzung von Ehrenamtlichen so weit auf die Spitze getrieben wird, dass der Unterschied zwischen Ehrenamt und theologischer Expertise letztlich keine Rolle mehr spielt. Die pastorale Eventmanagerin wird selbstverständlich Computerkurse für Best Ager anbieten und das als praktische Theologie oder Gemeindearbeit verkaufen, mit dem Argument, dass der best ager, der den Computerkurs im Gemeindezentrum besucht, vielleicht auch den ungepflegten Schaukasten sieht, in dem die Gottesdienste angekündigt werden. Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich als Theologen verstehen, werden die Akzente anders setzen und stattdessen das in die Gemeinde einbringen, was sie zu einem unverwechselbaren evangelischen Ort macht: Gottesdienst, Liturgie, Spiritualität, Theologie, Seelsorge, kurzum all das, was ein Theologe in erster und zweiter Ausbildungsphase gelernt hat. Versteht man Pfarrer hingegen als pastorale Eventmanager, so ist nicht mehr richtig einzusehen, wieso man ihnen ein Theologiestudium angedeihen lassen soll, denn das behindert sie ja eher für ihre Management- und Animationsaufgabe. Damit ich nicht falsch verstanden werde: An der dringenden Notwendigkeit von kirchlichen Reformen kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Aber es macht misstrauisch, dass vieles an den bisherigen Reformanstrengungen auf eine Nivellierung und Aushöhlung professionellen theologischen Fachwissens und seiner inspirierenden Weitergabe im Pfarramt hinausläuft. Ich will auch nicht ein nostalgisches Lied zu Ehren des klassischen protestantischen Pfarrhauses und der Parochialgemeinde singen. Aber nach meiner Überzeugung verspielt die evangelische Kirche ihr Tafelsilber, wenn sie ohne Not ihre Botschaft samt ihren starken theologischen Argumenten dafür bis zur homöopathischen Unkenntlichkeit verdünnt. Eher wird doch umgekehrt ein Schuh daraus: Die Menschen erwarten von Kirche, Gemeinde und Pfarrern gerade eine theologische Kernkompetenz, die nicht durch eine pastorale Anbiederungswissenschaft (Wie gewinne ich möglichst viele Teilnehmer und Kunden?) ersetzt werden darf. Es ist - ausnahmsweise - wie beim Kauf eines Autos. Das wichtigste ist, dass es sicher und störungsfrei fährt. Dass man damit Radio hören, im Internet surfen und zur Not auch Bierdosen kühlen kann, sind erfreuliche Nebenfunktionen, die aber alle hinter die Hauptfunktion des Fahrens treten. Das gilt, ich erinnere an Friedrich Wilhelm Graf, auch für einen Manta mit Spoiler. Und das gilt auch für die evangelische Kirche. Viele interessieren sich für die Gimmicks, die Albernheiten mit den Luther-Bonbons und lassen die Hauptfunktion der Verkündigung des Evangeliums außer Acht. Es irritiert, dass aus der Kirche selbst heraus an der Priorität der Theologie gerüttelt wird. Ich erkenne darin ein Verfallssymptom, das Besorgnis erregt. 6.Wenn man über den Beitrag der praktischen Theologie zur Kirchenleitung nachdenkt, dann kommen einem unweigerlich die vielen Milieustudien in den Sinn, die seit der ersten Studie Michael Vesters[14] publiziert worden sind. Der Erfolg dieser Studien lässt sich daran ablesen, dass Theologen, die nach dem Ziel ihrer Arbeit gefragt werden, zur Antwort geben, sie wollten den "Milieu-Ansatz" in der Gemeindearbeit oder in einem anderen kirchlichen Arbeitszweig besser zur Geltung bringen. Was ist der Milieu-Ansatz? Man sucht sich eine Art Landkarte der sozialen Verhältnisse, in die dann sekundär kirchenspezifische soziale Orientierungen eingetragen werden. So erhält man ein empirisches, nach Milieus differenziertes Bild gegenwärtiger Kirchenbilder. Diese Bilder und Karten werden in einer Mischung aus Demoskopie, Statistik und Tiefeninterviews entwickelt. Die praktische Theologie nimmt hier zwischen Soziologie und Demoskopie als externen Wissenschaften und praktischer Kirchenleitung eine Art Vermittlerrolle ein. Problematisch werden diese Untersuchungen an dem Punkt, wo die Ergebnisse interpretiert werden. Die rohen Daten sagen für sich noch nichts aus, sie müssen gedeutet werden. Und an diesem Punkt erscheint die Kirche wie eine Patientin, die sich eine Psychoanalyse verschreiben lässt, sich auch ein paar Stunden lang auf die Couch legt, aber dann doch lieber Tabletten nimmt, um schneller gesund zu werden. Soziologie und Demoskopie sind bekanntlich eher empirische als normative Wissenschaften, besonders die Demoskopie. Insbesondere Michael Vester hat in seinen einschlägigen Publikationen zu Kirche und Milieu immer wieder davor gewarnt, aus den Milieuuntersuchungen bestimmte Rezepte, zumal für eine schnelle und kurzschlüssige "Anwendung" abzuleiten. Diese Versuchung liegt ja bei den Milieulandkarten nahe, und sie verführen zu dem mechanistischen Missverständnis, dass Gemeindeaufbau so geschieht, dass die evangelischen Angebote auf die Bedürfnisse des Milieus haargenau abgestimmt werden und im Idealfall zusammenpassen wie Schlüssel und Schloss. Im Hintergrund steht dabei stets die Hoffnung, dass sich mit einer weiteren Differenzierung des kirchlichen Angebots auch neue und bisher kirchenfremde Milieus für Glauben und Evangelium erwärmen lassen[15]. Diese verbreitete ekklesiologische Vermutung unterliegt jedoch einer Reihe von Irrtümern:
Insgesamt leidet die gesamte Debatte unter einer kurzschlüssigen Rezeption der Milieutheorie. Der Kurzschluss besteht darin, dass die kirchlichen Verwaltungen und auch die einzelnen kirchlichen Arbeitsfelder mit Freuden das Differenzierungsgebot der Milieutheorie übernehmen, ohne zu merken, dass eine immer weiter gesteigerte Differenzierung dem Gesetz abnehmenden Grenznutzens unterliegt. Der zweite gravierende Fehler besteht darin, dass die Milieutheorie der Kirche einen funktionalen Religionsbegriff voraussetzt. Normativ funktional ist die Milieutheorie darin, dass sie Institutionen zur Anpassung an bestimmte soziale Profile nötigt. Das klappt hervorragend, wenn ein Anbieter die Milieutheorie zur Hilfe nimmt, um Autos, Duschgel oder medizinische Präparate zu verkaufen. Aber der evangelische Glaube ist eben kein Produkt, das so einfach an den Konsumenten gebracht werden kann. Über der Orientierung an Milieus geht die Orientierung an der Binnenlogik des Glaubens verloren. Mindestens besteht die Gefahr, dass das eine für das andere geopfert wird. Dort wo die Milieutheorie mit Hilfe der Soziologie in die Kirchen eingebracht wird, sorgt diese für genügend kritisches Bewusstsein, um der Falle des Folgens von Rezepten und der Preisgabe der eigenen theologischen Identität zu entgehen. Dort wo nur noch die Demoskopie unter Umgehung soziologischer Reflexion eingebracht wird, wird eine solche angemessene theologische Rezeption der Milieutheorie aus durchsichtigen Gründen preisgegeben. Dass nicht besonders glaubwürdig wirkt, wer die eigene evangelische Identität nach den Erwartungen sozialer Milieus anpasst, ist in den Kirchenleitungen noch nicht angekommen. 7.
Die Debatte endete mit einem Kommunikationsdesaster für die EKD, und in der Folge stellte man den bereits fertiggestellten Entwurf für eine Denkschrift zu Fragen der Sexualethik auf unbestimmte Zeit zurück. Das erweckt den Eindruck, als ob die EKD vor der theologischen und ethischen Reflexion drängender und viele Menschen bewegender Fragen zurückschreckt. Man will nur nicht in der Öffentlichkeit auffallen, will lieber schweigen als streiten. Das theologische Streiten aber lässt sich in einer Debatte, in der ganz offensichtlich auch unter den verschiedenen kirchenpolitischen Positionen kein Konsens zu finden ist, nicht vermeiden. Durch ihr ungeschicktes Taktieren hat die Kirche viel zu schnell und bereitwillig evangelikalen und fundamentalistischen Positionen die Bahn bereitet. Der genaue Blick auf die Orientierungshilfe zeigt, dass die Kommission unter ihrer Vorsitzenden Ute Gerhardt eigentlich genau ihren Auftrag erfüllt hat: gesellschaftliche Wandlungen des Familienbegriffs (1) und gegenwärtige Tendenzen und Richtungen der Familienpolitik (2) aufzuzeigen und Konturen einer ethisch und theologisch zu verantwortenden Position (3) deutlich zu machen. Die ersten beiden Aufgaben sind erfüllt worden. Erst beim dritten, aber eben auch wichtigsten Punkt könnte berechtigte Kritik ansetzen. Die theologische und biblische Reflexion über Familie und Ehe bleibt unterbelichtet und erscheint als ein traditioneller und konservativer theologischer Restbestand, der zwar zu erwähnen ist – Grafs berühmter Spoiler -, dem aber nicht mehr viel argumentatives Gewicht beigemessen wird. Gerade das Beispiel der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zeigt, was hier theologisch und ethisch zu tun wäre, in der Orientierungshilfe jedoch unterblieben ist. Es fehlt allenthalben in den Kirchenleitungen an einer theologischen und ethischen Hermeneutik, an einer begründeten Methodik der Entscheidungsfindung, welche es allererst ermöglicht, theologische Positionen zu beziehen und in der Öffentlichkeit durch Freimut – und nicht durch Herumdrucksen zu vertreten. Es geht nicht darum, (sozial-)politische Positionen zu übernehmen und dann sekundär theologisch zu verbrämen.[17] Wobei zu konzedieren ist: Gerade auf dem Feld der ethischen Bewertung von Homosexualität gibt es Ausnahmen der angemessenen theologischen und ethischen Bearbeitung dieser Frage.[18] Ohne hier das gesamte Tableau der anstehenden Fragen behandeln zu können, so stellen sich doch mindestens drei Probleme, die das Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung betreffen.
8.Im Ergebnis zeigt sich ein Bild von der Kirchenleitung, die theologische Diskussionen eher vermeidet, die weniger debattiert als inszeniert, die ein offenes Wort scheut und sich statt dessen in vernebelnde Formulierungen flüchtet. Anstatt zu agieren und Akzente zu setzen, reagiert sie zögerlich und unbeholfen. Das einstmals enge Band zwischen Theologie und Kirchenleitung hat sich bis auf den dünnen Faden einer interessegeleiteten Rezeption aufgelöst. Theologie wird nur noch dort rezipiert, wo sie den eigenen Interessen und Erwartungen entspricht. Das Erfolgsmodell evangelischer Debattenkultur, wie sie von den evangelischen Akademien und dem Kirchentag als intermediären Institutionen jahrzehntelang erfolgreich praktiziert wurde, hat sich aufgelöst in eine klerikale Verlautbarungs- und Marketingkultur. Werbung tritt an die Stelle des Austauschs von Argumenten. Anpreisen und Überreden tritt an die Stelle von Abwägen und Begründen. Aber eine kirchliche Theologie, die nicht mehr durch Debatte, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit bestimmt wird, unterscheidet sich nicht groß von den Marketingabteilungen der Parteien, der großen Stiftungen oder von Unternehmen. Nun soll auch den Kirchen nicht das Recht abgesprochen werden, für die eigene Sache einzutreten, besonders wenn es sich denn um eine Sache der Kirche handelt. Aber mit der Regression in die Verlautbarung und das Marketing geben die – im Grunde ohne Not – die nachhaltig feste Bindung an die wissenschaftliche Theologie und zweitens diejenige Debattenkultur auf, die historisch und aktuell stets auch von den Gegnern und Zweiflern als eine ganz besondere Stärke des Protestantismus angesehen worden ist. Und dabei gäbe es neben den genannten noch so viele Themen, über die intern und/oder öffentlich theologisch diskutiert werden müssten.
Anmerkungen[1] Heinrich Bedford-Strohm, Vorrang für die Armen - Auf dem Weg zu einer theologischen Theorie der Gerechtigkeit, Gütersloh 1993; Wolfgang Vögele, Menschenwürde zwischen Recht und Theologie, Gütersloh 1999. [2] Christoph Dinkel, Die Kirche in die Zukunft führen - Schleiermachers Theorie des Kirchenregiments, EvTh 58, 1998, 269-282. [3] Friedrich Wilhelm Graf, Theologische Aufklärung. Abschiedsvorlesung am 28.1.2014, München 2014, http://www.st.evtheol.uni-muenchen.de/aktuelles/abvl/abschiedsvorlesung_fwg.pdf, 15. [4] Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für Theologie, Die Bedeutung der wissenschaftlichen Theologie in Gesellschaft, Universität und Kirche, EKD Texte 104, Hannover 2009, http://www.ekd.de/download/ekd_texte_104.pdf. [5] Kirchenamt der EKD (Hg.), Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2014, http://www.ekd.de/download/2014_rechtfertigung_und_freiheit.pdf. [6] Thomas Kaufmann, Heinz Schilling, Luther-Ideologie, Die Welt 24.5.2014, http://www.welt.de/debatte/kommentare/article128354577/Die-EKD-hat-ein-ideologisches-Luther-Bild.html. Vgl. die Antwort von Christoph Markschies, Die EKD bleibt bei der Theologie und das ist gut so, Die Welt 6.6.2014, http://www.welt.de/debatte/kommentare/article128798355/Die-EKD-bleibt-bei-der-Theologie-und-das-ist-gut-so.html. [7] Dieser letztere Vorwurf stammt allerdings nicht von Schilling und Kaufmann, sondern von Kardinal Kasper. Eine Reihe prominenter katholischer Theologen hat sich diesem Vorwurf angeschlossen. [8] Emil Sehling u.a. (Hg.), Die evangelischen Kirchenordnungen des 16.Jahrhunderts, Bd.1ff., Leipzig 1902ff. [9] Dazu s.u. Abschnitt 7. [10] Vgl. dazu das Portal http://fis-kirchenrecht.de/, auf dem die Rechtssammlungen der meisten Landeskirchen vertreten sind. [11] Kirchenamt der EKD (Hg.), Kirche der Freiheit. Ein Impulspapier des Rates der EKD, Hannover 2006, http://www.ekd.de/download/kirche-der-freiheit.pdf [12] Isolde Karle, Kirche im Reformstreß, Gütersloh 2010. [13] Wolfgang Vögele, Das Handwerk der Theologie – ein Versuch, in: Konvent des Klosters Loccum (Hg.), Kirche in reformatorischer Verantwortung. Wahrnehmen – Leiten – Gestalten, FS Horst Hirschler, Göttingen 2008, 341-354. Vgl. auch ders., Welche Kirche ist gemeint? Vorstellungen über die Kirche in gesellschaftlichen Milieus und die Erwartungen des Rechts und der Theologie, in: H.G. Kippenberg, G.F.Schuppert (Hg.), Die verrechtlichte Religion. Der Öffentlichkeitsstatus von Religionsgemeinschaften, Tübingen 2005, 141-156. [14] Wolfgang Vögele, Heiner Bremer, Michael Vester, Soziale Milieus und Kirche, Würzburg 2002. [15] Heinzpeter Hempelmann, Gott im Milieu. Wie Sinusstudien helfen können, Menschen zu erreichen, Gießen 2013. Schon der Untertitel dieses Werks mutet merkwürdig an, suggeriert er doch, Milieulandkarten könnten nur mit Hilfe eines bestimmten Meinungsforschungsinstituts erhoben werden. [16] Kirchenamt der EKD (Hg.), Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verläßliche Gemeinschaft stärken. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2013, www.ekd.de/download/20130617_familie_als_verlaessliche_gemeinschaft.pdf. [17] Weitere Beispiele dafür finden sich insbesondere im ökologischen Bereich, wo politische Forderungen häufig mit dem moralisierenden Imperativ der „Bewahrung der Schöpfung“ legitimiert werden. Vgl. dazu Reiner Anselm, Bewahrung der Schöpfung. Genese, Gehalt und gegenwärtige Bedeutung einer Programmformel in der Perspektive ethischer Theologie, EvTh 74, 2014, 227-236. [18] Zum Beispiel Theologische Kammer der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, Braunschweig 2002, http://www.huk.org/cms/upload/oeffentlich/dokumente/ev-kirchen_synoden_pdf-04_braunschweig_2002.pdf.pdf. (N.B. Das doppelte .pdf gehört zu dieser Webadresse.) Ich würde auch dazu zählen Kirchenamt der EKD (Hg.), Mit Spannungen leben. Eine Orientierungshilfe des Rates der EKD, Hannover 1994, http://www.ekd.de/EKD-Texte/44736.html. Allerdings wird gibt es gegenüber diesem Papier aus der Sozialethik auch kritische Stimmen: Johannes Fischer, Eine besondere Gefährdung für die Kirche. Zur Orientierungshilfe des Rates der EKD zum Thema ‚Homosexualität und Kirche', DtPfBl 96, 1996, Nr. 7, 371-373. [19] Der entsprechende Beschluss der Badischen Landessynode über Segnungsgottesdienste von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lautet: „Die Landessynode begrüßt alle Bemühungen, die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften zu beseitigen. Die Schaffung rechtlicher Regelungen für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften hilft den in solchen Partnerschaften verbundenen Menschen dabei, in stabilen Beziehungen zu leben. Wo dies gelingt, sind solche Regelungen ein Beitrag zur Stärkung eines von gegenseitiger Verantwortung und Solidarität bestimmten Zusammenlebens. Die Landessynode befürwortet die geistliche Begleitung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Diese soll ausschließlich in der Seelsorge stattfinden. Die Landessynode hat das Vertrauen, dass die in der Seelsorge Tätigen den Raum der Seelsorge verantwortlich gestalten.“ Beschluss der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden zum Thema der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, Karlsruhe 2003, http://www2.ekiba.de/434_1568.php. [20] Siehe oben Abschnitt 4. [21] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Leben und Überleben. Der Lebensbegriff im Kontext der protestantischen Friedensbewegung in Deutschland, in: St. Schaede et al. (Hg.), Das Leben III. Historisch-systematische Studien zur Geschichte eines Begriffs, Tübingen 2014 i.E.. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/90/wv12.htm
|
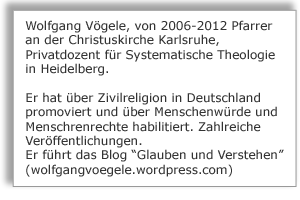 Wolfgang Vögele
Wolfgang Vögele Zu sehen ist ein verzweigtes und vielgestaltiges Delta von Rinnsalen und kanalisierten Flussläufen, von versandeten Teichen und Seen, die von der Wasserzufuhr abgeschottet sind. Am Ende fließt das fromme Wasser der Denkschrift, der Vorschrift oder des Bischofsworts ins Meer der säkular gestimmten Öffentlichkeit, wo es manchmal aufgrund seiner besonderen evangelischen Färbung gut wahrzunehmen ist, manchmal aber auch in der Fülle anderer Meldungen und Meinungen aufgelöst wird. Wer für die Trinkwasserqualität verantwortlich ist, lässt sich nur schwer bestimmen, aber der pH-Wert des Glaubens und der Gehalt an Spurenelementen des Bekenntnisses, der Bibel und der Theologie, kurz: der geistliche Gehalt wäre doch eigentlich von erheblichem Interesse.
Zu sehen ist ein verzweigtes und vielgestaltiges Delta von Rinnsalen und kanalisierten Flussläufen, von versandeten Teichen und Seen, die von der Wasserzufuhr abgeschottet sind. Am Ende fließt das fromme Wasser der Denkschrift, der Vorschrift oder des Bischofsworts ins Meer der säkular gestimmten Öffentlichkeit, wo es manchmal aufgrund seiner besonderen evangelischen Färbung gut wahrzunehmen ist, manchmal aber auch in der Fülle anderer Meldungen und Meinungen aufgelöst wird. Wer für die Trinkwasserqualität verantwortlich ist, lässt sich nur schwer bestimmen, aber der pH-Wert des Glaubens und der Gehalt an Spurenelementen des Bekenntnisses, der Bibel und der Theologie, kurz: der geistliche Gehalt wäre doch eigentlich von erheblichem Interesse. In anderen Fächern (und Debatten) wird sie nach Anspruch, Tätigkeit und Ansehen in der Öffentlichkeit verteilt. Zeitungen und Zeitschriften, aber auch Akademien, politische Stiftungen, Foren und Parteien sorgen dafür, dass sich Philosophen wie Jürgen Habermas oder Reiner Forst, Soziologen wie Hans Joas oder Heinz Bude, Historiker wie Heinrich August Winkler, Jürgen Osterhammel oder der gerade verstorbene Hans Ulrich Wehler, Juristen wie Paul Kirchhof oder Ernst Wolfgang Böckenförde zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen äußern können. Sie tun das alle stets mit Bezug auf die wissenschaftliche Disziplin, die sie vertreten. Aber es lässt sich auch die Beobachtung machen, dass ihre Zahl und Bedeutung abgenommen hat. Osterhammels Rede beim sechzigsten Geburtstag der Kanzlerin neulich wurde auch in angesehenen Tageszeitungen mit der indignierten Bemerkung kommentiert, er habe sich kompliziert und schwer verständlich ausgedrückt.
In anderen Fächern (und Debatten) wird sie nach Anspruch, Tätigkeit und Ansehen in der Öffentlichkeit verteilt. Zeitungen und Zeitschriften, aber auch Akademien, politische Stiftungen, Foren und Parteien sorgen dafür, dass sich Philosophen wie Jürgen Habermas oder Reiner Forst, Soziologen wie Hans Joas oder Heinz Bude, Historiker wie Heinrich August Winkler, Jürgen Osterhammel oder der gerade verstorbene Hans Ulrich Wehler, Juristen wie Paul Kirchhof oder Ernst Wolfgang Böckenförde zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen äußern können. Sie tun das alle stets mit Bezug auf die wissenschaftliche Disziplin, die sie vertreten. Aber es lässt sich auch die Beobachtung machen, dass ihre Zahl und Bedeutung abgenommen hat. Osterhammels Rede beim sechzigsten Geburtstag der Kanzlerin neulich wurde auch in angesehenen Tageszeitungen mit der indignierten Bemerkung kommentiert, er habe sich kompliziert und schwer verständlich ausgedrückt.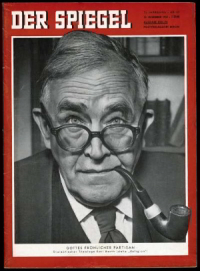 In der Theologie sind die Zeiten lange vorbei, als Rudolf Bultmann und Dorothee Sölle die Debatte über Auferstehung und Tod Gottes in die Öffentlichkeit trugen, als die Vorträge von Paul Tillich, Karl Barth, Karl Rahner und anderen nicht nur in der kirchlich interessierten Öffentlichkeit weithin wahrgenommen wurden. Karl Barth schaffte es als „Gottes fröhlicher Partisan“ mit der Pfeife im Mundwinkel immerhin auf die Titelseite des "Spiegel". Die wenigen gegenwärtigen Ausnahmen wie der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm oder der Münchener Systematische Theologe Friedrich Wilhelm Graf bestätigen eher die Regel. Offensichtlich wird die wissenschaftliche Theologie nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen als noch vor Jahrzehnten. Das trägt zu ihrem Ansehensverlust bei, und sie hat erheblich an Orientierungskraft verloren.
In der Theologie sind die Zeiten lange vorbei, als Rudolf Bultmann und Dorothee Sölle die Debatte über Auferstehung und Tod Gottes in die Öffentlichkeit trugen, als die Vorträge von Paul Tillich, Karl Barth, Karl Rahner und anderen nicht nur in der kirchlich interessierten Öffentlichkeit weithin wahrgenommen wurden. Karl Barth schaffte es als „Gottes fröhlicher Partisan“ mit der Pfeife im Mundwinkel immerhin auf die Titelseite des "Spiegel". Die wenigen gegenwärtigen Ausnahmen wie der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm oder der Münchener Systematische Theologe Friedrich Wilhelm Graf bestätigen eher die Regel. Offensichtlich wird die wissenschaftliche Theologie nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen als noch vor Jahrzehnten. Das trägt zu ihrem Ansehensverlust bei, und sie hat erheblich an Orientierungskraft verloren. Das ist nur schlechte Präambeltheologie, die an einen Plastikspoiler am Manta erinnert: Erst verschriftlicht man seine harten, durchaus legitimen religionspolitischen oder ökonomischen Interessen, und dann stellt man diesem Text ein irgendwie religiös klingendes, durch beliebig herbeigebrachte Bibelzitate aufgemotztes Vorwort voran.“
Das ist nur schlechte Präambeltheologie, die an einen Plastikspoiler am Manta erinnert: Erst verschriftlicht man seine harten, durchaus legitimen religionspolitischen oder ökonomischen Interessen, und dann stellt man diesem Text ein irgendwie religiös klingendes, durch beliebig herbeigebrachte Bibelzitate aufgemotztes Vorwort voran.“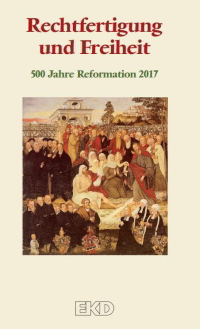 Der Blick auf den Ursprung des Protestantismus im 16. Jahrhundert liefert Material für eine der spannendsten Kontroversen für dieses Thema. Zur Erinnerung: Die EKD hat eine Reformationsdekade ausgerufen, in der sie in Themenjahren von der Ökumene über die Taufe, die Kirchenmusik bis zu Toleranz und Politik Mosaiksteine protestantischer Beiträge zu den jeweiligen Themen zusammenstellen will. Das ist eine gute Idee, manchmal wirkte das ein wenig bemüht, oft jedoch klappte es gut. Ihren Höhepunkt soll diese Reformationsdekade im Jubiläumsjahr 2017 finden. Dafür hat eine Adhoc-Kommission im Auftrag des Rates der EKD unter dem Titel „Rechtfertigung und Freiheit“
Der Blick auf den Ursprung des Protestantismus im 16. Jahrhundert liefert Material für eine der spannendsten Kontroversen für dieses Thema. Zur Erinnerung: Die EKD hat eine Reformationsdekade ausgerufen, in der sie in Themenjahren von der Ökumene über die Taufe, die Kirchenmusik bis zu Toleranz und Politik Mosaiksteine protestantischer Beiträge zu den jeweiligen Themen zusammenstellen will. Das ist eine gute Idee, manchmal wirkte das ein wenig bemüht, oft jedoch klappte es gut. Ihren Höhepunkt soll diese Reformationsdekade im Jubiläumsjahr 2017 finden. Dafür hat eine Adhoc-Kommission im Auftrag des Rates der EKD unter dem Titel „Rechtfertigung und Freiheit“ Jenseits der banalen Einsicht, dass jedes Jubiläum bestimmte identitätspolitische und –strategische Überlegungen erfordert, thematisiert das bevorstehende Lutherjubiläum auch die Frage nach dem Verhältnis von Theologie, Leben und Alltag bzw. von Theologie und Geschichte. Genau diese Frage darf nicht so verhandelt werden als ob allein die Biographie und Theologie Martin Luthers im Mittelpunkt stünden.
Jenseits der banalen Einsicht, dass jedes Jubiläum bestimmte identitätspolitische und –strategische Überlegungen erfordert, thematisiert das bevorstehende Lutherjubiläum auch die Frage nach dem Verhältnis von Theologie, Leben und Alltag bzw. von Theologie und Geschichte. Genau diese Frage darf nicht so verhandelt werden als ob allein die Biographie und Theologie Martin Luthers im Mittelpunkt stünden. Wer in solchen alten Kirchenordnungen liest, dem wird aber auch deutlich, wie fern der Alltag des 16. Jahrhunderts heutigen Lebensverhältnissen gerückt ist. Die Zahl der Gottesdienste und Andachten, der Gebetszeiten in den Familien übertraf heutige Gepflogenheiten bei weitem. Wer liest, dass Pfarrer regelmäßig ermahnt werden mussten, nicht länger als eine Stunde zu predigen, dass jeden Sonntag neben dem Hauptgottesdienst ein zweiter Gottesdienst mit einer Katechismuspredigt stattfand, der sieht mit Staunen, wie tief Religion, Spiritualität und Theologie den Alltag der Menschen des 16. Jahrhunderts bestimmten. Aus dem Abstand von der Gegenwart folgt der geschichtswissenschaftliche Imperativ der Historisierung. So wie das Neue Testament aus seinem religionswissenschaftlichen und historischen Kontext zu erklären ist, so gilt das auch für die Reformation. Damit werden bestimmte Aktualisierungsstrategien als ideologisch entlarvt. Das gilt für den „deutschen“, den „bürgerlichen“, den „heroischen“ Luther. Das darf aber nicht dazu führen, eine solche theologische Hermeneutik der Aktualisierung grundsätzlich zu verdammen. Wie die historisch-kritische Lektüre des Neuen Testaments nicht von der Verpflichtung entbindet, Gleichnisse und Predigten Jesu für die Gegenwart auszulegen und zu predigen, so stellen sich diese Fragen auch für die Reformation. Wie gesagt: Man kann das übertreiben. Man kann fragen, ob es angemessen ist, allein Martin Luthers Freiheitstheologie als den subjektivitätstheoretischen Versuch der Herauslösung des Menschen aus seinen sozialen wie überkommenen theologischen Ordnungen zu lesen und ihn auf sein allein an Gott gebundenes Gewissen zu verpflichten und den Reformator zum Erfinder von Demokratie, Gewissensfreiheit und Moderne zu stilisieren. Aber all diese strittigen Fragen, die für das Reformationsjubiläum neu zu diskutieren wären, heben das Miteinander von historischer Kontextualisierung und hermeneutischer Aktualisierung nicht auf.
Wer in solchen alten Kirchenordnungen liest, dem wird aber auch deutlich, wie fern der Alltag des 16. Jahrhunderts heutigen Lebensverhältnissen gerückt ist. Die Zahl der Gottesdienste und Andachten, der Gebetszeiten in den Familien übertraf heutige Gepflogenheiten bei weitem. Wer liest, dass Pfarrer regelmäßig ermahnt werden mussten, nicht länger als eine Stunde zu predigen, dass jeden Sonntag neben dem Hauptgottesdienst ein zweiter Gottesdienst mit einer Katechismuspredigt stattfand, der sieht mit Staunen, wie tief Religion, Spiritualität und Theologie den Alltag der Menschen des 16. Jahrhunderts bestimmten. Aus dem Abstand von der Gegenwart folgt der geschichtswissenschaftliche Imperativ der Historisierung. So wie das Neue Testament aus seinem religionswissenschaftlichen und historischen Kontext zu erklären ist, so gilt das auch für die Reformation. Damit werden bestimmte Aktualisierungsstrategien als ideologisch entlarvt. Das gilt für den „deutschen“, den „bürgerlichen“, den „heroischen“ Luther. Das darf aber nicht dazu führen, eine solche theologische Hermeneutik der Aktualisierung grundsätzlich zu verdammen. Wie die historisch-kritische Lektüre des Neuen Testaments nicht von der Verpflichtung entbindet, Gleichnisse und Predigten Jesu für die Gegenwart auszulegen und zu predigen, so stellen sich diese Fragen auch für die Reformation. Wie gesagt: Man kann das übertreiben. Man kann fragen, ob es angemessen ist, allein Martin Luthers Freiheitstheologie als den subjektivitätstheoretischen Versuch der Herauslösung des Menschen aus seinen sozialen wie überkommenen theologischen Ordnungen zu lesen und ihn auf sein allein an Gott gebundenes Gewissen zu verpflichten und den Reformator zum Erfinder von Demokratie, Gewissensfreiheit und Moderne zu stilisieren. Aber all diese strittigen Fragen, die für das Reformationsjubiläum neu zu diskutieren wären, heben das Miteinander von historischer Kontextualisierung und hermeneutischer Aktualisierung nicht auf.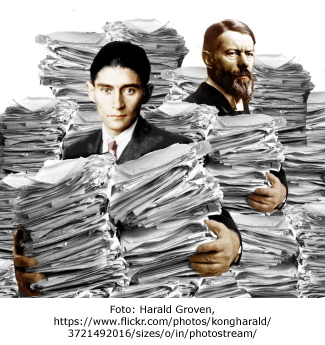 Wenn eine Synode über Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Partnerschaften entscheiden muss, dann kann sie auch mit einer Mehrheitsentscheidung schnell an ihre Grenzen gelangen. Oder sie trifft Entscheidungen, die man, wie im Fall der badischen Landessynode, nur als Verweigerung von Entscheidungen charakterisieren kann.
Wenn eine Synode über Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Partnerschaften entscheiden muss, dann kann sie auch mit einer Mehrheitsentscheidung schnell an ihre Grenzen gelangen. Oder sie trifft Entscheidungen, die man, wie im Fall der badischen Landessynode, nur als Verweigerung von Entscheidungen charakterisieren kann. Gesondert betrachtet werden müssen die Rechtsabteilungen von Konsistorien. Denn die Keule des Kirchenrechts wird stets dort erhoben, wo die Theologie nie um Rat gefragt wurde. Wer sich die Menge kirchlicher Verordnungen, Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Richtlinien und ähnlicher Dokumente
Gesondert betrachtet werden müssen die Rechtsabteilungen von Konsistorien. Denn die Keule des Kirchenrechts wird stets dort erhoben, wo die Theologie nie um Rat gefragt wurde. Wer sich die Menge kirchlicher Verordnungen, Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Richtlinien und ähnlicher Dokumente An die Stelle der flächendeckend präsenten Gemeinden sollten die berühmten "Leuchttürme" treten, weit hinaus in die Gesellschaft strahlend und jeweils attraktive Anziehungspunkte für neu entdeckte Zielgruppen, von den Gospelchören über die best ager bis zur Kirchenmusik.
An die Stelle der flächendeckend präsenten Gemeinden sollten die berühmten "Leuchttürme" treten, weit hinaus in die Gesellschaft strahlend und jeweils attraktive Anziehungspunkte für neu entdeckte Zielgruppen, von den Gospelchören über die best ager bis zur Kirchenmusik. Ein besonders umstrittenes Feld theologischer und kirchlicher Abwägungen stellen Fragen der Homosexualität dar. Nochmals deutlich gemacht hat das die erregte öffentliche Debatte, welche auf die Orientierungshilfe der EKD zur Familie folgte. Einer der Hauptvorwürfe gegen die Orientierungshilfe
Ein besonders umstrittenes Feld theologischer und kirchlicher Abwägungen stellen Fragen der Homosexualität dar. Nochmals deutlich gemacht hat das die erregte öffentliche Debatte, welche auf die Orientierungshilfe der EKD zur Familie folgte. Einer der Hauptvorwürfe gegen die Orientierungshilfe Die angefangene Liste ließe sich beliebig verlängern. Kirchenleitung schadet sich selbst und dem Evangelium, wenn sie ohne Not auf die Beratung durch die Theologie verzichtet oder sie nicht mehr ernst nimmt. An die Stelle reicher protestantischer Diskussionskultur, die einer „Kirche des Wortes“ sehr gut ansteht, tritt immer mehr eine Kirche, die von Verwaltung, Verordnung und Marketing bestimmt ist. In solch einer Kirche verkümmert das Evangelium unter den Wucherungen der Bürokratie. Und wer so denkt, der feiert am Ende nur noch das Abendmahl der Aktenordner.
Die angefangene Liste ließe sich beliebig verlängern. Kirchenleitung schadet sich selbst und dem Evangelium, wenn sie ohne Not auf die Beratung durch die Theologie verzichtet oder sie nicht mehr ernst nimmt. An die Stelle reicher protestantischer Diskussionskultur, die einer „Kirche des Wortes“ sehr gut ansteht, tritt immer mehr eine Kirche, die von Verwaltung, Verordnung und Marketing bestimmt ist. In solch einer Kirche verkümmert das Evangelium unter den Wucherungen der Bürokratie. Und wer so denkt, der feiert am Ende nur noch das Abendmahl der Aktenordner.