
Closer to van Eyck |
„... von großem Wert für die Nachwelt“Der Briefschreiber Goethe. Eine RezensionHans-Jürgen Benedict
Wir bekommen jede Menge Briefe, die meisten sind Rechnungen, Werbeschreiben, Mitteilungen der Ämter, eher selten sind persönliche Briefe darunter.[1] Ein Poststreik setzt uns trotzdem zu. Was, keine Post heute? Dabei ist doch die schöne Kultur des Briefeschreibens längst erloschen, schon seit 120 Jahren ist das, was früher der Brief leistete, die Ersetzung des persönlichen Gesprächs durch den Briefwechsel, zunächst vom Telefon, dann vom Internet übernommen worden. Auch die mit dem Verfassen von Briefen verbundene Humanität war bereits unwiederbringlich verloren, als Walter Benjamin in finsterer Zeit seine „Briefe deutscher Menschen“ veröffentlichte, 1936 anonym in der Schweiz. Zu den von ihm kommentierten Briefen gehörte auch einer von Johann Wolfgang Goethe an Moritz Seebeck aus dem Jahr 1832. Goethe hat ca. 20.000 Briefe geschrieben, davon sind 14.700 überliefert, etwa 5000 nur erschlossen, ca. 24.000 hat er erhalten. Jetzt, da mit der digitalen Revolution kaum noch jemand sich handschriftlich in Briefen äußert (geblieben sind allenfalls die sorgfältig geschriebenen Postkarten aus dem Urlaub) hat Albrecht Schöne Goethe als Briefschreiber zum Thema eines wunderbaren Buchs gemacht, es ist weniger als Abgesang auf diese Kunst (das auch) denn als Bereicherung der Goethe-Kenntnis zu sehen und zu lesen. Schöne stellt einen wenig erforschten Bestandteil des Werks Goethe umfassend und außerordentlich anregend dar, mit seinen Fundstücken lernt man den großen Autor noch einmal neu und anders kennen als in mancher Biographie.
Einen breiten Raum nimmt auch der dialogische Aspekt des Briefwechsels ein. Und schließlich: „Von großen Männern nachgelassene Briefe haben immer einen großen Wert für die Nachwelt.“ In diesem Sinne wird sein Briefwechsel mit Zelter bereits als für die Veröffentlichung gedacht verfasst. Viele Briefe und Briefchen befassten sich aber auch mit Banalitäten wie dieser an Johanna Falmer: „ich bitte sie um eine Portion Haar wachsen machende Pomade und das Rezept.“ Gleich daneben stehen die großen Briefe, die Entwicklungen resümieren, in denen offenbarungsgleich eine bis dahin unerhörte Aussage gemacht wird, neue Erkenntnisse und außerordentlich schöne Formulierungen auftauchen, die einem fast den Atem nehmen. Nach dieser Einführung befassen sich dann neun exemplarische Fallstudien mit je einem Brief Goethes – sie beginnen mit dem ersten Schreiben des 14-Jährigen an Buri, in dem er um die Aufnahme in die literarische Argon-Gesellschaft bittet; sie enden mit einem Brief an Wilhelm von Humboldt, geschrieben fünf Tage vor Goethes Tod, in dem es um die Vollendung der Faust-Tragödie geht. Jeder Fallstudie ist spannend – etwa wie Goethe in einem Brief aus Leipzig über eine Liebesverwirrung an den älteren Freund Behrisch berichtend den atemlosen reportagehaften Briefstil entwickelt, der dann in Werthers Leiden dominiert. Wie er in Briefen an den unglücklichen Johann Friedrich Krafft, den Goethe großzügig finanziell unterstützte, seinen Stil und die Tempuswahl so einrichtet, dass der unsichere Mann neuen Mut schöpfen kann und nicht von seinen Ängsten aufgefressen wird. Als 1779 während des bayrischen Erbfolgekriegs Preußen vom Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach entweder das Recht auf Pressung oder die freiwillige Entsendung von eigenen Soldaten verlangt, schreibt der Legationsrat Goethe als Kriegskommissarius dem Herzog einen mehrseitigen Brief , der als Musterbeispiel einer gelungenen politischen Beratung eines Souveräns gelten kann. Goethe wägt darin die verschiedenen Alternativen gegeneinander ab (stimmen wir zu, lehnen wir ab, was wird bei Zustimmung Österreich, was bei Ablehnung Preußen tun), gibt glasklar die Folgen jeder Lösung zu bedenken und formuliert so Entscheidungshilfen. Rekrutenaushebungen, an denen er als Kriegskommissarius teilnehmen musste, seien, so fügt er gesinnungsethisch hinzu, so oder so ein „unangenehmes, verhasstes und schaamvolles Geschäft.“ Als Brief in Sachen Kriegsbeteiligung wird er so fast ein Antikriegsbrief ähnlich wie Claudius gleichzeitiges Kriegslied, weil die Inhumanität von Kriegsvorbereitungen und -handlungen deutlich benannt wird. Wie er an Cotta wegen einer herabsetzenden Darstellung seiner Heirat mit Christiane Vulpius 1806 in dessen Augsburger Zeitung einen bösen Brief schreibt, diesen aber dann doch nicht abschickt, Cotta ist immerhin sein Verleger, das ist eine schöne Illustration der Äußerung von 1825: „Wie könnte man leben, wenn man nicht jeden Abend sich und anderen ein Absolutorium erteilte?“ Jeder der analysierten Briefe ist von existentieller Kraft, um nicht zu sagen Wucht. In dem oben bereits erwähnten Brief an den Sohn Seebecks geht es letztlich um postume Versöhnung Goethes mit dessen Vater; Goethe gelingen hier eine treffliche, auch selbstkritische Beschreibung des Prozesses der Entfremdung zwischen Freunden: erst ein Schweigen, dann ein Verstummen, schließlich eine Missstimmung; „so müssen wir hierin leider eine Art von Unbehülflichkeit entdecken, die in guten wohlwollenden Charakteren sich hervorthun kann und die wir, wie andere Fehler, zu überwinden und zu beseitigen mit Bewußtseyn trachten sollten.“ Wie Goethe in einem Brief an Zelter 1828 auf den Tod Freundes und Fürsten Carl August reagiert - er flieht vor den Begräbnisfeierlichkeiten nach Dornburg, er beschreibt, wie ihm dort die Umsetzung von Todesängsten in Handlungsenergie gelingt, widmet sich Naturbetrachtungen, schreibt noch einmal Gedichte und entwickelt eine Unsterblichkeitshoffnung, bis hin zu der ungeheuerlichen Aussage gegenüber Eckermann: „Wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinen Geist nicht ferner auszuhalten vermag.“ Schließlich in dem letzten Brief mit der Frage Humboldts, warum er den Faust nicht zur Veröffentlichung freigebe, die Antwort, es würde ihm „schon Freude machen, diese sehr ernsten Scherze den Freunden bei Lebzeiten zu widmen und ihre Erwiderung zu vernehmen.“ Aber die Lage sei so verwirrend, dass ihm „nichts übrig bleibe als dasjenige was an mir ist und geblieben ist, womöglich zu steigern und meine Eigentümlichkeiten zu kohibieren.“ (Wie beim sich aus der Raupe lösenden Schmetterling, wie beim „Stirb und werde“ des Gedichts Selige Sehnsucht).
Schöne zeigt also, wie eine der größten Gestalten der Weltliteratur, die sich ihres Wertes und einmaligen Rangs durchaus bewusst war, in der Gattung des Briefes sich als Mensch zeigt, der auch gekränkt, enttäuscht, verärgert sein kann, dem es aber gelingt im Dialog mit dem Briefpartner Menschlichkeit walten zu lassen, wozu vor allem das Verzeihen und Verstehen gehört. Der sicher aber auch im Medium des Briefes sprachlich den Empfänger überwältigte durch seiner „Rede Zauberfluß“ (Gretchen in Faust I), in diesem Fall durch die Magie seines Schreibens. Der dabei aber auf dem unverwechselbar Eigenen besteht (etwa in der Verteidigung seiner Farbenlehre im Brief an den Sohn Seebecks), nicht ohne es Wandlungen auszusetzen. Und der danach trachtet, die ihm wertvollen Freunde in die „Gemeinschaft der Heiligen“ zurückzuholen bzw. darin zu lassen. Für den Theologen ist diese säkulare Verwendung großer Theologumena berührend, hingewiesen sei noch auf das Röm 8, 39 zitierende Bekenntnis gegenüber Charlotte von Stein: „Meine Seele ist fest an deine angewachsen, ich mag keine großen Worte machen, Du weist, daß ich von dir unzertrennlich bin und daß weder hohes noch tiefes mich zu scheiden vermag.“ Darf man zum Schluss fragen, ob das Ganze nicht dann doch nicht etwas zu harmonisch und bewundernd gegenüber dem „Alten“, wie Schöne ihn manchmal bei der Analyse der späten Brief nennt, geraten ist ? Wenn Goethe an einer Stelle vom „Bodensatz des Absurden“ spricht, die jeder großen Kunst beigemengt ist, so ist der in seinen Briefen, die realitätsgerecht wirken wollen, sicher weniger anzutreffen. Wenn Kunst etwas so schön sagt, wie es noch nicht ist (man denke an die Iphigenie und die Novelle), so sagt der Brief etwas so konkret heilend wie zurechtweisend, dass Vergebung und Absolution möglich bleibt. Die Briefe, die diese Option nicht offenhalten, schickt Goethe lieber nicht ab. Oder er verändert sie so lange, bis sie absendbar sind. „Dem Vortrefflichen Gegenüber gibt es keine Freiheit als die Liebe“ hatte Schiller sein Verhältnis zu Goethe definierend gesagt. Einem vortrefflichen Buch wie dem Schönes Der Briefschreiber Goethe gegenüber gibt es kein Heilmittel als die Bewunderung, und den Versuch, etwas von der hier aufleuchtenden Humanität im Gespräch mit guten Freunden (und vielleicht auch mal in handschriftlichen Briefen) wachzuhalten. Anmerkungen[1] Man frage sich einmal, wann habe ich zuletzt einen ausführlichen Brief handschriftlich geschrieben? Bei mir war es vor einigen Jahren in einem kleinen Briefwechsel mit Georges Arthur Goldschmidt. Ich hatte ihm nach einer Lesung den Ausdruck eines auf dem PC geschriebenen Briefs geschickt (es ging um das Thema Transzendenz im Nächsten, er hatte gesagt, der Mensch neben ihm in der Metro sei für ihn transzendent, ich stimmte ihm zu und sagte; von Gott reden heiße vom Menschen reden, gute Theologie sei zuallererst Anthropologie), er antwortete in seiner schwer lesbaren Handschrift mit massiver Kirchenkritik, daraufhin ging ich auch zur Handschrift über. Als er dann einmal maschinenschriftlich antwortete mit der Begründung, er sei ja so schwer lesbar, ging ich auch wieder an meinen PC. Ich hüte Goldschmidts drei handschriftlichen Briefe wie einen Schatz. Bereits die Handschrift sagt etwas über den Verfasser aus. Ich bin immer wieder betroffen, wenn ich alte Briefe wiederfinde, einen Brief meines Vaters lese, etwa den bewegenden über den Tod meiner 1957 verstorbenen Mutter an seinen Bruder. Schon seine Handschrift ruft mir das Wesen dieses Mannes, der vor vierzig Jahren starb, schnell in Erinnerung. Ähnlich geht es mir mit einem fürsorglich-ironischen Brief meiner ersten Liebe Gretl. Kürzlich entdeckte ich einen arg pädagogischen Brief an eine Freundin namens Elke, den ich wohl nicht abgeschickt hatte. Aber er war mir noch nach 50 Jahren peinlich. Wenn es dramatisch wurde in meinem Leben, etwa bei Enttäuschungen und Trennungen von Freunden und Freundinnen, schrieb ich mir zuweilen noch mit der Hand den Ärger und die Traurigkeit von der Seele. Ich schreibe auch jetzt noch gerne Briefe, aber als elektronische Post e-mail, die ich mir dann gelegentlich ausdrucke und abhefte. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/97/hjb42.htm |
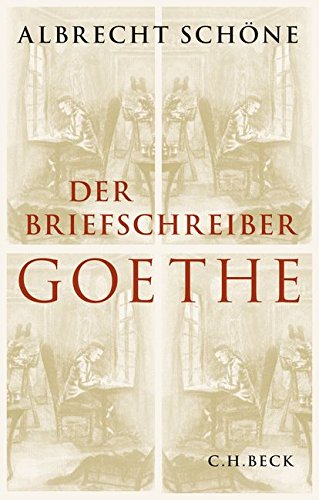 Albrecht Schöne, Der Briefschreiber Goethe, München 2015
Albrecht Schöne, Der Briefschreiber Goethe, München 2015
 Drei Exkurse schließen den Band an - einer widmet sich den Postverhältnissen dieser Zeit und wie sie sich auf Goethes Briefverkehr auswirkten, ein zweiter dem Thema „Diktierte Briefe“ (mit der berühmten Abbildung des diktierenden Geheimraths). Eine außerordentlich differenzierte Analyse (65 Seiten lang!) widmet sich den Anredepronomina, die Goethe in seinen Briefen verwendet. Es dominiert die 3. Pers. Plural, häufig ist auch die 3. Pers Sg., aber wie er dann gelegentlich zum persönlichen Du übergeht, in Goethes Zeit eher die typische Anrede für die Unterschichten, das ist bezeichnend.“ Freund Zelter schreibt ihm am 14. November 1812 vom Selbstmord seines ältesten Sohnes und bittet um „ein heilendes Wort“. Das besteht vor allem darin, dass Goethe das Anredepronomen ändert: „Dein Brief, lieber Freund, der mir das große Unheil meldet, welches deinem Hause widerfahren ist, hat mich sehr bedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über das Leben und ich habe mich nur an dir wieder aufgerichtet.“ Zwischenzeitlich doch wieder das Sie verwendend, schließt der Brief: „Wie sehr wünschte ich mich statt dieses Blatts in deine Nähe.“ Ja, heilende Worte sind nicht wohlfeil zu haben, neben dem sprachlichen Vermögen bedürfen sie einer Haltung der vergegenwärtigenden Nähe.
Drei Exkurse schließen den Band an - einer widmet sich den Postverhältnissen dieser Zeit und wie sie sich auf Goethes Briefverkehr auswirkten, ein zweiter dem Thema „Diktierte Briefe“ (mit der berühmten Abbildung des diktierenden Geheimraths). Eine außerordentlich differenzierte Analyse (65 Seiten lang!) widmet sich den Anredepronomina, die Goethe in seinen Briefen verwendet. Es dominiert die 3. Pers. Plural, häufig ist auch die 3. Pers Sg., aber wie er dann gelegentlich zum persönlichen Du übergeht, in Goethes Zeit eher die typische Anrede für die Unterschichten, das ist bezeichnend.“ Freund Zelter schreibt ihm am 14. November 1812 vom Selbstmord seines ältesten Sohnes und bittet um „ein heilendes Wort“. Das besteht vor allem darin, dass Goethe das Anredepronomen ändert: „Dein Brief, lieber Freund, der mir das große Unheil meldet, welches deinem Hause widerfahren ist, hat mich sehr bedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über das Leben und ich habe mich nur an dir wieder aufgerichtet.“ Zwischenzeitlich doch wieder das Sie verwendend, schließt der Brief: „Wie sehr wünschte ich mich statt dieses Blatts in deine Nähe.“ Ja, heilende Worte sind nicht wohlfeil zu haben, neben dem sprachlichen Vermögen bedürfen sie einer Haltung der vergegenwärtigenden Nähe.