Ein Gespräch mit Fernando Pessoas radikaler Anthropologie
Wolfgang Vögele
1. Spaziergänge in Lissabon
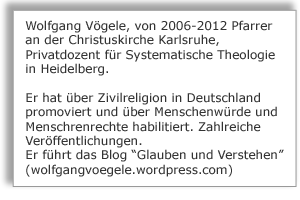 Als ich im späten Frühjahr des Jahres 2015 ein paar Tage in der portugiesischen Hauptstadt verbrachte, entdeckte ich ihn an drei Orten: im berühmten Klosters Belem sein Grab, im Stadtteil Campo de Ourique im Nordwesten sein Museum und vor einem der Kaffeehäuser, die er so sehr gemocht hatte, sein Denkmal. Die Reiseführerin, die uns über die Tage begleitete, kannte seinen Namen, auch sein Grab, denn es lag im Kreuzgang des Klosters Belem, das zum Weltkulturerbe zählt. Aber um mir den Weg zu seinem Museum und zugleich letzten Wohnort zu zeigen, mußte sie im Stadtplan nachschauen.
Als ich im späten Frühjahr des Jahres 2015 ein paar Tage in der portugiesischen Hauptstadt verbrachte, entdeckte ich ihn an drei Orten: im berühmten Klosters Belem sein Grab, im Stadtteil Campo de Ourique im Nordwesten sein Museum und vor einem der Kaffeehäuser, die er so sehr gemocht hatte, sein Denkmal. Die Reiseführerin, die uns über die Tage begleitete, kannte seinen Namen, auch sein Grab, denn es lag im Kreuzgang des Klosters Belem, das zum Weltkulturerbe zählt. Aber um mir den Weg zu seinem Museum und zugleich letzten Wohnort zu zeigen, mußte sie im Stadtplan nachschauen.
Die Portugiesen haben Fernando Pessoas Grab im Jahr 1985 von einem städtischen Friedhof in den berühmten Kreuzgang des Hieronymus-Klosters im Stadtteil Belem umgebettet. Auf einer schlichten, mit Metall verkleideten Sandstein-Stele ist sein Name zu lesen: Fernando Pessoa (1888-1935). Nicht weit weg von der Stele, in der Kirche des Klosters liegt das Grab des portugiesischen Nationaldichters Luis de Camoes.
Zur Vorbereitung der Reise nach Lissabon hatte ich einen zweiten Versuch unternommen hatte, das berühmte „Buch der Unruhe“ zu lesen. Nach dem ersten Blick auf die Grabstele nutzte ich einen freien Vormittag, um das Pessoa-Museum zu besichtigen. Nach dem Frühstück ging ich vom Hotel aus an einer ehemaligen Synagoge vorbei zum Estrela-Park, sah die blühenden Jacaranda-Bäume, warf einen Blick in die Basilica de Estrela, bewunderte die hohe Kuppel und fragte mich von dort weiter in die Wohnviertel hinein, bis zur Rua Coelho da Rocha. In dieser ruhigen Straße liegt die Casa Pessoa, letzter Wohnort des Dichters und seit 1995 ein Museum[1], das seinem Leben und Werk gewidmet ist.
Man sieht das kleine Zimmer, in dem er lebte, die berühmte Truhe, in dem sich nach seinem Tod das ungeordnete Zettelmanuskript des „Buches des Unruhe“ befand, seinen Kleiderständer, an den er seinen abgetragenen schwarzen Anzug hängte, zusammen mit dem verschlissenen weißen Hemd und der schwarzen Krawatte. Man sieht im kleinen Zimmer seines Apartments eine Kommode, ein Bücherregal und eine Schreibmaschine. Er war kein Mensch, der viel Zeit zu Hause verbrachte, er war ein Kaffeehausbesucher und Flaneur.
Im Museum ist ein Porträt Pessoas zu sehen. Es stammt von der Malerin Almeida Negeiros und zeigt den Dichter mit Hut und Fliege, schreibend an einem Tisch im Kaffeehaus sitzend, ein aufgeschlagenes Buch an seiner Seite. Pessoas Lebensraum war die Stadt, in der er spazieren ging, die Passanten beobachtete und seinen Espresso trank.
Das Pessoa-Denkmal entdeckte ich nur zufällig, aus dem Augenwinkel, bei einem Spaziergang durch die Oberstadt, im Stadtteil Chiado. Ich sah den Mann mit Hut vom Bild im Museum an einem Tisch vor einem der Kaffeehäuser. Für einen kurzen Moment war ich verblüfft, aber dann wurde mir klar: Das ist nur ein Denkmal, dieser lebensgroße Mann ist in Bronze gegossen. Wir hatten es eilig, im Vorübergehen sah ich nur seinen Rücken, aber ich erkannte ihn an seinem Hut. Das Denkmal zeigt ihn sitzend an einem Kaffeehaustisch, die Beine übereinander geschlagen, den linken Arm hat er auf dem Tisch abgelegt. Er scheint das bunte Leben um ihn herum zu beobachten, er denkt grübelnd nach. Vielleicht macht er sich Gedanken und Notizen für seinen nächsten Essay. Es verblüfft den vorübergehenden Passanten, dass der Kaffeetisch des Denkmals überhaupt nicht von den übrigen Kaffeehaustischen abgesetzt ist. Der zu Bronze gewordene Schriftsteller sitzt nicht auf einem Sockel oder Podest, das ihn über die gemeine Menge der anderen Kaffeetrinker erhöhen würde.
Grabmal, Denkmal und Museum weisen alle zusammen auf einen der größten europäischen Schriftsteller des beginnenden 20.Jahrhunderts hin. Sein Werk ist schwierig zu erschließen, unzugänglich, denn vor allem sein epochales "Buch der Unruhe" wurde nur in ungeordneten Manuskriptteilen und Zetteln überliefert, die spätere Herausgeber mühsam sortieren mussten. Insgesamt fanden sich in der Kiste 27543 Manuskriptseiten. Wie sollte man diese anordnen? Aber Fragen der Herausgabe, der Editionsprinzipien und der Textkritik sollen hier nicht beschäftigen, ich halte mich an die ins Deutsche übersetzte Ausgabe letzter Hand.[2]
2. Portugiesische Schwierigkeiten

Pessoas Werk und Biographie erinnern in manchem an den Dänen Sören Kierkegaard. Wie dieser hat sich Pessoa dem akademischen und universitären Leben großenteils verweigert. Wie dieser benutzte Pessoa eine Reihe von Pseudonymen. Wie dieser konzentrierte er sich auf Fragmente, kurze apodiktische Texte, oft von nicht mehr als einer Seite Länge. Wie bei Kierkegaard kreisen Pessoas Gedanken häufig um die Frage der Subjektivität des Menschen, um das Ich in all seinen biographischen Verästelungen und sozialen Vernetzungen, um seinen Ort in der Gesellschaft und in der Welt. Trotzdem ist Kopenhagen nicht Lissabon.
Das ist Grund genug, die Liebe zu Portugal und zu seiner Hauptstadt über die Besichtigung der Alt- und der Oberstadt weiter zu treiben durch eine kritische Lektüre des "Buches der Unruhe", das Pessoa unter dem Pseudonym des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares schreiben wollte, aber zu Lebzeiten nie vollendete.
Nach Pessoas Tod entdeckte man in seiner Wohnung jene mittlerweile berühmt gewordene Kiste, in der sich die vielen Texte befanden, aus denen spätere Herausgeber das "Buch der Unruhe" gemacht haben. Über den Hilfsbuchhalter Soares erfahren wir nicht viel, er geht gelangweilt seiner Arbeit als Schreibkraft nach, darin ein Verwandter von Flauberts Pariser Angestelltenpaar Bouvard und Pecuchet, die sich in der Provinz einen Bauernhof kaufen und das enzyklopädische Wissen ihrer Zeit falsch verstehen, und Hermann Melvilles New Yorker Schreiber Bartleby, der es vorzieht, den Anweisungen seines Rechtsanwalts und Bürochefs lieber nicht Folge zu leisten. Aber während Bouvard, Pecuchet und Bartleby nach einiger Zeit ihres Berufes überdrüssig sind, bleibt Soares seiner Amtsstube treu. Pessoa versucht sich nicht an einer Beschreibung der drögen und langweiligen Angestelltenexistenz im Büroalltag, er zielt nicht auf eine Buchhaltung des Alltags. Die ca. 500 Fragmente und Notizen enthalten philosophische Reflexionen über den Tagesablauf, das Leben, die soziale Konstruktion des Ich. Man kann in dem Buchhalter eine einsame, vergrübelte Person sehen, die sich am Leben nicht mehr freuen kann und in eine krankmachende Einsamkeit gefallen ist. Soares, der Buchhalter hat sich völlig auf das Beobachten zurückgezogen. Er nimmt kaum noch am Leben teil, verschließt sich sogar vor ihm. Er verhält sich ganz still, nur um nicht handeln oder ins Leben eingreifen zu müssen.
3. Einzelheit und Verhältnisse

In den Fragmenten des "Buches der Unruhe" versenkt sich Pessoa in sein eigenes Ich. Und damit verläßt Pessoa den vermeintlich festen Boden einer der Grundentscheidungen westeuropäischer Philosophie und Theologie: Der Mensch bestimmt sich nicht allein aus sich selbst heraus, sondern aus seiner Beziehung zu einem Anderen. Damit können eine andere Personen, die Umwelt, die Gesellschaft oder Gott selbst gemeint sein. Man sieht das leicht an der Goldenen Regel und am Gebot der Nächstenliebe, aber auch an Kants Kategorischem Imperativ. Stets wird der einzelne in eine Beziehung hineingesetzt, zu einer Person, zur Gesellschaft, zur Wirklichkeit.
In der Theologie sprach man von einer Relationsontologie im Gegensatz zu einer Substanzontologie. Nur durch seine Verhältnisse zu sich selbst, zu anderen, zur Umwelt und zu Gott findet der Mensch seinen angemessenen Ort in der Welt. Diese Relationsontologie läßt sich sprachtheoretisch, hermeneutisch oder handlungstheoretisch[3] wenden, in keinem Fall bleibt der Mensch allein für sich stehen. Stets ist er eingebettet in Verhältnisse, die man philosophisch und theologisch mitbedenken muß, will man Sprache, Sozialität, Habitusformen, Tugenden oder die Lebenskunst des Menschen angemessen reflektieren.
Jeder noch so radikale Individualismus und Subjektivismus des 19. Jahrhunderts war für irgendein Element der Gemeinschaft oder der Sozialität offen geblieben, auch wenn es in den Überlegungen nur ganz versteckt auftauchte. Wer von dieser von vielen für selbstverständlich erachteten Basis zu Pessoas "Buch der Unruhe" greift, macht die verstörende Erfahrung, daß dieser portugiesische Autor diese selbstverständliche Voraussetzung offensichtlich fallen ließ.
Pessoa macht den Versuch, eine Anthropologie ohne Sozialität zu entwickeln. Ich konnte diese These auch nach der Lektüre des Buches nicht teilen, dennoch öffneten sich im Widerspruch weite Räume faszinierender Reflexion, die das Gespräch lohnen, das Pessoa offensichtlich nie beabsichtigt hat.
Er saß am Tisch des Kaffeehauses und wollte in Ruhe gelassen werden.
4. Rückzug

Jenseits der erlebten sozialen Wirklichkeit befinden sich die weiten Räume des Schlafes, des Traumes, des Tagtraumes und der Grübelei. All das findet Platz in den Notizen. Pessoa, der in Gestalt des Hilfsbuchhalters Notizen sammelt und die Blätter in einer Kiste aufbewahrt, ist auch ein Verwandter und Nachfahre all der philosophischen Essayisten und Tagebuchschreiber von Montaigne über Kierkegaard bis Wittgenstein. Sie alle verweigerten sich System und Ordnung, zogen es vor, ihren Überlegungen in Mosaiksteinen, Fragmenten und Bruchstücken Gestalt zu geben.
Der Hilfsbuchhalter verweigert sich seiner langweiligen Abschreiberei und der Buchhaltung, er verweigert sich der anonymen und melancholischen Stadt, in der er sich durch Kaffeehäuser und Restaurants treiben läßt, und schließlich verweigert er sich der Wirklichkeit überhaupt. Er lebt, um sein Nicht-Leben auszuleben.
Seine Notate und Fragmente offenbaren eine bedrückende und beängstigende Lebensgeschichte. Aber in all diesen Episoden des Buchhalters verbindet sich die Lebensgeschichte mit einer nachhaltigen Reflexion über die Entstehungsbedingungen des Ich. Das macht die unerreichte Größe des „Buches der Unruhe“ aus. In der Betrachtung des einzelnen Menschen, in der Frage nach dem Ursprung von Individualität, nach seiner Bindung an soziale Institutionen wie Familie und Staat, geraten Pessoas Überlegungen zu einer Kritik der Moderne und dem Zwang zur Gesellschaft. Das „Buch der Unruhe“ erweist sich als philosophischer Traktat über Individualität und Selbstwerdung.
Der Buchhalter zieht sich vollständig aus der Welt zurück, mit der Arbeit verdient er nur das unbedingt notwendige Geld. Er pflegt nur die notwendigsten Kontakte mit anderen Menschen. Er handelt nicht, und er schließt keine Freundschaften. Er verliebt sich nicht. Bei ihm dreht sich alles um Schreiben, Schlafen, Träumen und Beobachten. Er richtet sich ein in den Kopfgeburten des eigenen Bewusstseins. Der Buchhalter ist bestimmt von einem großen Misstrauen gegen alles Soziale, denn wenn er sich auf seine Kollegen, Verwandte, Freunde einlassen würde, müsste er Kompromisse eingehen. Er müsste einlenken, beigeben, zurücktreten, und davor scheut er sich. Weltgeschichte kann es in dieser Perspektive nicht geben. Für den Buchhalter Soares strickt jeder nur an seiner eigenen Lebensgeschichte. Sie verläuft in eingedämmten Bahnen: Die Dämme hat das Individuum selbst gebaut. Je höher sie geraten, desto weniger kann es ihnen entkommen.
Wer das erkennt, fällt in ein Loch von Überdruss und Verzweiflung: „Edel ist es, schüchtern zu sein, ruhmreich, nicht handeln zu können, majestätisch, kein Geschick zum Leben zu haben. Nur Überdruß, der Distanzierung ist, und Kunst, die Verachtung, vergolden unsere [Existenz] mit einem Hauch Zufriedenheit. Die Irrlichter, die unsere Fäulnis erzeugt, sind zumindest Licht in unserer Finsternis. " (S. 72) In dieser Passage faßt der Autor sein negatives ästhetisches Credo zusammen. Er verweigert sich der Welt, zieht sich in den Überdruß zurück und versucht, sich dabei auch noch wohl zu fühlen. Was bei anderen Menschen als Depression diagnostiziert wird, erscheint bei dem portugiesischen Schriftsteller plötzlich als erstrebenswertes Lebensideal. Er spricht vom einzig möglichen Weg, sich mit der Unzulänglichkeit des Lebens zurechtzufinden. Der Buchhalter Soares flieht aus Welt und Wirklichkeit: Er reduziert sich in ihr auf einen anwesenden Körper. Ansonsten lebt er in seinen Träumen, Phantasien und Gedanken. Einer der Schlüsselbegriffe dabei ist der Überdruss. Pessoa versteht ihn als „körperliche Empfindung des Chaos, eines Chaos, das alles ist. (...) Wer (...) am Überdruß leidet, fühlt sich gefangen in der wertlosen Freiheit einer unendlichen Zelle." (S. 363).
Jeder Mensch nimmt die Welt wahr und an, jeder Mensch ist von Träumen, Phantasien, Hirngespinsten bestimmt. Es kommt darauf an, wie beides zueinander ins Verhältnis gesetzt wird. Pessoas Sehnsucht nach Weltflucht, Trauer und Einsamkeit befremdet. Und trotzdem lohnt es sich, diesen ästhetischen Habitus einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Der Autor setzt ganz auf Verweigerung und Ablehnung, er findet wie Melvilles Bartleby zu einer Kritik der Geschäftigkeit, der billigen, oberflächlichen Gemeinschaft, der bürokratischen Abarbeitung von "Projekten", der Vernetzungen und Bekanntschaften, der oberflächlichen Kontakte.
Es fällt auf, dass der Buchhalter Soares sich trotzdem nicht wie ein Eremit in die Wüste zurückzieht, sondern er bleibt im Trubel der Stadt wohnen. Aber er hat sich dieser Trubel entfremdet. Soares führt eine bescheidene Existenz als Buchhalter, er besucht bescheidene Straßenrestaurants und Cafés und flaniert durch die Gassen von Alt- und Oberstadt. Pessoa macht die Einsamkeit zum Zustand der Normalität. Er stellt die bürgerlichen Idealvorstellungen von Gemeinschaft, Familie und Gesellschaft auf den Kopf.
Der Buchhalter zieht sich aus dem "Projekt" der Großstadt zurück und beobachtet von außen. Er will sich nicht zum kleinen Zahnrad im großen Getriebe des Urbanen und der Moderne machen lassen. "Wohl denen, die ihr Leben niemandem anvertrauen." (S. 73) Das ist die heldenmütige Seligpreisung der Anti-Moderne, versehen mit einem Hauch von Sarkasmus. Für Pessoa heißt das auch: Er sucht auch keinen Rückhalt im Glauben mehr. Davon später.
5. Amöbe

Wer sich aus Stadt und Beruf zurückzieht, niemandem vertraut, der steigert umgekehrt die Aufmerksamkeit für sich selbst. Er nimmt dauernd Veränderungen wahr: Gefühle, Gedanken, Assoziationen branden hinein ins Bewusstsein und verschwinden genauso schnell wieder. Das Ich ist keine feste Burg, aus der heraus der Burgherr Pläne, Ziele und Handlungen auf den Weg bringt. Es gleicht eher einer Amöbe, von allen Seiten fremden Einflüssen ausgesetzt, sie bewegt sich einmal hierhin, einmal dorthin, sie dehnt sich und zieht sich wieder zusammen, manchmal spaltet sie sich auch. Im nächsten Moment kann schon alles ganz anders aussehen. Dabei geht Pessoa so weit, daß er dem Ich unterschiedliche Persönlichkeiten zuspricht: „Ich erschaffe immerzu Persönlichkeiten. (…) Um erschaffen zu können, habe ich mich zerstört; ich habe mich so sehr in mir selbst veräußerlicht, daß ich nurmehr äußerlich in mir existiere. Ich bin die leere Bühne, auf der verschiedene Schauspieler verschiedene Stücke spielen." (S. 294) Und verschiedenen Schauspieler wurden schließlich zu verschiedenen Pseudonymen, unter deren Namen Pessoa publizierte.
Pessoa war für solche minimalen Veränderungen seines Ich sensibel. Es bewegt sich in der Wirklichkeit wie die Schnecke im Weinberg. Und er war von der Erkenntnis bestimmt, dass Wahrnehmungen, Ziele, Bewegungen, Handlungen des Ichs stets begrenzt sind. Das Ich ist für ihn keine souveräne Person mehr. „Wir schauen, sehen aber nicht. Die lange, von Menschentieren belebte Straße gleich einer Art liegendem Schild mit beweglichen Buchstaben, die keinen Sinn ergeben. Die Häuser sind nur Häuser. Wir sind nicht länger imstande, dem, was wir sehen, einen Sinn beizumessen, doch sehen wir genau, was es ist, das ja." (S. 89) Der gemeinsame Sinn des Sozialen ist verloren gegangen, deswegen wird das gefährdete Ich auf sich selbst zurückgeworfen. Doch dort entdeckt es noch mehr Unsicherheiten als in der Wirklichkeit sozialen Lebens.
Am Anfang des Ich steht der Körper: „Das Übel des Lebens, die Bewußtheit, beginnt mit meinem Körper und verstört mich.“ Der Buchhalter Soares beklagt sich, daß er zur „Berührung“ anderer Menschen gezwungen ist (S. 106). Das klingt am Ende beinahe poetisch und besitzt trotzdem die Kälte und Abgeklärtheit vernünftiger Einsicht in das eigene Selbst. Pessoa verweigert sich dem Sozialen, jedem Einfluß von Wirklichkeit und Gesellschaft, weil er weiß, wie gefährlich ihm diese Einflüsse werden können. Er will sich nicht dem Kalkül aussetzen, entscheiden zu müssen, was er zulässt und was nicht. Er geißelt das Bewusstsein, weil dieses das Selbst verdoppelt und in dieser Verdoppelung eine Arbeit und Aufgabeliegt. Das Ich, das jemand ist, stimmt mit dem Ich, das jemand sein will, nicht überein.
Das Bewusstsein bildet den Raum oder die Oberfläche, in dem sich beides miteinander mischt. Dort entstehen die Brüche und Risse, die den einzelnen gefährden. Wenn der eine Konflikt bewältigt ist, taucht schon der nächste auf. Pessoa leidet nun nicht unter einzelnen dieser Konflikte, sondern er lehnt den Prozess als ganzen ab. „Sich abfinden heißt sich unterwerfen, siegen heißt sich abfinden und somit besiegt werden. Deshalb ist jeder Sieg ein Unding. (...) Es siegt nur, wer nie gewinnt. Stark ist nur, wer nie den Mut verliert. Das Beste und Purpurnste ist der Verzicht." (S. 117) Pessoa entwirft eine Theorie des Nicht-Handelns. Er kehrt alles um, was ihm aus der urbanen Gesellschaft an Forderungen entgegentönt. Er will nicht siegen. Er will keine Macht haben. Er will nicht bewundert werden. Bekanntheit ist ihm ein Gräuel.
Pessoa/Soares verweigert sich, und diese Verweigerung ist das negative Abbild einer positiv begriffenen Wirklichkeit. Andere freuen sich am Sonnenschein, am bescheidenen Wohlstand, an der eigenen Gesundheit - er nicht. Er dreht die Lebenshaltung des Spießbürgers ins Negative.
Leben qualifiziert er trotzdem als etwas Wünschbares. Leben ist Zurücknahme im Gegensatz zum Leben, das über sich selbst hinausstrebt. Es fällt immer wieder die Paradoxie auf: Ihm gelingt es sich als jemanden zu präsentieren, der sich im Gegensatz zu allem gesellschaftlichen Leben inszeniert. Alles reduziert sich auf das Selbst. Das sozialphilosophische, man kann sagen: hegelianische Individuum entdeckt sich selbst im anderen, und deshalb ist philosophisch die Dialektik, im Alltag das Gespräch die Grundlage seiner Wirklichkeitserfahrung. Pessoa gibt diese philosophische Figur auf und setzt an ihre Stelle die reine Beobachtung der eigenen Regungen des Geistes und des Bewusstseins. Damit vollführt er eine Bewegung der Konzentration weg von der Weltläufigkeit hin zur Selbstbeobachtung. Er blickt von der Welt weg in das eigenen Innenleben.
Aber auch dieses wird noch einmal gebrochen: „Ich kenne nichts Größeres, nichts, was einem wahrhaft großen Menschen besser anstünde, als unser uns-nicht-Kennen geduldig und ausdrucksstark zu analysieren und die Unbewußtheit unseres Bewußtseins bewußt aufzuzeichnen, die Metaphysik der autonomen Schatten, die Poesie des Dämmerlichts der Enttäuschung." (S. 154) Pessoa will das Bewusstsein des aufgeklärten Ich preisgeben und im bewusstlosen Unterbewusstsein versinken.
Deswegen verkehren sich für ihn alle herkömmlichen Ordnungen. Diese Verkehrung findet ihren Ausdruck in einer Reihe von Paradoxien: „Wir sind Tod. Was wir als Leben ansehen, ist der Schlaf des wirklichen Lebens, der Tod dessen, was wir wirklich sind. Die Toten werden geboren, sie sterben nicht. Die Welten sind für uns vertauscht. Wenn wir zu leben meinen, sind wir tot; wenn wir sterben, beginnen wir zu leben." (S. 183) Tod und Leben verkehren sich. Der Buchhalter will sich aus der Wirklichkeit heraushalten. Eigentlich ist das ein ganz unmöglicher Gedanke. Niemand kann sich aus dem herausziehen, wofür er für sein Leben angewiesen ist, es sei denn, man hält sich für einen Konstruktivisten, der unterstellt, er lebe sowieso nur in seiner eigenen, subjektiven Wirklichkeit, die von anderen nicht geteilt wird. Pessoa stellt die verachtete Wirklichkeit als eine Belästigung dar.
Aus ihr heraus zieht er sich auf etwas zurück, das er als seine verschattete Subjektivität begreift. Das ist deshalb noch heute interessant, weil diese Überlegungen helfen, das Verhältnis von Individualität und Sozialität zu verstehen. Milieubindung, Habitusformen und kommunikatives Handeln, Kommunitarismus zielen zentripetal auf gemeinsam geteilte Erfahrungen, die einer Wertegemeinschaft gipfeln. Pessoa setzt dem zentrifugal eine eigene Perspektive der Individualität entgegen, die sich durchaus ambivalent als Einzelgängertum, Eigenbrötelei, aber auch als Genialität und Persönlichkeit beschreiben ließe. Es ergibt sich eine Perspektive, bestimmte Formen von Abweichung vom geteilten sozialen Konsens besser zu verstehen: Phänomene wie Demenz im Alter oder psychische Erkrankung zu begreifen als Rückzug aus der mit anderen geteilten Wirklichkeit. Das kranke Individuum flieht in eine eigene (vermeintlich) selbst-bestimmte Welt, mit Voraussetzungen, die von den anderen nicht geteilt werden. Oder es wird, etwa durch Alterungsprozesse, in diese Vereinzelung hineingezwungen. Die Übergänge zwischen Persönlichkeit und Querulantentum, zwischen vorgeblicher Normalität und Krankheit sind hier durchaus weich und gleitend, zumal sich die Betroffenen dieser Veränderungen auch nie in dem Maße bewußt sein werden, wie es Pessoa in seiner philosophischen Reflexion gelingt.
Pessoas literarische und philosophische Größe liegt darin, daß er konsequent zwei Grundentscheidungen verfolgt. 1. Er zieht sich aus der erlebten Wirklichkeit so weit wie möglich zurück, aber da er den Kontakt nicht vollständig abbrechen kann, bleibt das eine vergebliche Anstrengung. 2. Er besitzt eine verblüffende Fähigkeit, diesen Rückzug philosophisch zu reflektieren. So behält er die Distanz und die Balance, die ihn nach dem Rückzug aus der Gesellschaft vor dem endgültigen Absturz bewahrt.
6. Schlaflosigkeit und Träume

Pessoa verfolgt konsequent einen einzigen Erkenntnisweg: Die Wirklichkeit ist ein Alptraum, und die normalen Menschen sind in Wahrheit verrückt. Flucht vor der Wirklichkeit bietet nur der Schlaf. Der Schlaf ist wie eine Pause, und sie unterbricht schlimme Kontinuitäten. Selbstverständlich leidet der Buchhalter Soares unter Schlaflosigkeit, und viele Notizen gleichen deshalb auch Wachträumen: "Ich schlafe nicht. Ich bin zwischen. Bewußtseinsspuren bleiben. Der Schlaf lastet auf mir ohne die Last der Unbewußtheit ... Ich bin nicht. Der Wind ... Ich wache, schlafe wieder ein und habe noch immer nicht geschlafen." (S. 280; vgl. S. 242) Der Schlaf ist für den, der ihn nicht findet, eine Sehnsucht, die sich zum Alptraum auswachsen kann. Das erklärt vieles von Pessoas Weltdistanz und Lebensverweigerung.
Pessoa will nicht verstanden werden - obwohl er all seine Reflexionen auf Blättern notiert, von denen er annehmen muß, daß sie irgendwann gelesen werden. Bevor ihm die Wirklichkeit nahe kommt, flüchtet er sich in den Traum. Der Buchhalter bricht die Beziehungen zu anderen Menschen ab. Er will nicht verstanden werden, weil er sich als isolierte Existenz begreift. Die Reflexionen des "Buches der Unruhe" sind Abfallprodukte eines komplizierten Selbstverständigungsprozesses: Der Buchhalter führt ein Selbstgespräch, das gar nicht mehr auf Kommunikation zielt. Das Gespräch mit anderen Personen führt für den Autor in die Irre: "Wir sehen uns und sehen uns doch nicht. Wir hören einander, und ein jeder vernimmt nur eine Stimme in seinem Innern. Die Worte anderer sind Mißverständnisse unseres Hörens, Schiffbrüche unseres Verstehens." (S. 319) Das ist ein ebenso faszinierender wie unerhörter Gedanke: Menschen sind füreinander unsichtbar. In der Regel kennt niemand die Geschichte, die sich hinter einem Lächeln oder einer Träne, hinter einem freundlichen oder boshaften Wort verbirgt. Um so komplizierter wird es, wenn der Beobachter anfängt, Lächeln oder Tränen zu deuten. Die Deutung wird sich unvermeidlich dem zuneigen, was der Deutende in diese Aussage hineinliest. Jeder hört und sieht, was er sehen und hören will, darum verfängt sich jeder Beobachter und Deuter in Täuschungen. Deswegen flüchtet sich der Buchhalter Soares in den Traum.
Soares ist ein Träumer, der sich in seine inneren Landschaften versenkt; er folgt lieber den Spinnweben seiner Gefühle als sich der harten Wirklichkeit auszusetzen. Man könnte ihn für einen Verrückten, einen Spinner halten, aber was von der Diagnose einer psychiatrischen Krankheit abhält, ist die Bevorzugung vernünftigen philosophischen Kalküls, die er nur sehr selten verläßt. "Ich habe immer nur geträumt. Dies und nur dies ist der Sinn meines Lebens gewesen. Von wirklichem Belang war für mich nur mein inneres Leben. Meine größten Kümmernisse verflogen, wenn ich das Fenster auf die Straße meiner Träume öffnend mich selbst vergaß bei dem, was ich sah." (S. 103) So poetisch das klingen mag: Kann man diesen Weg der Versenkung in das eigene Innere, in die Wolken des eigenen Bewusstseins teilen? Ich bin skeptisch.
Trotzdem fasziniert die Klarheit, mit der Pessoa sich selbst reflektierend auf dem Weg nach innen begleitet. Bei ihm fehlt noch der kleinste Rest des Vertrauens, mit dem sich der eine in Gespräch und Zusammenleben auf die Äußerungen des anderen verlässt. Dieses Vertrauen war ihm abhanden gekommen, und deswegen hat er sich ins Innenleben zurückgezogen. Deswegen kann der Tagträumer Pessoa den eigenen Wünschen ein größeres Gewicht geben, während die Wirktiefe seines Handelns in der Welt nur eine sehr geringe Reichweite besitzt. Soares träumt von Wolken und Landschaften, gelegentlich auf von der Vielfalt der Stadt; und all das ist von größerer Zartheit bestimmt als die harte, unnachgiebige Wirklichkeit in all ihrer Unvorhersehbarkeit. "Nur was wir träumen, sind wir wirklich, denn alles übrige gehört, weil es verwirklicht ist, der Welt und allen Menschen." (S. 334) Nur im Traum verwirklicht sich das Ich, denn nur im Traum lebt, denkt und handelt so, wie es seinen Befürchtungen und Hoffnungen entspricht. Dem ängstlichen Ich drohen Alpträume, dem hoffenden Ich Träume vom Schlaraffenland. Trotzdem hängen, das sei gegen Pessoa gesagt, auch Träume von der Wirklichkeit ab, denn aus ihr gewinnen sie das Material, mit denen das schlafende Bewusstsein nach Maßgabe seiner Stimmungen spielt. Nicht das handelnde Ich des Alltags, sondern das fühlende, unbewusste Es gebietet über den Traum.
Der kaufmännische Angestellte Soares kehrt Alltagsentscheidungen, die selbstverständlich geworden sind, um: Er nimmt die Träume ernster als seine tägliche Lebenswirklichkeit. Er lebt von der Prämisse: Je weniger ich mich der Wirklichkeit aussetze, desto mehr kann ich mein verborgenes Ich ernst nehmen. Beider Verhältnis verschiebt sich zugunsten des verborgenen Ichs. Der Beruf des Buchhalters ist ja doppeldeutig: Am Tag schreibt er Rechnungen und führt Konten, bei Nacht führt der psychologische Buchhalter ein Notizbuch, in dessen Eintragungen er das eigene Ich kartiert und bilanziert.
7. Abschied von der Wirklichkeit?

Über die Brücke von Traum und Tagtraum findet Pessoa den Weg in sein eigenes Ich. Umgekehrt entspricht dem ein Prozeß der Entfremdung von der Wirklichkeit: "Für mich ist das Leben schlicht ein äußeres Bild, das mich einschließt und das ich mir ansehe wie ein Schauspiel ohne Handlung, inszeniert nur, die Augen zu erfreuen." (S. 196) Pessoa will sich von der Wirklichkeit distanzieren, auch deswegen will er sich in das Schreiben flüchten.
Schreiben, Existenz und Wirklichkeit befinden sich bei ihm im Ungleichgewicht. Er treibt seinen Individualismus bis ins äußerste Extrem; sein existentialistischer Lebensplan kann eigentlich nur scheitern. Aber faszinierenderweise liegt darin für den Leser ein philosophischer Erkenntnisgewinn: Pessoa gewinnt seine Originalität daraus, daß seine philosophische, literarische und psychologische Grunddisposition sich im Ungleichgewicht befinden. "Das ist meine Moral oder meine Metaphysik, oder anders gesagt, das bin ich: Einer, der an allem vorübergeht - selbst an meiner eigenen Seele -, ich gehöre zu nichts, ich wünsche nichts, ich bin nichts - abstrakter Mittelpunkt unpersönlicher Wahrnehmungen, zu Boden gefallener, sehender Spiegel, der Vielfalt der Welt zugekehrt. Bei alledem weiß ich nicht, ob ich glücklich oder unglücklich bin; und es ist mir auch einerlei." (S. 213) Pessoa versucht den Gedanken ernst zu nehmen, daß ein Mensch nicht mehr ist als ein verglühender Funke einer Wunderkerze.
Den 'normalen' Menschen, denen er im Alltag begegnet, wirft er vor, ihre Wünsche, Ziele, ihre kleinen Erfolge viel ernster zu nehmen als sie das eigentlich verdienen. Sie leiden unter lieblosen Eltern, bösen Schwiegermüttern, bürokratischen Vorgesetzten und falschen Freunden - und nehmen das zu wichtig. Pessoa vollzieht an dieser Stelle eine radikale Kehrtwende: Er setzt die Abwesenheit von Bedeutung an die Stelle eines Übermaßes an Bedeutung. "Es nötig haben, andere zu beherrschen, heißt andere nötig zu haben. (...) Unsere Bedürfnisse auf ein Minimum herabsetzen, damit wir in nichts von anderen abhängen." (S. 236) Der Rückzug aus der Welt ist für Pessoa ein Weg in die Unabhängigkeit. Er will nicht auf andere Menschen Rücksicht nehmen müssen. Trotzdem bleibt diese Befreiung von der Abhängigkeit von anderen letztlich eine Chimäre. Denn Pessoa wie auch sein alter ego, der Buchhalter, sind auf die kulturelle und ökonomische Nische der Stadt angewiesen. Der Schriftsteller trinkt seinen Espresso im Kaffeehaus. Er kauft Zeitungen und Zigaretten am Kiosk. Er fährt Straßenbahn und flaniert durch die Straßen der Altstadt von Lissabon.
Der Philosoph Pessoa treibt Individuum und Wirklichkeit auseinander. Der Schriftsteller Pessoa findet zu dieser philosophischen Erkenntnis eine Entsprechung in seiner Lust am Paradox: "Wenn ich denke, erscheint mir alles absurd; wenn ich fühle, erscheint mir alles fremd; wenn ich etwas will, will etwas in mir nichts. Wann immer etwas handelt in mir, begreife ich, daß nicht ich es war. Wenn ich träume, ist es, als schreibe man mich. Wenn ich fühle, ist es, als male man mich. Wenn ich will, ist es, als packe man mich auf ein Gefährt wie eine Ware, die man auf den Weg bringt, und ich lasse mich mit einer Bewegung befördern, die ich für meine eigene halte, an ein Ziel, dem ich mich verweigere, bis ich dort bin." (S. 284) Diese, im Zusammenhang wiedergegebene Passage lebt von scharfen Gegensätzen, Paradoxien und Kontrasten. Ich will, sagt Pessoa, das Gegenteil von dem, was ein normaler Mensch im Alltag tun würde.
Er setzt sich von dem ab, was als Normalität zu betrachten wäre. Pessoa verweigert sich dem bewussten geordneten Denken, indem er in Fragmenten - nachdenkt. Von Freud stammt die Bemerkung, dass das Ich gekränkt wurde, weil es nicht mehr Herr im eigenen Haus sei. Pessoa geht darin noch einen Schritt über Freud hinaus, dass er diese kleine Insel des Ich auch noch zertrümmern will. Er radikalisiert die analytische Psychologie zu einer Anthropologie des Nichtseins, der Willenlosigkeit und der Weltverweigerung. An die Stelle von Mensch, Person, Persönlichkeit tritt der gedankenlose Schläfer und Tagträumer.
8. Handeln und Planen

Der Schläfer und Tagträumer handelt nicht mehr. Dem Buchhalter Soares wird die Wirklichkeit zu aufdringlich. Handeln und Wahrnehmen schließen sich für ihn gegenseitig aus. Je mehr sich jemand handelnd ins Geschehen stürzt, desto weniger nimmt er wahr, weil er auf ein bestimmtes Ziel fixiert ist. Wer sich dagegen still und unbeweglich verhält, der nimmt auch die Kleinigkeiten auf, die in Hast, Hektik und Nervosität verloren gehen. Die präzisen Beobachtungen ergeben sich erst aus der Eintönigkeit.
"Im heutigen Leben gehört die Welt einzig den Dummen, den Selbstgefälligen und den Umtriebigen. Das Recht zu leben und zu triumphieren, erwirbt man heute mehr oder minder mit den gleichen Mitteln, mit denen man die Einweisung in ein Irrenhaus erreicht: die Unfähigkeit zu denken, die Unmoral und die Übererregtheit." (S. 182) Die Grenzen zwischen Verrücktheit und Normalität verwischen sich. Erfolg beruht nicht auf Leistung, eher auf einer geschickten Form der Aufschneiderei. Die Aufschneiderei kann in der Psychiatrie oder in einer prächtigen Villa enden, für Pessoa ist das eine vom anderen gar nicht mehr zu unterscheiden.
Das Ich zieht sich aus den Zusammenhängen der Welt zurück, um anderen nicht zu schaden. Es hört auf zu handeln: "Nur in der absoluten Träumerei, in die nichts Aktives eingreift, in der letztlich sogar unser Bewußtsein von uns selbst im Schlamm versinkt - nur dort, in diesem lauen, feuchten Nicht-Sein kann der völlige Verzicht auf alles Handeln erreicht werden. Nicht verstehen wollen, nicht analysieren ... sich sehen wie die Natur; seine Empfindungen betrachten wie eine Landschaft - das ist weise sein." (S. 252) Man könnte das die portugiesische Variante eines philosophischen Buddhismus nennen. Was Pessoa philosophisch vertritt, ist das Gegenteil eines bewussten, aktiven, gestaltenden und reflektierenden Lebens. Da ist noch keine Funke vorhanden von der trainingsbewussten Parole: Du musst dein Leben ändern, welche Peter Sloterdijk vor einigen Jahren verbreitet hat.
Pessoas negativer Anthropologie liegt eine negative Kosmologie zugrunde. Diese Welt ist so geschaffen worden, daß die Menschen in ihr keine Heimat finden können. Diese wissen weder über sich selbst noch über die anderen Bescheid. Gerade diese Unkenntnis hilft zum Überleben, behauptet Pessoa.
9. Beobachtung
An die Stelle von Handeln treten Beobachten und Wahrnehmen. Bernardo Soares pflegt keine Freundschaften, stattdessen beobachtet er. Wer beobachtet, will und kann nicht handeln. Dieser Beobachter beobachtet zuerst sich selbst. Er steigert seine Sensibilität, intensiviert seinen Blick für Details und versucht, sich darauf zu konzentrieren. Die Dinge kommen von außen auf die Seele des Beobachters zu: "Ein Ding sein heißt Gegenstand einer Zuschreibung sein. Vielleicht ist es falsch zu sagen, ein Baum fühlt, ein Fluß fließt, ein Sonnenuntergang ist melancholisch (...). Doch ebenso falsch ist es, Dingen Schönheit zuzuschreiben, Farbe, Form und womöglich sogar Sein. (...) Alles kommt von außen, und die menschliche Seele ist vielleicht nicht mehr als der Sonnenstrahl, der leuchtet und den Misthaufen, der unser Körper ist, vom Boden isoliert." (S. 68f.) Der "Sonnenstrahl der Seele" beleuchtet die Dinge, die dem Individuum auffallen. Und der Buchhalter Soares beobachtet sehr genau, das ja. Er beobachtet die Stadt, die Straßenbahnfahrer, die Spaziergänger und Passanten, die Schuhputzer und die Gemüseverkäufer und die patrouillierenden Polizisten. Aber genau so igelt sich Soares in Träumen und Tagträumen ein und weigert sich herauszukommen.
Aber ist das angemessen? Kann das Ich sein Leben als Gefangener seiner Tagträume führen? Pessoa/Soares versucht das und schreibt wiederholt über Schlaf, Träume und Wolken. Er verweigert sich dem Außen, weil er genug mit sich selbst beschäftigt ist. Er ist gefangen in einem Bild vom Menschen, das in Unbeweglichkeit, Passivität und Tagträumen aufgeht. Er verweigert sich Normalität, Alltag und Routine, weil er sieht, daß das zuletzt nur in den Tod führt. Er beklagt die Vergeblichkeit des Alltags, Leerlauf, Langeweile, die Verschwendung von Zeit und anderen Lebensressourcen. "Zwischen dem Leben und mir ist eine dünne Glasscheibe. So deutlich ich das Leben auch erkenne und verstehe, berühren kann ich es nicht." (S. 91) Pessoa verweigert sich dem Sozialen, dem Alltäglichen, auch dem Politischen, und er steht deshalb allein da, als Säulenheiliger in der Großstadt, als einsamer Wolf in der Menschenmenge. Wieder ein Paradox.
10. Schreiben

Einen Ausweg allerdings lässt Pessoa gelten.
Das Aufschreiben nimmt für ihn einen unbestimmten Druck aus dem Bewusstsein. Was notiert ist, kann abkühlen und vor allem von außen betrachtet werden. Die Handschrift wird zum erkalteten Bleiguß des Bewusstseins. Auf dem Papier entsteht eine bestimmte Ordnung aus Worten und Sätzen. "Sich bewegen heißt leben, sich in Worte fassen heißt überleben. Nichts ist im Leben weniger wirklich, weil es gut beschrieben wurde." (S. 35) Mit Hilfe des Schreibens verarbeitet der Hilfsbuchhalter das Erlebte und intensiviert es damit. Er macht das Gelb der Butterblume zum leuchtenden Gelb, und dieser Vorgang der Verschriftlichung hilft ihm, den Eindruck der gelben Butterblume in der Erinnerung zu behalten und ihn - zweitens - für andere nachvollziehbar zu machen.
Die Menge der Beobachtungen und Träume macht das Schweigen für Pessoa zur Sucht. "Schreiben ist für mich wie die Droge, die ich verabscheue und doch nehme, wie das Laster, das ich verachte und von dem ich nicht lassen kann." (S. 159) Er benötigt das Schreiben als Kompensation von tiefen und verborgenen Wünschen, die aus seinem Inneren aufsteigen und die er nicht richtig in Worte fassen kann.
Drogen sollen einen Menschen vor der riskanten, harten, banalen Wirklichkeit schützen, sie bieten ihm die Möglichkeit einer intensiveren Welterfahrung, ohne sich dafür richtig anstrengen zu müssen. "Und so schreibe ich oft, ohne überhaupt denken zu wollen, in einer Tagträumerei und lasse mich dabei von Worten streicheln wie ein kleines Mädchen auf ihrem Schoß. Sie bilden Sätze ohne Sinn, fließen weich dahin wie fühlbares Wasser, ein selbstvergessener Fluß, dessen Wellen sich vermischen und vergehen, andere und immer andere werden und aufeinander folgen." (S. 261) Das Schreiben bildet eine Art Gegenentwurf zum bewusstlosen, schläfrigen Rückzug aus der Welt. Im Schreiben findet Pessoa diejenige Heimat, welche ihm die Welt verwehrt. Ins Schreiben hinein gleiten seine Wünsche und Sehnsüchte, wobei sehr auffällt, dass in diesem Begehren weder Erotisches noch Religiöses enthalten ist.
Trotzdem will Pessoa/Soares aufgehen in etwas anderem, größerem, das er selbst nicht versteht. Das Ich ist für ihn mit der Krankheit des Bewusstseins geschlagen. Dieses Bewusstsein gleicht einer runden Platte, die der Artist auf einen Ball gelegt hat. Er muss alle seine Künste aufbringen, um sich darauf zu stellen und dann für längere Zeit das Gleichgewicht zu halten. Die Tagebuchform, die Pessoa für seine Notate wählt, ermöglicht es ihm, unterschiedliche, sich widersprechende Behauptungen aufzustellen, die im Grunde nicht zusammenpassen. Zwar ist Soares Buchhalter, aber ein System errichten will er nicht.
Das Schreiben ist zugleich Droge, die süchtig macht, und Medizin, die heilt: "Doch Schreiben beruhigt mich, es wie ein Luftholenkönnen für einen, der Atemnot leidet. (...) Diese Seiten hier sind das Gekritzel meines intellektuellen Unbewußtseins meiner selbst." (S. 329) All die Verweigerung vor dem Leben, die Pessoa/Soares praktiziert, gewinnt im Schreiben ein Abbild, eine Gestalt, die er sich im Nachhinein anschauen kann. Aber er nutzt dieses Abbild nicht, um sich verändern, er belässt es beim Abbilden. Das Schreiben beruhigt ihn, zieht ihn aus dem Leben heraus.
"Wenn ich schreibe, besuche ich mich, feierlich." (S. 330) Der Schreibende besucht den Beobachteten in der Höhle des Ich. Der Schreibende und der Beobachtete sind bei Pessoa ein und dieselbe Person.
11. Glauben

Die anhaltende Entkoppelung von Wirklichkeit und Ich können auch Glaube und Religion nicht aufhalten. Der Tagträumer Soares erwägt Glaube und Metaphysik als Trost, aber er kommt zu einem negativen Ergebnis: „Für mich ist Metaphysik seit jeher eine Form latenten Wahnsinns. Kennten wir die Wahrheit, sähen wir sie, alles übrige ist System und Drumherum." Er findet die Formel von der grundsätzlichen "Unverständlichkeit des Universums" (S. 98) Selbstverständlich sucht Pessoa, der Verweigerer, nach Gott, aber der Suchende verweigert den Sprung in den Glauben. Er verweigert diesen Sprung, weil er sich auf keinen Fall auf etwas stützen möchte, das außerhalb seiner selbst liegt. Genau darum findet er auch keinen Trost in der Religion. Den offenen Weg einer negativen Theologie beschreitet er nicht.
Stattdessen weitet er seine Glaubenskritik auf die philosophische Metaphysik aus: "Erklären heißt nicht glauben. Jede Philosophie ist eine Diplomatie unter dem Signum [...] der Ewigkeit; wie die Diplomatie ist sie eine dem Wesen nach falsche Sache, die nicht als Sache existiert, sondern als etwas ganz und gar Zweckgerichtetes." (S. 214) Das unsichere, nebelhafte Ich und das stahlharte Gehäuse der Wirklichkeit lassen sich nicht miteinander vermitteln. Wer es doch versucht, muss bei Hilfskonstruktionen Zuflucht suchen, und diese nennt Pessoa Diplomatie. Um gute Beziehungen zu erhalten, stellt der Philosoph das Verhältnis von Wirklichkeit und Ich schöner und positiver dar als es sich in Wirklichkeit verhält. Aber wer zu Hilfskonstruktionen Zuflucht nimmt, der täuscht sich hauch. Wer darauf verzichtet, findet nach Pessoa - Freiheit: "Sich nichts unterwerfen, keinem Menschen, keiner Liebe, keiner Idee (...) - dies scheint mir die rechte Befindlichkeit für das geistige, innere Leben von Menschen, die nicht gedankenlos leben können. Angehören bedeutet Banalität. (...) Sein heißt frei sein." (S. 236) Diese Freiheit endet allerdings in einem isolierten Individuum, das sich selbst alle Wege zur Kommunikation mit anderen verstellt. Die Kommunikation mit sich selbst kann den Austausch mit anderen nicht ersetzen.
12. Sand und Wolken

Vom Philosophen Hans Blumenberg kann man lernen, besonders auf die Bilder und Metaphern zu achten, die ein Schriftsteller verwendet. Für das Fremde und für das Ich findet Pessoa das wiederkehrende Bild der Wolken. Sie sind in seinen Notizen genauso präsent wie die Regenwolken über der Oberstadt von Lissabon.
Wolken sind unerreichbar, aber sie lassen sich beobachten. Der Beobachter gerät über seiner Faszination ins Träumen. Wolken wechseln von einem Moment zum anderen ihre Gestalt, ohne dass dem irgendeine Bedeutung zukäme. Wer den Blick in den Himmel in den Himmel richtet, hat sich von der Erde und den Mitmenschen abgewandt.
Zwar ist der Buchhalter Soares, hinter dem der Schriftsteller Pessoa in Deckung geht, auf das Urbane, auf die melancholische Metropole Lissabon angewiesen. Aber diese heimliche Bindung nimmt er nur unbewußt zur Kenntnis, zum Gegenstand seines Nachdenkens macht er sie nicht. Der Buchhalter flieht aus dem Büro, flieht vor der Stadt. Er will für sich selbst sein, frei von allem, was ihn bedrängt. Er will sein wie eine Wolke.
Denn für ihn gilt: "Wolken ... sie sind alles: sich auflösende Höhen, das einzig Wirkliche heute zwischen der nichtigen Erde und dem nicht existenten Himmel; nicht zu beschreibende Fetzen des Überdrusses, den ich ihnen aufzwinge; zu farblosen Drohungen verdichteter Nebel; schmutzige Wattebäusche eines wandlosen Krankenhauses. Wolken ... sie sind wie ich, ein zerstörter Übergang zwischen Himmel und Erde, einem unsichtbaren Impuls folgend, mit oder ohne Donner; weiß erhellend, schwarz verfinsternd; Fiktionen des Zwischenraums und der Abweichung, fern vom Lärm der Erde und doch ohne die Stille des Himmels. Wolken ... Sie ziehen noch immer vorüber, ziehen immerzu vorüber, immer auf ewig; wickeln ihre fahlen Stränge auf und ab, treiben ihre falschen, zerrissenen Himmel wirr und weit auseinander." (S. 209) Wolken werden zum Sinnbild des flüchtigen Ich, werden vom Wind getrieben, sie verdampfen, regnen ab, sie verdecken die Sonne.
Das Bewusstsein des Ich gleicht einer flüchtigen Wolke, meistens sichtbar, aber eben kein Subjekt, das selbst handelt. In einer Wolke drücken sich andere Kräfte aus: Wind, Sonnenlicht, Luftdruck. Aus ihrem Zusammenspiel ergibt sich die flüchtige, volatile Erscheinung einer Wolke. Gleiches gilt für das Ich: In diesem wolkenhaften Ich wirken fremde, unbekannte Kräfte, die das Ich selbst nicht verstehen kann. Ich kann mir Pessoa sehr gut vorstellen, wie er mit seinem Hut, dem abgetragenen Anzug und dem ungebügelten weißen Hemd in einem Straßencafé der Lissabonner Oberstadt sitzt und seine Augen auf den wolkenbedeckten Himmel über dem Tejo richtet. Wolken sind nicht viel mehr als Luft, ebensowenig greifbar wie das Ich und so weit vom Beobachter entfernt, daß er sie nicht greifen kann. Das ist die Pointe des Bildes von den Wolken: Sie sind nicht greifbar. Das Ich, das sich an keiner Gewissheit mehr festmachen kann, wird genauso ungreifbar. „Je länger ich über unsere Fähigkeit zum Irrtum nachdenke, desto deutlicher spüre ich den feinen zerschlagener Gewißheiten durch meine müden Finger rinnen.“ (S. 210)
Pessoa schreibt als Wolkenflüsterer, das ist das eine. Neben den Wolken nutzt Pessoa als zweites Bild den feinen rieselnden Sand. Auch dieses Bild ist mit der Konstruktion des Ich verknüpft: Denn es kann sich nicht mehr mit Gewissheiten verbinden, es kann sich nicht selbst stabilisieren und ist nicht mehr in der Lage, sich schützende Mauern für Rückzug und Gefahrenabwehr zu bauen.
Das Ich ist wie der Sand einer Düne und wie eine Wolke. Die erlebte Wirklichkeit gleicht einer Wolke oder einem Nebel, der sich der genauen Wahrnehmung entzieht. Die alten Sicherheiten sind verloren gegangen: Ich und Wirklichkeit verschwimmen zu unklaren Größen. Subjekt und Objekt sind verschwommen, amorph, nicht richtig zu fassen.
Der Sand der Wirklichkeit rieselt dem hilflosen Ich durch die Finger. Die Schrift, welche einzig solche Beobachtungen und Wahrnehmungen festhalten kann, fixiert Wirklichkeit und Bewusstseinszustände. Aber die aufgeschriebenen Beobachtungen fügen sich nicht mehr zu einem konsistenten Werk zusammen. Nicht umsonst veröffentlichte Pessoa zu Lebzeiten kaum etwas, obwohl er dazu Gelegenheiten gehabt hätte. Erst nach seinem Tod finden sich die ungeordneten Notizzettel des "Buches der Unruhe" in der berühmten Kiste.
13. Gedanken über Grabesruhe

In einer der Notizen heißt es: „Ich ruhe in meinem Leben wie in einem Grab.“ (S. 391) Die Frage mag berechtigt sein: Lohnt sich das Nachdenken über Pessoas pessimistische Anthropologie, vor allem, wenn man die Grundannahme des zerfallenden, isolierten Individuums nicht teilt? Ich selbst bin weiterhin überzeugt, dass Theologie und Philosophie in dem Sinn dialogisch angelegt sein müssen, dass sie auf ein Anderes angelegt sind. Dieses Andere kann man Gott, Mitmensch, Gesellschaft, Wirklichkeit nennen, wie auch immer. Aus Pessoas Pessimismus lässt sich lernen, dass dieses Grundprinzip des Dialogischen in keiner Weise selbstverständlich ist. Vielmehr ist es seinerseits begründungspflichtig, es muss plausibilisiert werden.
Pessoa hat seine schriftstellerische Freude an Kontrasten und Paradoxien. Daraus konstruiert er die bewusst eine radikale Abwendung von der Welt, und das unterscheidet ihn zum Beispiel von der begeisterten Weltoffenheit eines Thomas Wolfe[4] Wolfe, der sich in vollen Zügen auf das Leben einlässt. Pessoa wendet sich konsequent von der Welt ab. Sein Pessimismus und seine Misanthropie sind das Gegenteil von Wolfes Enthusiasmus.
Deutet man Pessoas radikalen Individualismus als melancholische Verweigerung gegenüber jeder Art von Moderne, dann erklärt das mindestens den Erfolg seines Werks und die Bewunderung, die es immer wieder ausgelöst hat. Pessoa sucht den Ausweg aus der Moderne, indem er sich zum zum Ich mit befreit hat. Man wird aber den Eindruck nicht los, daß die Befreiung zum Ich nichts anderes ist als neue Gefangenschaft. Pessoa fesselt sich selbst. Er entkommt dem Verlies nicht mehr, dessen Mauern er selbst gebaut hat.[5] Deswegen atmen seine Reflexionen eine Atmosphäre der Trostlosigkeit, die bei der Lektüre gelegentlich schwer zu ertragen ist. Der Mensch ist dadurch definiert, dass er sich nicht für das Leben eignet. Er ist für Pessoa eine psychologische Fehlkonstruktion. Pessoas Reflexionen zeigen hier doch eine erstaunliche Nähe zur lutherischen Rechtfertigungslehre mit ihrer impliziten pessimistischen Anthropologie, vom Menschen, der sich immer weiter in sich selbst verkehrt und sozusagen immer tiefer in sich hineinfällt. Für Luther war der Mensch Sünder, das zeigte sich an seinem Leiden, seinem Sterben und seinem Tod. Aber Luther konnte seine pessimistische Anthropologie nicht ohne eine Rechtfertigungslehre und Christologie denken. Seine Theologie ist von der Bewegung bestimmt, wie der Sünder zum begnadigten, auf die Erlösung wartenden Menschen werden kann. Eine solche Bewegung findet sich bei Pessoa nicht mehr. Zwar will auch der Buchhalter Soares von der Wirklichkeit erlöst werden. Aber seine Anthropologie ist eine Kreuzestheologie ohne Erlösung.
Man würde Pessoa missverstehen, wenn man in ihm den radikalen Individualisten sähe, der nur mit sich selbst beschäftigt ist. Pointiert heißt es im „Buch der Unruhe“: „Ich schreibe nicht portugiesisch - ich schreibe mich.“ (S. 418) Das ist so ebenso zugespitzt wie unwahr. Denn indem er schreibt, will er gleichzeitig einen Leser überzeugen, einen anderen Leser als sich selbst. Pessoa ist nicht radikaler Individualist, sondern der Anthropologe des radikalen Individualismus. Das macht einen kleinen Unterschied. Denn die Reflexionen des Buchhalters Soares gelten nicht nur diesem selbst, sondern der condition humaine der Moderne. Darin liegt Pessoas bleibende Bedeutung.
Und nicht zuletzt: Pessoas Überlegungen lohnen die Lektüre als ein Gegenmittel zum allgegenwärtigen Zwang zur Sozialität und Mitteilung. Wenn über facebook, Twitter und Whatsapp jede private Kleinigkeit öffentlich gemacht wird, hat das Folgen für das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, für Individualität und soziale Habitusformen. Darüber wäre weiter nachzudenken.[6]
Doch davon hat Pessoa in den zwanziger Jahren noch nichts geahnt.
14. Kunstwolken

Pessoa war nicht der einzige Wolkenflüsterer der europäischen Kulturgeschichte. Man könnte auch an den Maler Claude Monet[7] denken, den Maler des Augenblicks, des Flüchtigen und Momenthaften. Das Unbeständige wollte er darstellen, er interessierte sich nicht für das Harte, Feste, Monumentale, das Pathetisch-Historische, sondern für den Augenblick, die vorüberziehenden Wolken und die Lichtreflexe auf dem sich kräuselnden Wasser. Monet und Pessoa teilen das Interesse für den flüchtigen Augenblick: Monet malt ihn, Pessoa reflektiert ihn.
Am Ende sei auf ein Projekt verwiesen, das nochmals einen eigenen Zugang zu den Wolken findet. Im Karlsruher Zentrum für Kunst- und Medientechnologie war im September 2015 in zwei Lichthöfen die Installation „Cloudscapes“[8] zu sehen. Der japanische Architekt Tetsuo Kondo klimatisierte die beiden Lichthöfe so, dass im Raum künstliche Wolken erzeugt werden konnten. Über Rampen und Treppen konnten die Besucher verschiedene Plattformen erreichen, von denen aus sie die Wolken von oben, unten und von der Seite betrachten konnten. Die künstlich erzeugte, ‚natürliche‘ Wolke tritt an die Stelle der gemalten oder beschriebenen Wolke. Man kann sich darüber mokieren, weil Schäfchenwolken am fernen Horizont doch schöner und eindrücklicher aussehen als die dünnen Wölkchen in der Halle der ehemaligen Waffenfabrik.
Trotzdem wirkt die Installation gerade in ihrem Anspruch technischer Machbarkeit wie ein verspäteter Kommentar zu Pessoas Wolkenenthusiasmus. Wenn ein Architekt Wolken basteln kann, können Menschen dann auch am Ich basteln?
Anmerkungen
[2] Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, Frankfurt 2012 (5.Aufl.). Alle Zitate im Text beziehen sich auf diese Ausgabe.
[3] Man denke in der Soziologie an so unterschiedliche Entwürfe wie Pierre Bourdieus Habitustheorie, an George Herbert Meads Sozialphilosophie, an Thomas Luckmanns und Peter Bergers Überlegungen zur gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit und an die Theorie kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas. In der Theologie wurde der Begriff der Relationsontologie von so unterschiedlichen Theologen wie Gerhard Ebeling, Eberhard Jüngel und Dietrich Korsch aufgenommen.
[5] An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß gegenwärtig in Heidelberg ein Projekt im Entstehen begriffen ist, das ein Tage- oder Notizbuch des psychisch kranken Schneidergesellen Hermann Paterna, der um die Wende zum 20. Jahrhundert lebte, dokumentieren und interpretieren wird. Paterna gehört zu den Patienten, deren Werke innerhalb der Sammlung Prinzhorn und ihrem Museum (http://prinzhorn.ukl-hd.de) aufbewahrt werden. Auch Paternas Notizen zeigen, wenn auch auf einem völlig anderen Niveau als die philosophischen Notate Pessoas, die bekannten Motive von der Verweigerung gegenüber der Moderne, dem Versuch, eine individuelle Lebensgeschichte gegen Einwände von außen zu verteidigen und des Rückzugs in eine eigene verschlossene Welt, die anderen Menschen nicht mehr zugänglich ist.
[6] Andeutungen dazu finden sich zum Beispiel bei Botho Strauß, der vor einigen Jahren die Kategorie des Unwissenden, des Nicht-Informierten, des Toren und des Idioten wiederbelebt hat. Vgl. Botho Strauß, Lichter des Toren: Der Idiot und seine Zeit, München 2013.

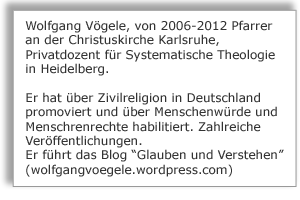 Als ich im späten Frühjahr des Jahres 2015 ein paar Tage in der portugiesischen Hauptstadt verbrachte, entdeckte ich ihn an drei Orten: im berühmten Klosters Belem sein Grab, im Stadtteil Campo de Ourique im Nordwesten sein Museum und vor einem der Kaffeehäuser, die er so sehr gemocht hatte, sein Denkmal. Die Reiseführerin, die uns über die Tage begleitete, kannte seinen Namen, auch sein Grab, denn es lag im Kreuzgang des Klosters Belem, das zum Weltkulturerbe zählt. Aber um mir den Weg zu seinem Museum und zugleich letzten Wohnort zu zeigen, mußte sie im Stadtplan nachschauen.
Als ich im späten Frühjahr des Jahres 2015 ein paar Tage in der portugiesischen Hauptstadt verbrachte, entdeckte ich ihn an drei Orten: im berühmten Klosters Belem sein Grab, im Stadtteil Campo de Ourique im Nordwesten sein Museum und vor einem der Kaffeehäuser, die er so sehr gemocht hatte, sein Denkmal. Die Reiseführerin, die uns über die Tage begleitete, kannte seinen Namen, auch sein Grab, denn es lag im Kreuzgang des Klosters Belem, das zum Weltkulturerbe zählt. Aber um mir den Weg zu seinem Museum und zugleich letzten Wohnort zu zeigen, mußte sie im Stadtplan nachschauen.










