
documenta 14 |
Where are we now?Begegnungen mit einigen Kunstwerken der Skulptur Projekte 2017Karin Wendt
Sie wollen nicht ausstellen, sie wollen keinen goldenen Rahmen, keine ausgeleuchtete Bühne, keine falschen News, sie wollen keine vordergründige Aufmerksamkeit: It‘s been a bad day, please don‘t take a picture. Das heißt nicht, dass Künstler heute keine Bühne bespielen, keine Show zeigen, keine Plattform besetzen, es heißt nicht, dass sie auf Gesten oder Inszenierung verzichten. Aber es sind eher Gesten, wie sie ein Gespräch begleiten, einladend oder indirekt, Winke vielleicht, aber keine ostentativen Gesten. Bei den diesjährigen Skulptur Projekten ist es, als solle man die Kunstwerke nicht aufsuchen, sondern von ihnen gefunden werden, eher zufällig auf sie stoßen, ihnen begegnen oder vielleicht zunächst sogar an ihnen vorbeigehen und erst beim zweiten Hinsehen oder Hinhören überhaupt realisieren, dass es sich um einen künstlerischen Beitrag handelt. Es ist, als würde die Kunst uns bitten, nach ihr zu schauen. Schauen wir also. Dieser Grundhaltung folgt auch die zurückhaltende Kunstvermittlung im Stadtraum. Graffitis auf der Straße zeigen an, dass sich in der Nähe ein Projekt befindet – was nicht bedeutet, dass man die Arbeit auch bald darauf findet; vor Ort lediglich ein einfaches Schild mit den Werkdaten (für weitergehende Infos braucht man die App). Zugleich gibt es jedoch einen kunstpädagogischen Schwerpunkt mit kostenlosen öffentlichen Führungen und Workshops zu einzelnen Projekten. Begleitend gibt es öffentliche Vorträge, die Blumenberg Lectures, und im Freihaus finden Buchpräsentationen und Künstlergespräche statt. Für freie Treffen ohne Programm ist dagegen explizit kein Raum reserviert. Es gibt nur zwei provisorische Cafés (an der ehemaligen Eissporthalle – empfehlenswert! und kurz vor der Promenade das TrafoLab) – letzteres ist zwar konsequent, wenn man einen Eventcharakter vermeiden will, aber natürlich auch ein wenig schade, weil sich kaum wirklich offene Treffpunkte ausbilden, so wie 1997 die Freiluftbar von Rehberger auf der Terrasse des H1.[1] Die Zeiten sind andere. Als Versuch, unser ästhetisches Urteil herauszufordern, indem es für eine Weile vielleicht sogar überfordert wird, deute ich die kuratorische Entscheidung, die Schauseite des Landesmuseums recht dicht zu bespielen. Als man im Zuge des Neubaus das LWL-Logo in großen Lettern direkt auf der Fassaden-Lichtarbeit von Otto Piene anbrachte, wurde daraus Dekoration. Diese anästhetische Maßnahme pariert man nun mit einer Overdose ganz unterschiedlicher und für sich pointierter Arbeiten (Bonin-Burr, Knight, Sany). Die ganze Ironie der „Wasserwaage“, die John Knight an die Nordfassade des Museum montiert, begreift man, wenn man bei Wikipedia auf das sogenannte Münster-Barometer stößt, eine zweijährliche Meinungsumfrage vom Institut für Soziologie der Westfälischen Wilhelms-Universität in Zusammenarbeit mit den Westfälischen Nachrichten, das „die Fassade des Landesmuseums mit einer Durchschnittsnote von 2,38 bewertet, was zugleich die beste Bewertung unter den Neubauten Münsters darstelle“. Man kann sich natürlich nun fragen, ob damit nicht alles zur Dekoration wird oder ob sich die Dinge gegenseitig freisetzen, ob die Dichte also dissoziierend wirkt. Die Karikaturen zum Kunstbetrieb von Sany (Samuel Nyholm), die sich im Stadtgebiet verteilt an Häuserwänden finden, wirken rough and ugly und damit im geputzten Münster in jedem Fall befreiend befremdlich.
Dass sich im Vergleich zu den vergangenen Ausstellungen relativ viele Arbeiten im und um das Landesmuseum herum finden, lese ich als Hinweis, unser Augenmerk auf den eigentlichen Zweck eines solchen Ortes zu richten, nämlich Kunst zu zeigen – die Stadt sollte ihren Neubau nicht feiern als neues Prestige- und Marketingobjekt; wir sollten ein Museum nicht verkommen lassen, indem wir es vorrangig als Eventraum bespielen, sondern wir sollten es als Freiraum und Schutzraum wahrnehmen, um unseren Sinn und unsere Sinne für das Vielfältige, Widersprüchliche, das Offene wachzuhalten. So depotenziert die Klang- und Videoinstallation von Nora Schultz die Erhabenheit der hohen Eingangshalle, die ja „der Kunst als Eingangstor dienen“ soll, wie sie in einem Vortrag zu ihrer Arbeit erklärt. Der Steinfußboden wurde mittig mit Teppich ausgelegt, so dass der Klang besser zur Geltung kommt. Auf der Treppe platziert die Künstlerin frei eine wunderbare Stahlzeichnung von Olle Baertling, „YZl“, die sonst in Marl auf einem Stahlsockel steht. Ein Video, hoch oben an die Wand projiziert, zeigt den wandernden Blick einer Drohne, die mit kurzen Chaosflügen durch die Halle geflogen ist. So folgen wir, den Blick nach oben gerichtet, dem wandernden Blick nach unten auf einen Fußbodenbereich. Plötzlich hat alles eine neue Richtung und eine andere Qualität. Cosima von Bonin und Tom BurrEin Statement ist die Arbeit „Bonin-Benz-Burr“, die Platzierung eines Kunsttransporters vor dem Landesmuseum. Wenn man von der Aegidiistraße kommt, verdeckt sie den Blick auf eine Skulptur von Henry Moore, die im Rahmen der parallel stattfindenden Einzelausstellung „Henry Moore – Impuls für Europa“ dort steht und die, wenn man kritisch ist, dort im Wesentlichen dekorative Wirkung entfaltet.[3] Eine ironische Geste also, dekonstruktiv im besten Sinne. Mir gefallen aber auch die formalen Korrespondenzen der Transportkiste zum verdunkelten Fenster in der Museumsfassade. Lustig ist es, wenn vormittags die vielen Lieferwagen vor dem Museumsrestaurant parken und man nicht mehr entscheiden kann, welcher denn nun das Kunstwerk ist. Wie wir unsere Lebensräume zuparken und eigentlich gar nicht sehen, dass wir dem Auto – selbst in der Stadt, die sich selbst „Fahrradstadt“ lobt – nach wie vor den Vorzug geben, gehört wahrscheinlich nicht zur engeren künstlerischen Intention, es kommt einem aber leicht in den Sinn, wie vieles andere, was im Kontext Logistik und Urbanität anzusiedeln wäre – es ist einfach eine unglaublich coole Arbeit. Gregor Schneider | Oscar Tuazon | Christian OdzuckViele der Künstler nutzen abgelegene Orte: Brachen am Stadtrand, Abrissgelände, einen Keller oder einen Schrebergarten, den Friedhof, Gewerberäume oder die Straße als Transitraum. Manchmal geht die Anverwandlung an die Umgebung so weit, dass man so etwas wie ästhetische Differenz kaum mehr wahrnehmen kann – wie bei der Arbeit „Burn the Formwork“ von Oscar Tuazon: Der Minimalismus ist so sehr modernes Integral geworden, dass die Form sich sozusagen selbst verbrennt. Diese Arbeit, die man schnell übersehen kann, weil sie scheinbar schon immer dort am alten Düker stand, ist interessanter als man zunächst vielleicht meinen könnte, nicht zuletzt wegen ihrer Referenzen (und Differenzen) zum Werk von Donald Judd. Der Raum des Ästhetischen ist kein Raum neben anderen, sondern die Erfahrung seiner Möglichkeiten. Diese Erfahrung setzt uns frei. Wir bemerken, woran wir Räume erkennen, wie wir sie betreten und in ihnen agieren, was wir erwarten und was ausschließen. Künstlerisch geht es darum, Ambivalenzen herauszuarbeiten, nicht sofort sichtbare Qualitäten, Widersprüche oder Risse freizulegen und erfahrbar zu machen. So ist das fragmentierte Gebäude von Christian Odzuck als Rückbau aus der Erinnerung an die erst kürzlich abgerissene Oberfinanzdirektion gut zu lesen. In dieser Hinsicht passt auch die Arbeit von Gregor Schneider im Landesmuseum in den Kontext einer Ausstellung, die explizit das Verhältnis von öffentlichem und privatem Raum erforschen will. In den Räumen der Wechselausstellungen hat er die Wohnung von „N. Schmidt, Pferdegasse 19“ nachgebaut. Man muss klingeln, darf nur einzeln hinein und geht durch eine beklemmende Flucht aus Flur, Wohn-, Schlaf- und Badezimmer, deren wahre Ausmaße man nicht eruieren kann. Tritt man hinaus, steht man wieder vor der Eingangstür. So stellt sich die Frage nach der Intimität[4] von Räumen, seien sie privat oder öffentlich. Was ist innen und was außen? Was ist ein Lebens-Raum? Ayse ErkmenFür nicht so gelungen zumindest in der Umsetzung halte ich die Arbeit „On water“ von Ayşe Erkmen. Sie entfaltet nicht den Zauber oder die Magie, die man sich vom Bild des „Gehens über Wasser“ erhofft. Da der Steg im Kanal tiefer liegt, taucht man mit den Beinen relativ weit ein und es sieht nicht so aus, als geschehe dort etwas eigentlich Unmögliches. Von weitem habe ich den Eindruck eine Art Bildbearbeitung zu sehen. Ist man direkt am Steg, wirkt es eher etwas mühselig. Erst Schuhe ausziehen, dann vorsichtig durchs Wasser staksen, den Blick argwöhnisch nach rechts und links. Ich hatte nicht einmal Lust dazu, zu umständlich, fast lächerlich die ganze Situation, zumal inzwischen zur Hafenseite durch ein Gitter abgesperrt. So kommt es eben auch nicht zur intendierten Erfahrung der beiden so unterschiedlich charakterisierten Hafenufer: Cafés, Bistros, Restaurants und Trendfirmen auf der einen Seite, Industrie und Off-Szene auf der anderen Seite. Vielleicht vergleicht man in Gedanken auch mit Christos „Floating Piers“ (2016), wo das Feld der Passage zum eigentlichen Bild wurde. Auf jeden Fall denkt man in Münster statt an rites de passage eher an Wassertreten a la Kneipp. Performative praticesRecht viele Beiträge zählen zu den performative practices, also in den Bereich Tanz, Performance, Workshop oder Streetwork. Elena Martinique schreibt dazu:„Since the body is disappearing in the digital sphere, this makes it somenthing deserving of special attention.“[5] Für den Besucher der Aufführungen entstehen so begrenzte Unterbrechungen, Auszeiten innerhalb des eigenen Parcours. Die Live Artists Xavier le Roy und Scarlet Yu setzen auf Zeit, indem sie Workshops anbieten, zu denen man sich melden kann. Die Teilnehmer entwickeln dann mit den Künstlern Bewegungen, um eine Skulptur zu performen. Dann geht es um den vergänglichen Zufallsmoment einer Begegnung mit Passanten. Die Teilnehmer des Workshops sprechen diese an und führen ihre „Skulptur“ vor. Dazu gehört auf beiden Seiten viel Bereitschaft, sich auf das künstlerische Spiel einzulassen. Mir ist bis jetzt niemand aus den Workshops begegnet, ich habe selbst aber auch noch an keinem Workshop teilgenommen. Stimmig in der Ortswahl, eindringlich und sich selbst auslegend ist die Performance „Leaking territories“ von Alexandra Pirici im Friedenssaal des Rathauses, wo der Westfälische Frieden geschlossen wurde. An diesem historisch, symbolisch und touristisch gesättigten Ort performen Tänzer wie lebendige Suchmaschinen in Interaktion mit den Besuchern, was die gegenwärtige (politische) Realität bestimmt. Im Theater im Pumpenhaus reinszeniert das Duo Gintersdorfer/Klaßen Teile aus älteren Stücken („Body Politics“) und zeigt Ergebnisse ihrer Proben zur aktuellen Produktion „Kabuiki noir“, eine freie Aneignung des traditionellen japanischen Tanzes. Das war kurzweilig, ist aber in meiner Erinnerung auch relativ schnell wieder verblasst. Nicht mal interessant im Sinne einer Trendforschung finde ich das Tattoo-Studio von Michael Smith, wo man sich Künstler-Tattoos stechen lassen kann. Eine solches Angebot gab es zudem schon sehr viel früher: das Projekt „Slovak Art for Free“[6] im slovakischen Pavillon auf der Venedig Biennale 1999. In Münster werden nun ausdrücklich nur Menschen gefragt, die über 65 Jahre alt sind. Wenn das gegen Altersdiskriminierung sein soll – ist es nicht eigentlich genau das, nämlich diskriminierend für alle, die nicht mehr jung sind? Zu eindimensional ist mir auch die Arbeit „Speak tho the Earth and it Will Tell You (2007-2017)“ von Jeremy Deller. Sind die ausgestellten 50 Folianten, die 10 Jahre Schrebergarten-Vereinsleben dokumentieren, etwas anderes als ein riesiger Fund von Familienalben oder Super 8 Filmen – und damit nicht eigentlich langweilig!? Das Projekt erinnert mich zudem an eine der Öffentlichen Interventionen des Künstlers Christian Hasucha und fällt im Vergleich dazu deutlich schwächer aus. Bei „Leben in Münster“[7] bat Hasucha Bewohner von Siedlungshäusern am Hermannstadtweg drei Wochen lang Tagebuch zu führen. Diese wurden dann jeweils in einen Einband aus Edelstahl integriert und die „Intarsie“ erst nach 10 Jahren an die Bewohner / Schreiber zurückgegeben. Das ist tatsächlich partizipatorische Kunst. Und hier wurde tatsächlich so etwas wie Zeit inkorporiert. Aber vielleicht geht es Deller auch eher um die romantische Situation einer „Bibliothek in der Laube“ und weniger um die, die daran geschrieben haben.
Nicole EisenmanDie Arbeit „Sketch for a Fountain“ von Nicole Eisenman lädt augenzwinkernd zur Muße ein. Das Figurenensemble um einen rechteckigen Brunnen zitiert andeutungsweise und humorvoll Figuren, Haltungen und Gesten im Zusammenhang mit Brunnenszenen aus der Geschichte der Kunst von der Renaissance bis heute. Eine schöne, fast klassische Arbeit, die leider schon in den ersten Wochen Opfer von Vandalismus wurde. Eisenman hat sich entschieden, die enthauptete Figur nur soweit zu restaurieren, dass die Bruchstelle stabilisiert ist. Pierre HuygheZum Projekt „After Alife Ahead“ von Pierre Huyghe heißt es:
„Alife“ kann einfach heißen „a life“ (ein Leben), „artificial life“ (künstliches Leben) oder „A-Life“ (1A Leben, also das bessere Leben). Huyghe schaut also, wie es nach dem (künstlichen, besseren, eigentlichen) Leben weitergeht. Licht und Regen, die durch eine sich zeitweise öffnende Schleuse eindringen, verändern und beleben die semikünstliche Landschaft, in der unter anderem Bienenstöcke, Algen und Bakterien ausgesetzt wurden. Die anfänglich auch untergebrachten Pfauen wurden schnell wieder entnommen. Das wäre auf längere Zeit tatsächlich Tierquälerei gewesen, oder es war anfangs an ein auch für diese Tiere geeignetes Biotop mit Grün und Licht gedacht. Ein kleines Aquarium auf einem Hügel in der Mitte des Geländes wiederholt das (Lebens-) Ei ArakawaDie Arbeit „Harsh Citation, Harsh Pastoral“ von Ei Arakawa auf der Wiese vor dem Haus Kump, in dem heute die Handwerkskammer ein Ausbildungszentrum hat, lohnt einen Besuch besonders bei Anbruch der Dämmerung, weil dann die digitalen Nachbilder auf der Wiese unscharf zu leuchten beginnen. Dann wird aus den harschen Zitaten berühmter Gemälde wirklich eine Pastorale. Dann entfaltet die Installation den poetischen (Erinnerungs-)Zauber der sogenannten blauen Stunde, wenn das Licht zum Arbeiten nicht mehr ausreicht, es aber zum Schlafengehen noch zu hell ist. Dann kommt der Mensch zur Ruhe und erinnert sich an den Tag, an das, was gewesen ist, während es um ihn herum langsam dunkel wird. Justin MatherlyDie Promenade in Münster ist ein Grüngürtel, der sich als Ring für Fußgänger und Radfahrer um den Innenstadtbereich schließt. Auf der Seite hin zum Bahnhofsviertel steht „Nietzsches Rock“ (Nietzsches Felsen) von Justin Matherly. Es ist ein gelungenes Sinnbild dafür, dass das Denken der Natur des Menschen die Kategorie „Natur“ selbst sprengt: Beginnt man über das Wesen des Menschen nachzudenken, wie es Friedrich Nietzsche getan hat, sieht diese von weitem gewaltig und unveränderlich aus wie ein gewachsener Felsen. Schaut man näher, erweist sie sich aber als nicht mit der Erde verbunden, gebaut aus Leichtbeton, mit einer rissigen Verschalung über einem chaotischen Gerüst im Innern. Das ist, finde ich, eine überzeugende Visualisierung im Sinne von Skulptur als Freilegung von etwas vordem nicht Sichtbaren. Die Anekdote, die von Guides kolportiert wird, dass Nietzsche an einem bestimmten Fels in Sils-Maria wichtige philosophische Eingebungen hatte, woran eine dort angebrachte Gedenktafel erinnern soll, lenkt von der künstlerischen Idee eher ab. Was wir sehen, ist das Simulacrum eines Felsen, der mit Nietzsches Namen verbunden wird. Von da aus kann man – wenn man will – in viele Richtungen weiterdenken. Lara FavarettoDie über vier Meter hohe, innen hohle monolithische Granitskulptur „Momentary Monument – The Stone“ von Lara Favaretto aus ihrer Serie „Momentary Monuments“ (seit 2009) finde ich schön; auch die Idee, in Marl ein korrespondierendes Monument zu errichten. Favaretto spielt mit der Ambivalenz aus gewachsenem Stein und geformtem Material. Blickt man um sich, fallen recht bald die formalen Korrespondenzen zum einem nicht weit entfernten Denkmal auf, dem sogenannten Train-Denkmal aus den 20er Jahren. Nun genügt es aber offenbar nicht, die daraus entstehenden Fragen stehen zu lassen. Etwa: Wessen gedenkt das Train-Denkmal? Was verbindet und was unterscheidet beide Monumente? Hat die Bearbeitung bei Favaretto, insbesondere die schmale auf Augenhöhe angebrachte Öffnung eine Funktion? Woher stammt das Material, unter welchen Bedingungen wurde es gehauen, transportiert etc.? Soll hier auch einer Sache gedacht oder gar jemand verehrt werden? Nein, diese Fragen genügen der Künstlerin nicht. Denn sie liefert eine Erklärung zu ihrer Arbeit: Der rechteckige Schlitz in der Skulptur ist dazu gedacht, Geld einzuwerfen, mit dem dann eine gegenüber liegenden Ausländerbehörde untergebrachte Flüchtlingshilfe unterstützt werden soll. Diese Funktionalisierung der Skulptur – zumindest empfinde ich das so – macht das Kunstwerk klein. Und worin besteht der formale(!) Bezug zur Ausländerbehörde? Er ist lediglich – symbolisch – gesetzt. Die Skulptur Projekte schreiben dazu:
Wenn es um die sozialpolitische Erweiterung und um den Gedanken der Spende gehen soll, warum dann nicht die Skulptur im Nachhinein versteigern und den Erlös stiften? Warum muss das soziale Engagement so krampfhaft in die Skulptur eingetragen werden? Es ist, als würde die Künstlerin selbst ihre Arbeit auf die eine Interpretation festlegen, damit alles „richtig“ – also symbolisch(!) – verstanden wird. In der Bevölkerung heißt das Kunstwerk auch bereits nur noch „Spardose“. Dabei ist es doch so, wie Andreas Mertin an anderer Stelle schreibt: Auch „der Versuch, eine einmal erarbeitete Deutung eines Kunstwerks als ‚die‘ Bedeutung zu fixieren, verfehlt den Sinn der Kunst; jede Bemühung, eine Auslegung verbindlich zu machen, tut dem Kunstwerk Gewalt an“.[8] Aram BartollSeit jeher versammeln sich Menschen um Feuerstellen und beginnen irgendwann, sich Geschichten zu erzählen. Das ist auch bei den Skulptur Projekten so. Aram Bartoll hat in der Stadt an drei Stellen Feuer gemacht. Dieses Feuer dient jeweils dazu, mithilfe thermoelektrischer Module Strom zu erzeugen; einmal um ein lokales Netzwerk zu betreiben (am ehemaligen Fernmeldeturm), dann um Handys zu laden (auf der kleinen Wiese vor dem Theater im Pumpenhaus) und für das Licht von Kronleuchtern in einer Unterführung am Schlossplatz. Vor allem am Pumpenhaus entsteht eine Situation, die archaisch und futuristisch zugleich anmutet. Holzscheite im Hintergrund. Am Lagerfeuer ein Guide, der die Stange mit dem Lademodul ins offene Feuer hält; am oberen Ende die Halterung für das Handy. Er erklärt mir, wie die Differenz zwischen Wärme und Kälte sich im Handy entlädt und so den Akku lädt (so in etwa habe ich es verstanden…) Ich höre zu, und es ist für einen Moment, als würde ich zugleich an den Anfang der Menschheitsgeschichte und in ihre Zukunft schauen. Plötzlich versteht man, dass es letztlich schon immer – und auch in Zukunft – nur darum geht: miteinander zu reden. Es ist wie ein (Strom)-Kreislauf, sein einziger Sinn liegt darin nicht abzubrechen. Shaina Anand und Ashok SukumaranBei meinem Besuch im „Camp“ von Shaina Anand und Ashok Sukumaran auf der Terrasse des Stadttheaters war ich zuerst sehr angetan. Das Zugleich von Bild, Video, Klang und Interaktion schafft eine lebendige Situation, bindet alle, die da sind, wie selbstverständlich ein. Es wirkt einfach zeitgenössisch. Im Video erfahre ich etwas vom Bau und der Geschichte des Theaters, ich kann die Glocke der Kirche nahe dem Theater zum Läuten bringen, ich sehe im Fenster eines benachbarten Wohnhauses eine Frau ans Fenster treten, die Schilder mit humanitären Botschaften hochhält und scheinbar Kontakt mit mir aufzunehmen versucht. Im Rückblick bin ich aber kritischer und denke, ob es nicht doch nur eine beliebige Verknüpfung von Medien und Inhalten ist, die sich mehr oder weniger mit dem Ort, seiner Ästhetik und seiner Geschichte verknüpfen lassen – mit anderenWorten: Die Frage ist, ob ich, wie Lyotard es nannte, unterschiedliche Intensitäten wahrnehme, oder ob es letztlich doch nur Erlebnispädagogik ist. Hreinn FriðfinnssonFast romantisch im Sinne der Frühaufklärung ist die Arbeit von Hreinn Friðfinnsson im Sternbuschpark. Der Park grenzt an die Wohnsiedlung Berg Fidel an: Hochhäuser, ein Fußballstadium und einige Bungalows. Im Park hat der Künstler das dreidimensionale Skelett eines Hauses platziert, es ist sozusagen ein ideales Garten-Haus, denn man kann hindurchgehen und in den Himmel blicken. Es gibt keine Wände, kein Dach, nur das fragile, nahtlos verchromte Gerüst, das sich in die Natur spiegelt und die Natur zurück zu spiegeln scheint. Es hat ein schönes Maß, ein menschliches Maß, das einen Blick erfahrbar macht, der sich entscheidet, in der ungestalten Natur eine Landschaft zu sehen. Diese Arbeit ist in einer anderen Hinsicht vielleicht auch eine Art Spiegel für die gesamte Ausstellung, weil sie den Gedanken bündelt, dass der Raum der Gegenwart kein Innen und Außen mehr kennt, dass realer und virtueller Raum einander durchdringen. Wir sind es, die in beiden Grenzen (durch-)setzen. Emeka OkbohApropos Grenzen. Noch ein Wort zur Klanginstallation im Hamburger Tunnel am Bahnhof. Dieser Tunnel war während des Bahnhofumbaus die Verbindung für Reisende in die Stadt. Jeder musste durch den Tunnel. Er entwickelte sich in den letzten Monaten zu einem wirklich urbanen Ort mit Straßenmusikern, Menschen, die auf der Straße leben, Passanten, Radfahren, Reisenden. Es geht nicht darum diese Situation zu idealisieren, aber die Klanginstallation von Emeka Okboh ist eine erinnernde Hommage an diese für eine kurze Zeit lebendige Passage. Dass die Stadt jedoch inzwischen in(!) diesem Tunnel mobile, zweigeschossige Radständer aufgestellt hat, die die Hälfte des Tunnels zustellen und Passanten nun wörtlich an den Rand drängen, zeigt, was man von dem Kunstwerk und all denen, die auf einen Schlag aus dem Hamburger Tunnel verdrängt wurden, hält. Anmerkungen[1] Kommerzialisierung im Ästhetischen. Ein Projekt von Tobias Rehberger, in: Tà Katoptrizómena. Magazin für Theologie und Ästhetik, Heft 1. [2] Christoph Menke: Ein anderer Geschmack. Weder Autonomie noch Massenkonsum, in: Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, Christoph Menke / Juliane Rebentisch (Hg.), Berlin: Kadmos 2010, S. 226-239. [3] In Kooperation mit dem Henry Moore Institute wird im Anschluss an die Skulptur Projekte ein Symposium die Frage diskutieren, ob oder ab wann Skulpturen im öffentlichen Raum ihre Qualität bzw. ihre Bedeutung verlieren: „Nothing permanent“, 13. - 15. September 2017. [5] Elena Martinique: Skulptur Projekte Munster 2017 – Exploring the Scope of Art in Public Space, © 2017 WideWalls | Urban & Contemporary Art Resource [6] Petra Hanáková (ed.), Alexandra Kusá, Emil Drličiak: Slovak Art for free: 48. Biennale di Venezia : Pavilion of Slovak Republic Giardini di Castello Venice, Italy June 12-november 7, 1999. [7] Christian Hasucha: Leben in Münster, 1999 – 2009. Zum Projekt auch: Tà Katoptrizómena. Magazin für Theologie und Ästhetik, Heft 1. [8] Andreas Mertin: Der allgemeine und der besondere Ikonoklasmus. Bilderstreit als Paradigma christlicher Kunsterfahrung, in: A. Mertin / H. Schwebel (Hg): Kirche und Moderne Kunst. Eine aktuelle Dokumentation, Frankfurt /M. 1988, S. 146-168, hier:: S. 161. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/108/kw78.htm |

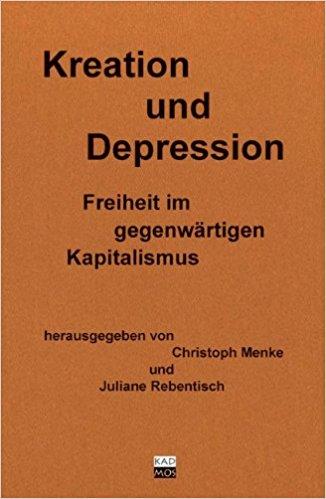 Wir erleben gegenwärtig, dass uns die Anpassungsleistungen zur ästhetischen (Selbst)-Optimierung überfordern, dass die „Sorge um die eigene Konsumierbarkeit“ uns umtreibt. In der Kunst, so schreibt Christoph Menke in seinem gleichnamigen Aufsatz, geht es aber um „einen anderen Geschmack“.
Wir erleben gegenwärtig, dass uns die Anpassungsleistungen zur ästhetischen (Selbst)-Optimierung überfordern, dass die „Sorge um die eigene Konsumierbarkeit“ uns umtreibt. In der Kunst, so schreibt Christoph Menke in seinem gleichnamigen Aufsatz, geht es aber um „einen anderen Geschmack“. Als performative Arbeit könnte man auch „Cerith“ (Seenadelschnecke) von Wyn Evans deuten. Denn das Spannende an diesem Projekt ist doch, dass es gar nicht darum geht zu hören, ob die Kirchenglocke von St. Stephanus anders klingt, weil sie der Künstler (angeblich?) heruntergekühlt hat – nämlich wie im Winter, also etwas höher – sondern darum, zu realisieren, dass man das natürlich nicht hört. So wie vieles, wenn nicht das Meiste zwischen Himmel und Erde, was menschliche Sinne nicht wahrnehmen können. Diese Grenze wiederum kann ich in der Begegnung mit Evans Arbeit erfahren.
Als performative Arbeit könnte man auch „Cerith“ (Seenadelschnecke) von Wyn Evans deuten. Denn das Spannende an diesem Projekt ist doch, dass es gar nicht darum geht zu hören, ob die Kirchenglocke von St. Stephanus anders klingt, weil sie der Künstler (angeblich?) heruntergekühlt hat – nämlich wie im Winter, also etwas höher – sondern darum, zu realisieren, dass man das natürlich nicht hört. So wie vieles, wenn nicht das Meiste zwischen Himmel und Erde, was menschliche Sinne nicht wahrnehmen können. Diese Grenze wiederum kann ich in der Begegnung mit Evans Arbeit erfahren. Experiment auf kleinem Raum und unter geschlossenen Bedingungen. Wenn sich die Lichtschleuse öffnet, verdunkeln sich seine Scheiben und es erscheint wie ein geheimnisvoller Schrein. Hellen die Scheiben auf, erkennt man im Innern eine Landschaft, die an das Bild „Eismeer (die gescheiterte Hoffnung)“ von C.D. Friedrich erinnert. Die Idee der Kunst als Archäologie und Naturexperiment ist nicht neu; auch nicht die Idee, ein Gelände Zeit und Witterung auszusetzen. Aber Huyghes Arbeit ist interessant, weil er mehr oder weniger unsichtbar – das heißt ohne eine eigentlich menschliche Signatur – in diese Sphäre eingreift und so ein offenes System schafft, in dem sich Natürliches und Künstliches nicht mehr klar voneinander unterscheiden lassen. Es ist meiner Einschätzung nach einer der wenigen (vergänglichen) Orte, die im Gedächtnis dieser Skulptur Projekte bleiben werden.
Experiment auf kleinem Raum und unter geschlossenen Bedingungen. Wenn sich die Lichtschleuse öffnet, verdunkeln sich seine Scheiben und es erscheint wie ein geheimnisvoller Schrein. Hellen die Scheiben auf, erkennt man im Innern eine Landschaft, die an das Bild „Eismeer (die gescheiterte Hoffnung)“ von C.D. Friedrich erinnert. Die Idee der Kunst als Archäologie und Naturexperiment ist nicht neu; auch nicht die Idee, ein Gelände Zeit und Witterung auszusetzen. Aber Huyghes Arbeit ist interessant, weil er mehr oder weniger unsichtbar – das heißt ohne eine eigentlich menschliche Signatur – in diese Sphäre eingreift und so ein offenes System schafft, in dem sich Natürliches und Künstliches nicht mehr klar voneinander unterscheiden lassen. Es ist meiner Einschätzung nach einer der wenigen (vergänglichen) Orte, die im Gedächtnis dieser Skulptur Projekte bleiben werden. Irgendwann bemerke ich, dass es sich um einen Film handeln muss, den ich über das Drücken des interaktiven Kabels selbst steuere. Immer bin ich beides: Akteur und Beobachter, Teil des Ganzen und Voyeur.
Irgendwann bemerke ich, dass es sich um einen Film handeln muss, den ich über das Drücken des interaktiven Kabels selbst steuere. Immer bin ich beides: Akteur und Beobachter, Teil des Ganzen und Voyeur.