Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen
Notizen 01-49
Wolfgang Vögele
 1. Tippen: Der zukünftige Premierminister liegt noch im Bett, das helle Licht der Morgensonne dringt durch das Fenster. Auf einem Tablett serviert die Ehefrau das Frühstück. Zum ersten Mal kommt die junge, noch unerfahrene Sekretärin ins Schlafzimmer, um ein Diktat direkt in die Schreibmaschine zu tippen. Diese Schreibmaschine ist auf einem kleinen Tisch am Fuß des Bettes platziert. Die junge Sekretärin wirkt ganz verschüchtert, sie ist gewarnt worden, dass der neue Chef zu cholerischen Ausbrüchen neigt. Man hört das Tippen der Tasten und das helle Pling, bevor der Wagen mit dem Farbband beim Zeilenwechsel zurück in die Ausgangsposition fährt. Der zukünftige Premierminister Winston Churchill, noch im Morgenmantel, steht auf, um das Diktierte zu lesen. Und er brüllt sofort los, weil die Sekretärin ein- und nicht zweizeilig geschrieben hat.
1. Tippen: Der zukünftige Premierminister liegt noch im Bett, das helle Licht der Morgensonne dringt durch das Fenster. Auf einem Tablett serviert die Ehefrau das Frühstück. Zum ersten Mal kommt die junge, noch unerfahrene Sekretärin ins Schlafzimmer, um ein Diktat direkt in die Schreibmaschine zu tippen. Diese Schreibmaschine ist auf einem kleinen Tisch am Fuß des Bettes platziert. Die junge Sekretärin wirkt ganz verschüchtert, sie ist gewarnt worden, dass der neue Chef zu cholerischen Ausbrüchen neigt. Man hört das Tippen der Tasten und das helle Pling, bevor der Wagen mit dem Farbband beim Zeilenwechsel zurück in die Ausgangsposition fährt. Der zukünftige Premierminister Winston Churchill, noch im Morgenmantel, steht auf, um das Diktierte zu lesen. Und er brüllt sofort los, weil die Sekretärin ein- und nicht zweizeilig geschrieben hat.
Der Film, der folgt, erzählt von den ersten Wochen Churchills als Premierminister während des Zweiten Weltkriegs. Die Fäden des Krieges und der großen Politik laufen zusammen im Verhältnis Churchills zu seiner Sekretärin, der unnahbare, brüllende Wutpolitiker gegen die junge, unerfahrene Frau. Sehr, sehr langsam ändert sich dieses Verhältnis in eine Beziehung, die von mehr Menschlichkeit und Empathie geprägt ist. Wiederholt zeigt der Regisseur die Schreibmaschine in Großaufnahme, den Vorgang des Tippens, wie die Buchstaben auf die Seiten gehackt werden. Der Zuschauer sieht die Tasten von unten, wie sie die Worte der später berühmten Reden und Radioansprachen zum ersten Mal auf Papier fixieren.
Schreibmaschinenszenen ziehen sich leitmotivisch durch den gesamten Film „Die dunkelste Stunde“[1]. Am Anfang erscheint Churchill als der allmächtige Verfasser und die Sekretärin als schüchterne Kopistin. Am Ende des Films hat sich das Verhältnis grundlegend verändert. Der autoritäre Premierminister hat, gelegentlich unter Mühen, gelernt, auf die Gefühle und Bedürfnisse einfacher Menschen wie der Sekretärin und der Fahrgäste in der Londoner Subway zu achten. Und ein wenig melodramatisch behauptet der Film, dass genau diese Neubesinnung auf Willen und Gefühle einfacher Menschen den Erfolg der Churchill’schen Kriegspolitik ausmachte.
Ein psychologisches Geschehen verwandelt sich in getippte Worte, und ihr Symbol sind nicht mehr Papierblätter, Füller oder Bleistift, sondern die Schreibmaschine, zu jener Zeit noch nicht die Tastatur des Computers. Der Film des Regisseurs Joe Wright, der 2017 gedreht wurde, rückt nostalgisch die die heute nicht mehr benutzte Schreibmaschine in den Mittelpunkt. Die mit der Maschine getippten Buchstaben sind viel lesbarer als eine Handschrift, als eine Sauklaue, aber sie sind noch nicht beliebig zu korrigieren, zu ändern, auch nicht mit den Tipp-Ex-Blättchen, an die sich manche ältere Leser noch erinnern werden. Dass getippte Texte ohne Schwierigkeiten verändert werden können, dafür sorgten erst Monitor und Tastatur des Computers. Um diese Entwicklung geht es, vom handgeschriebenen zum getippten bis zum ausgedruckten Text, vom Pergament über das Papier bis zur pdf-Datei, vom Füller über die Schreibmaschine bis zum Textprozessor. Vom Schriftlichen zum Digitalen und dabei von den Auswirkungen dieses Prozesses auf Religion und Theologie.
2. Gebrauchsanweisung: Dieser Essay besteht aus einem Netz von Splittern, die nur aus Gründen des Drucks linear angeordnet sind. Man könnte die Splitter, Posts, Karteikarten auch in einer ganz anderen Reihenfolge lesen, wozu ausdrücklich ermuntert wird. Dieser Essay wird getragen von fünf Intuitionen: 1. Das Christentum als Schrift- und Buchreligion lebt vom Umgang mit einem heiligen Text. Das gilt auch im digitalen Zeitalter, daran wird keine Werbeaktion der klerikalen Marketingexperten etwas ändern. 2. Der Protestantismus hat seit dem 16.Jahrhundert dazu beigetragen, den Umgang mit dem heiligen Text der Bibel in eine umfassende Schriftkultur zu verwandeln, die über das Christentum hinausreicht. 3. In der Moderne haben sich Schriftkultur und Buchreligion verselbständigt, trotzdem sind beide noch aufeinander angewiesen. 4. Die Entwicklung des virtual space, also des Digitalen, verändert Schriftkultur und Buchreligion gleichermaßen. Diesen Herausforderungen werden Theologie und Kirchen bisher nur in Ansätzen gerecht. 5. Um diese nicht abgeschlossenen Entwicklungen zu beschreiben, sind die gerade neu erschienenen Überlegungen Roland Barthes über die „Lust am Text“ von Interesse, weil in ihnen die Auflösung des alten Schemas von Autor und Leser sowie die Einbindung von Texten in ein ganzes Gewebe von anderen Texten untersucht wird. Passagen aus diesem Essay werden in diese Sammlung von Karteikarten immer wieder eingestreut. Dazu kommt eine weitere – eher methodische – Intuition: Die Verhältnisse von Schriftlichem, Heiligem und Digitalem sollen nicht aus der Überblickspose des kulturwissenschaftlichen Feldherrn, sondern aus dem Blickwinkel eines Beteiligten, eines verstrickten und vernetzten Users beschrieben werden. - Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie Ihren Webmaster, Ihren Pfarrer, Ihre Freunde auf Facebook und Ihren gesunden Menschenverstand.
 3. Buchreligion: Das Christentum wird bekanntlich unter die Buchreligionen gezählt. Aber das Buch, in diesem Fall die Bibel, ist nicht Gegenstand von Verehrung und Anbetung, sondern ihr Medium. Bücherreligiös verhalten sich christliche Fundamentalisten, die missverständlich von Verbalinspiration und Schriftprinzip sprechen. Ohne es zu wollen, verengen sie durch ein Buch ihre Weltsicht und beschneiden damit ihre theologische Freiheit. Die konsequente Folge sind moralische Missverständnisse und Fehlurteile. Aber die Frömmigkeit einer Buchreligion lässt sich auch anders leben und denken. Buchreligion, das heißt auch, dass ein Buch, die Bibel, stark aufgewertet wird. Nur dort, in der Bibel, finden sich Geschichten vom Heil. Es ist zu fragen, wie sich dann das eine Buch zu allen anderen Büchern verhält. Im Zeitalter von Internet und Digitalisierung ist zu fragen, wie sich das eine Buch zu allen anderen Texten, Bildern und Filmen verhält.
3. Buchreligion: Das Christentum wird bekanntlich unter die Buchreligionen gezählt. Aber das Buch, in diesem Fall die Bibel, ist nicht Gegenstand von Verehrung und Anbetung, sondern ihr Medium. Bücherreligiös verhalten sich christliche Fundamentalisten, die missverständlich von Verbalinspiration und Schriftprinzip sprechen. Ohne es zu wollen, verengen sie durch ein Buch ihre Weltsicht und beschneiden damit ihre theologische Freiheit. Die konsequente Folge sind moralische Missverständnisse und Fehlurteile. Aber die Frömmigkeit einer Buchreligion lässt sich auch anders leben und denken. Buchreligion, das heißt auch, dass ein Buch, die Bibel, stark aufgewertet wird. Nur dort, in der Bibel, finden sich Geschichten vom Heil. Es ist zu fragen, wie sich dann das eine Buch zu allen anderen Büchern verhält. Im Zeitalter von Internet und Digitalisierung ist zu fragen, wie sich das eine Buch zu allen anderen Texten, Bildern und Filmen verhält.
 4. Heilige Schrift: Eine Buchreligion benötigt eine Heilige Schrift, die sofort die Frage auslöst, aus welchen Schriften (im Plural) sich die Heilige Schrift zusammensetzt und wer dafür gesorgt hat, dass der Kanon dieser Schriften sich so und nicht anders herausgebildet hat. Die Heilige Schrift ist ein geschlossener Kanon von unterschiedlichen Schriften, im Fall der Bibel, von Erzählungen, Gebeten, Psalmen, Evangelien, Briefen und anderem mehr. Die Heilige Schrift benötigt Schriftexperten (Exegeten, Schriftgelehrte, Theologen), die sie lesen, übersetzen, interpretieren, deuten können.[2] Der Text wird zur Autorität, nicht eine Kaste von Priestern oder religiösen Funktionären. Der Kanon von heiligen Texten ist der Referenzpunkt, und das ist etwas anderes als eine soziale oder personale Machtstruktur. Der heilige Text verlangt nach Auslegung (Hermeneutik), und diese zeitigt soziale und theologische Folgen. Ein Gesetzestext mit Vorschriften und Regeln muss beachtet werden; er enthält Gebote und Verbote, die beachtet werden wollen. Eine Geschichte mit narrativem Stoff setzt nicht zuerst moralische Regeln aus sich heraus, sie benötigt eine kompliziertere Hermeneutik, noch viel mehr eine Geschichte, in der Gott auftritt, und sei es nur im Traum oder gar – als Mensch. Die heiligen Texte, als die Schrift, tauchen in anderen Texten wieder auf, als Anspielung, als Zitat oder sogar als Schriftzitat, um Thesen, Verhaltensweisen, Gebote zu legitimieren. Die legitimierende Funktion von Zitaten ist nicht auf die Sphären des Heiligen und Theologischen beschränkt: In der kulturellen Entwicklung hin zur Moderne gewinnt das Zitat größere Eigenständigkeit, bis dahin, dass Texte zusammengestellt werden, die nichts anderes als eine Collage von Zitaten sind.[3]
4. Heilige Schrift: Eine Buchreligion benötigt eine Heilige Schrift, die sofort die Frage auslöst, aus welchen Schriften (im Plural) sich die Heilige Schrift zusammensetzt und wer dafür gesorgt hat, dass der Kanon dieser Schriften sich so und nicht anders herausgebildet hat. Die Heilige Schrift ist ein geschlossener Kanon von unterschiedlichen Schriften, im Fall der Bibel, von Erzählungen, Gebeten, Psalmen, Evangelien, Briefen und anderem mehr. Die Heilige Schrift benötigt Schriftexperten (Exegeten, Schriftgelehrte, Theologen), die sie lesen, übersetzen, interpretieren, deuten können.[2] Der Text wird zur Autorität, nicht eine Kaste von Priestern oder religiösen Funktionären. Der Kanon von heiligen Texten ist der Referenzpunkt, und das ist etwas anderes als eine soziale oder personale Machtstruktur. Der heilige Text verlangt nach Auslegung (Hermeneutik), und diese zeitigt soziale und theologische Folgen. Ein Gesetzestext mit Vorschriften und Regeln muss beachtet werden; er enthält Gebote und Verbote, die beachtet werden wollen. Eine Geschichte mit narrativem Stoff setzt nicht zuerst moralische Regeln aus sich heraus, sie benötigt eine kompliziertere Hermeneutik, noch viel mehr eine Geschichte, in der Gott auftritt, und sei es nur im Traum oder gar – als Mensch. Die heiligen Texte, als die Schrift, tauchen in anderen Texten wieder auf, als Anspielung, als Zitat oder sogar als Schriftzitat, um Thesen, Verhaltensweisen, Gebote zu legitimieren. Die legitimierende Funktion von Zitaten ist nicht auf die Sphären des Heiligen und Theologischen beschränkt: In der kulturellen Entwicklung hin zur Moderne gewinnt das Zitat größere Eigenständigkeit, bis dahin, dass Texte zusammengestellt werden, die nichts anderes als eine Collage von Zitaten sind.[3]
Luthers Reformation war ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung der Auslegung, der hermeneutischen Methode. Letztere sind seither nicht mehr nur Experten vorbehalten, sie sind zur Sache jedes lesenden Christen geworden. Mit der Demokratisierung der Auslegung verband sich ein großes Bildungsprogramm, das Kenntnisse in alten Sprachen, Übersetzungs- und Auslegungstechniken vermittelte. Letztere wurde nicht nur auf das Buch der Heiligen Schrift, sondern auch auf andere Schriften angewandt. Es ging um die Stärkung des individuellen, lesenden Schriftauslegers und um die Dekonstruktion von hierarchischer Autorität. Die Rede vom Priestertum aller Gläubigen scheint in dieser Perspektive viel zu liturgisch. Im Kern ist das Priestertum aller Gläubigen eine Gemeinschaft von gleichberechtigten Schriftauslegern, die sich durch Argumente, Rationalität und Intellekt zu überzeugen suchten, nicht mehr durch klerikale Amtsautorität.
Im digitalen Zeitalter hat sich die Alleinstellung der Heiligen Schrift mehr und mehr aufgelöst. Sie ist nicht mehr der allgemeine Bezugspunkt sozialer, politischer, kultureller und theologischer Debatten. An die Stelle der einen Heiligen Schrift sind eine Vielzahl von Schriften, Bildern und Filmen getreten, die alle Autorität für sich beanspruchen und sich dabei gegenseitig relativieren. Die Heilige Schrift war ein monolithischer Bezugspunkt, vergleichbar dem Grundgesetz als dem schriftlicher Bezugsrahmen für das Recht, der institutionell durch das Auslegungen, sprich: Urteile des Bundesverfassungsgerichts verbürgt wird. Im Internetzeitalter tritt an die Stelle der einen Schrift ein unübersehbares Sammelsurium von Schriften, die der dann User genannte Leser zuerst einmal für sich sortieren muss. Vor der Auslegung steht plötzlich die Entscheidung für einen bestimmten schriftlich oder bildlich fixierten Bezugspunkt.
5. Kanon: Die heilige Schrift des Christentums ist selbst aus unterschiedlichen Schriften entstanden. Dabei handelte es sich um einen historischen Prozess, der im 2. und 3. urchristlichen Jahrhundert stattfand. Bestimmte Bibelausgaben haben neuerdings die Schriften, die aus dem Kanon herausfielen, mit abgedruckt.[4] Es erscheint wichtig, dass der Kanon in sich selbst vielfältig ist. Er besitzt eine Binnenpluralität, die über die Jahrhunderte zur ökumenischen Konfessionspluralität führte. Im Umgang mit ihm entstanden so unterschiedliche Interpretationsgemeinschaften wie die katholische, die protestantischen und die orthodoxen Kirchen. Diese Vielfalt des Kanons in sich selbst sollte darum nicht unterschätzt werden.
6. Sola Scriptura: Reformatorisch macht das Schriftprinzip Sinn, wenn es sich gegen die irrationale Behauptung klerikal-hierarchischer Macht richtet. Unter den Bedingungen der Moderne verändert sich die Bedeutung des Schriftprinzips. Sie führt zu dem erwähnten Missverständnis, dass grundsätzlich alles, was nicht mit den Behauptungen der Bibel übereinstimmt, geleugnet wird: von der Evolutionslehre über die Homosexualität bis zum Urknall. Die Kritik des Schriftprinzips kann zweitens zur falschen Wiederaufwertung von Tradition und der Macht ihrer angeblichen Bewahrer führen, wie das im fundamentalistischen Flügel des Katholizismus geschieht, wo er sich zusätzlich mit einer Kritik an allen innerkirchlichen Erneuerungsbewegungen, besonders am Aggiornamento des 2.Vatikanums verbindet. Die katholische Kirche löst das Problem der Lehrautorität, indem sie – letztlich willkürlich – eine bestimmte Traditionslinie der Auslegung für verbindlich erklärt. Eine dritte Strategie sieht alle diejenigen modernen Phänomene von biblischer Bewertung ausgeschlossen, die in der heiligen Schrift aus Gründen naturwissenschaftlicher und technischer Bewertung noch gar nicht vorkommen, von der Abtreibung über die Gentechnik bis zur Sterbehilfe. Eine vierte hermeneutische Strategie sieht das Sola Scriptura der Reformatoren auf die Heilslehre begrenzt, auf diejenigen Bereiche der Bibel, wo von der Rechtfertigung des Sünders und der Erlösung in Jesus Christus die Rede ist, von dem, „was Christum treibet“. Alles andere bleibt der vernünftigen und rationalen Abwägung überlassen. Wieder andere versuchen, eine fünfte Strategie, aus der Bibel keine institutionellen Vorgaben mehr herauszulesen, also keine Option für die heterosexuelle Ehe, sondern nur noch eine Option für bestimmte Werte, zum Beispiele Lieb und Respekt, dauerhafte Treue, Solidarität, die für alle Formen des Zusammenlebens als Paar, seien sie homo- oder heterosexuell offenstehen. Die theologische Diskussion über das Schriftprinzip ist noch lange nicht abgeschlossen, wahrscheinlich steht sie den evangelischen Kirchen, die an diese Fragen nur sehr zögerlich herangehen, noch bevor. Man fürchtet weitere Spaltungen, den Fundamentalisten wirft man ängstliches Verharren, den Liberalen eine zu weitgehende Anpassung an den Zeitgeist vor.
7. Schriftkultur: Die Vorrangstellung des Buches in einer Religion zieht eine bestimmte Schriftkultur nach sich.[5] Auch hier hat die Reformation gewirkt: Der Buchdruck demokratisiert die biblische Buchlektüre. Plötzlich werden auch Laien zu ernst zu nehmenden Auslegern. Lesen und Schreiben werden zu immer wichtigeren Kulturtechniken. Die Konzentration auf das eine Buch generiert weitere Bücher wie in einem kulturellen Schneeballsystem. Aber diese Bücher bleiben erst einmal um das alte Zentrum der einen heiligen Schrift geordnet. Die digitale Schriftkultur, die ihr in der Moderne folgt, hat dieses Zentrum verloren. Sie ist durch Vielfalt geprägt, nicht mehr durch einen schriftlichen Zentralismus.
 8. Der theologische Schreibtisch: Wer weiß, dass er allein mit der Bibel nicht auskommt, der zitiert gerne den Schweizer Theologen Karl Barth, der schrieb: „Wir haben die Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt uns den täglichen Bericht darüber, was in der Menschheit vorgeht. Die Bibel lehrt uns, was diese Menschheit ist, die von Gott so geliebt wird.“ Der politische Theologe praktiziert eine spirituelle Lesekultur, die sich aus zwei Quellen, Bibel und Zeitung, speist. Er will in der Lage sein, beides miteinander hermeneutisch zu vermitteln. Erst nach dem doppelten Lesen geht die Theologie in politische Aktion über. Heute lässt sich diese Zweiquellentheorie der politischen Theologie nicht mehr halten. Sämtliche Journalisten klagen über sinkende Auflagen ihrer Zeitungen. An der Stelle der einen Zeitungsquelle sind eine Fülle von digitalen Quellen getreten, von Facebook über Twitter, Blogs bis zu Youtube und Instagram. Jeder kann seine Meinung vertreten, in ganz verschiedenen digitalen Foren. Die Rolle der Journalisten als Platzanweiser für die demokratische Meinungsbildung ist fragwürdig geworden. Und gleiches gilt für die Rolle des politischen Theologen als Platzanweiser für die Kirchen.
8. Der theologische Schreibtisch: Wer weiß, dass er allein mit der Bibel nicht auskommt, der zitiert gerne den Schweizer Theologen Karl Barth, der schrieb: „Wir haben die Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt uns den täglichen Bericht darüber, was in der Menschheit vorgeht. Die Bibel lehrt uns, was diese Menschheit ist, die von Gott so geliebt wird.“ Der politische Theologe praktiziert eine spirituelle Lesekultur, die sich aus zwei Quellen, Bibel und Zeitung, speist. Er will in der Lage sein, beides miteinander hermeneutisch zu vermitteln. Erst nach dem doppelten Lesen geht die Theologie in politische Aktion über. Heute lässt sich diese Zweiquellentheorie der politischen Theologie nicht mehr halten. Sämtliche Journalisten klagen über sinkende Auflagen ihrer Zeitungen. An der Stelle der einen Zeitungsquelle sind eine Fülle von digitalen Quellen getreten, von Facebook über Twitter, Blogs bis zu Youtube und Instagram. Jeder kann seine Meinung vertreten, in ganz verschiedenen digitalen Foren. Die Rolle der Journalisten als Platzanweiser für die demokratische Meinungsbildung ist fragwürdig geworden. Und gleiches gilt für die Rolle des politischen Theologen als Platzanweiser für die Kirchen.
9. Die abgegriffene Bibel: Die Bibel, die der Anhänger der christlichen Buchreligion benutzt, wird nicht verehrt, sondern gebraucht. Dass sie in Ehren gehalten wird, zeigt sich an ihrer (Ab-)Nutzung, nicht an der erwiesenen Reverenz. Gerade weil sie so wichtig ist, zeigt sie Spuren des Gebrauchs: Der Einband ist abgegriffen, an manchen Stellen löst er sich bereits auf. Passagen, die dem Leser wichtig sind, hat er mit Bleistift unterstrichen und an den Rand eigene Kommentare geschrieben. Die Anfänge der jeweiligen Bücher sind mit kleinen gliedernden Notizzetteln versehen, die bei jugendlichen Bibellesern sogar beschriftet sein können. Eine solche Bibel führt der intensive Leser stets mit sich, im Bus, im Wartesaal, auf der Parkbank. Abgegriffene Bibeln dieser Art nutzen Teilnehmer von Bibel- und Gesprächskreisen in der Gemeinde. Die Heiligkeit dieser Bücher zeigt sich indirekt an den Gebrauchsspuren intensiver Lektüre. Wer dagegen digitale Bibeln nutzt, wird von solchen Gebrauchsspuren nichts mehr bemerken. Nur Google merkt sich, wie oft der User die Website der Bibelgesellschaft im Browser geöffnet hat.
10. Der intensive und der fromme Leser: Der fromme Anhänger einer Buchreligion ist in jedem Fall ein Leser, der sich einen Text intensiv aneignet. Er ist ein intensiver Leser. Er liest gründlich, Wort für Wort; er versucht, Zusammenhänge, Sinn und Aufbau zu begreifen. Lesen ist für ihn nicht Konsum oder Zeitvertreib, nicht das Totschlagen von Langeweile, nicht die eskapistische und vorübergehende Transposition des Bewusstseins in eine schönere Welt, sondern der immer wieder neu in Angriff genommene Versuch, die Gedanken eines anderen Autors zu entschlüsseln und zu begreifen. Der intensive Leser will Entdeckungen machen, verstehen, was der andere sagen will, sich aber auch zu eigenen Gedanken anregen lassen. Insofern gilt das Lesen nicht nur als ein rezeptiver, sondern als kreativer Prozess. Wer liest, nimmt eine andere Welt in sich auf, und verwandelt für sich selbst. Und in dieser Rezeption wird das Lesen selbst schöpferisch. Das ist kein schnelles und flüchtiges, sondern ein langsames und durchdringendes, ein konzentriertes Lesen.[6] Schon bei Thomas a Kempis findet sich das in der Gegenwart von Umberto Eco übernommene Wort: „In Omnibus Requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.“ Wer liest, kann sich in den Ohrensessel, auf eine Parkbank oder in ein Café zurückziehen und sich dort in fremde, von anderen Verfassern entwickelte Welten versenken.
Im konzentrierten, langsamen, intensiven Lesen unterscheidet sich der Leser der Bibel nicht vom Leser anderer Bücher. Aber wer die Bibel liest, vertraut auch auf die Zusage, in Psalmen, Geschichten und Erzählungen Sinnstiftendes, Erhellendes und Erlösendes für das eigene Leben zu erfahren. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Leser sich allein der Lektüre und Sinnsuche widmet, oder ob er diese fromme Unternehmung der Lektüre in Gemeinschaft mit anderen in Angriff nimmt.
 11. Texte als Gewebe (Barthes): Es war eine der zentralen Einsichten von Roland Barthes, dass er Texte nicht mehr als lineare Abfolge einer Erzählung oder eines Sinnzusammenhangs verstand. Vielmehr verstand er Texte als ein Gewebe, als einen Zusammenhang ohne Anfang und Ende, der sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln lässt: „Text heißt Gewebe; aber während man dieses Gewebe bisher immer als ein Produkt, einen fertigen Schleier aufgefasst hat, hinter dem sich, mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die Wahrheit) aufhält, betonen wir jetzt bei dem Gewebe die generative Vorstellung, dass der Text durch ständiges Flechten entsteht und sich selbst bearbeitet; in diesem Gewebe – dieser Textur – verloren, löst sich das Subjekt auf wie eine Spinne, die selbst in die konstruktiven Sekretionen ihres Netzes aufginge.“ [7]
11. Texte als Gewebe (Barthes): Es war eine der zentralen Einsichten von Roland Barthes, dass er Texte nicht mehr als lineare Abfolge einer Erzählung oder eines Sinnzusammenhangs verstand. Vielmehr verstand er Texte als ein Gewebe, als einen Zusammenhang ohne Anfang und Ende, der sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln lässt: „Text heißt Gewebe; aber während man dieses Gewebe bisher immer als ein Produkt, einen fertigen Schleier aufgefasst hat, hinter dem sich, mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die Wahrheit) aufhält, betonen wir jetzt bei dem Gewebe die generative Vorstellung, dass der Text durch ständiges Flechten entsteht und sich selbst bearbeitet; in diesem Gewebe – dieser Textur – verloren, löst sich das Subjekt auf wie eine Spinne, die selbst in die konstruktiven Sekretionen ihres Netzes aufginge.“ [7]  Ein Gewebe repräsentiert eine offene, in mehrere Richtungen ausbaufähige Struktur. Internet und digitale Kultur haben die Prägnanz dieser Metapher noch um ein Vielfaches potenziert. Denn mit Hilfe von Verweisen und Hyperlinks sucht sich der Leser seinen eigenen Weg durch einen Dschungel von Informationen, Deutungen, Inhalten. Das Lineare, Chronologische und auch das Geordnete wird preisgegeben zugunsten des Gewebecharakters von Information. Jeder Leser findet seinen eigenen Weg durch das unübersichtliche Gewirr. Damit kommt ein Moment des Zufälligen und Aleatorischen in Information und Kommunikation hinein.
Ein Gewebe repräsentiert eine offene, in mehrere Richtungen ausbaufähige Struktur. Internet und digitale Kultur haben die Prägnanz dieser Metapher noch um ein Vielfaches potenziert. Denn mit Hilfe von Verweisen und Hyperlinks sucht sich der Leser seinen eigenen Weg durch einen Dschungel von Informationen, Deutungen, Inhalten. Das Lineare, Chronologische und auch das Geordnete wird preisgegeben zugunsten des Gewebecharakters von Information. Jeder Leser findet seinen eigenen Weg durch das unübersichtliche Gewirr. Damit kommt ein Moment des Zufälligen und Aleatorischen in Information und Kommunikation hinein.
12. Verständigung: Nach dem Wort eines bekannten praktischen Theologen geht Religion nicht in Ritualen, Liturgien und Gottesdiensten auf, sondern ist charakterisiert durch Kommunikation, durch Verständigung. Buchreligionen zeichnen sich durch die Verständigungen aus, die ihre Anhänger durch Lesen, Deuten, Interpretieren der vorgegebenen Schrift erreicht haben. Sie verarbeiten die Erfahrungen, die sie in ihrer Lebenswelt machen, im Lichte ihrer heiligen Schriften und bilden im Ergebnis eines solchen Verständigungsprozesses Deutungsgemeinschaften, die sich auf bestimmte Muster der Interpretation geeinigt haben. Religion werde nicht mehr durch den Kanon einer heiligen Schrift, auch nicht mehr durch ein Bekenntnis, sondern durch Kommunikation bestimmt[8]. Theologie ist dann nicht mehr die Tätigkeit der Feststellung und des Vergleichs von Kanonischem und Nicht-Kanonischem, von dogmatisch Richtigem und Häretischem, sondern Theologie wird in modernen religiös pluralen Gesellschaften zur Moderation zwischen verschiedenen spirituellen und theologischen Auffassungen. Wo Religion in konfessorischem Inhalt aufgeht, herrscht Theologie als Dogmatik. Wo Religion Kommunikation wird, findet Theologie als Moderation statt.[9] Dieses Verständnis entspricht dem alten unitarischen Grundsatz: We agree to disagree. Kommunikative Religion wird sozial, nicht mehr dogmatisch oder konfessorisch verstanden. Aber wenn alles Kommunikation und Moderation ist, dann verliert sich religiöse Rede irgendwann in individualistischer Bricolage oder gleich im unbestimmten Nirgendwo. Irgendwann müssen sich die kommunizierenden und diskutierenden religiösen Menschen auch einmal auf etwas einigen. Die religiösen Kommunikationstheoretiker vergessen, dass Kommunikation nur Medium ist, um ein bestimmtes Ziel (Konsens, Dissens etc.) zu erreichen. Konsistorien und Synoden haben dieses Kommunikationsprinzip schon so sehr verinnerlicht, dass jede, auch die harmloseste Entscheidung durch ein Präludium von zähen Ausschuss- und Gremiendebatten in die Länge gezogen wird und so die Arbeits- und Handlungsfähigkeit nachhaltig behindert. Im letzteren Fall tragen Internet und moderne Kommunikationstechniken (Email, Doodle, Texte in endlos vielen pdf-Varianten) leider dazu bei, diesen Prozess ins Endlose auszudehnen.
13. Auslegen, um zu verstehen: Das Verständnis von Religion als Kommunikation ist dabei, das alte Verständnis von Religion als Auslegung eines heiligen Textes, der Schrift (im eigentlichen Sinn) abzulösen, jedenfalls im Christentum. Die zentrale Symbolfigur dieses alten Verständnisses ist der Prophet Nathan, der dem König David eine Hirtengeschichte erzählt, um dann damit zu enden, dass er sagt: Es geht um dich, den König David, nicht um einen einfachen Hirten. Tua res agitur. Nathan legt, zusammen mit David, die Geschichte aus, interpretiert sie und wendet sie auf die Gegenwart Davids an. Die Pointe der Prophetengeschichte, nämlich dass er selbst bestraft wird, verblüfft den König David, aber er fügt sich dem göttlichen Urteil.
Wer Geschichten und Texte auslegt, bewegt sich stets auf den Spuren des Propheten Nathan. Grundtätigkeiten der hermeneutischen Philosophie sind Unterscheiden, Interpretieren, Prüfen, Deuten. Ziel ist eine Verständigung, das Erreichen von Plausibilitäten und Konsensen. Hermeneutik ist eine Philosophie der Auslegung, die stets mehr als nur die Interpretation eines Textes in den Blick genommen hat. Ausgelegt werden nicht nur Texte, sondern auch Lebenssituationen, Menschen, Verhältnisse. Alles muss, um verstanden zu werden, einer Deutung unterzogen werden. Deutungen finden Gestalt in Texten, Gesprächen und anderen sozialen Formen der Interaktion. Im digitalen Zeitalter wird auch dabei das Internet auf verschiedene Weise wirksam, zum Beispiel weil es andere Deutungen bereitstellt. Die digitale Kultur multipliziert und potenziert also den Prozess des Verstehens.
 14. Bibel im Kopfhörer: In einem Tagungshaus besuchte ich die Morgenandacht vor dem Frühstück. Man versammelte sich im ausgebauten Dachstuhl. Die Andacht hielt ein junger Mann in Shorts und T-Shirt; er absolvierte in der Tagungsstätte ein freiwilliges soziales Jahr. Er sprach über den Propheten Daniel und erklärte als erstes, er „habe es nicht so“ mit dem Lesen. Darum habe er sich vor einiger Zeit die Bibel als App auf sein Smartphone geladen. Seitdem benutze er die Bibel ausschließlich als Hörbuch, auf für die Vorbereitung von Andachten. „Da habe ich mir das ganze Buch Daniel angehört.“ Nicht die Auslegung über den Propheten Daniel interessiert hier, sondern der Umgang mit der Bibel. Selbstverständlich steht es jedem Christen offen, die Bibel selbst zu lesen, sie sich anzuhören oder vorlesen zu lassen. Aber wer nur hört, der begegnet doch einigen Schwierigkeiten. Es ist umständlicher, sich einen Satz oder eine Passage ein zweites Mal anzuhören als einfach zwei Zeilen nach oben zu springen und neu mit der Lektüre zu beginnen. Für das Gelesene kann der Hörer einen strukturellen, von vornherein gliedernden Blick entwickeln, das Gehörte hat den Vorteil des unmittelbaren Eindrucks. Auf der anderen Seite gibt es keine Möglichkeit, eigenen Gedanken nachzuhängen als die Stopptaste.
14. Bibel im Kopfhörer: In einem Tagungshaus besuchte ich die Morgenandacht vor dem Frühstück. Man versammelte sich im ausgebauten Dachstuhl. Die Andacht hielt ein junger Mann in Shorts und T-Shirt; er absolvierte in der Tagungsstätte ein freiwilliges soziales Jahr. Er sprach über den Propheten Daniel und erklärte als erstes, er „habe es nicht so“ mit dem Lesen. Darum habe er sich vor einiger Zeit die Bibel als App auf sein Smartphone geladen. Seitdem benutze er die Bibel ausschließlich als Hörbuch, auf für die Vorbereitung von Andachten. „Da habe ich mir das ganze Buch Daniel angehört.“ Nicht die Auslegung über den Propheten Daniel interessiert hier, sondern der Umgang mit der Bibel. Selbstverständlich steht es jedem Christen offen, die Bibel selbst zu lesen, sie sich anzuhören oder vorlesen zu lassen. Aber wer nur hört, der begegnet doch einigen Schwierigkeiten. Es ist umständlicher, sich einen Satz oder eine Passage ein zweites Mal anzuhören als einfach zwei Zeilen nach oben zu springen und neu mit der Lektüre zu beginnen. Für das Gelesene kann der Hörer einen strukturellen, von vornherein gliedernden Blick entwickeln, das Gehörte hat den Vorteil des unmittelbaren Eindrucks. Auf der anderen Seite gibt es keine Möglichkeit, eigenen Gedanken nachzuhängen als die Stopptaste.
15. Predigt als Rede: Der Hermeneutik des Lesens entspricht die Predigt als lebendige, - hoffentlich frei - vorgetragene Rede. Mit dem Aufkommen der Digitalisierung sind alle Formen der freien Rede in eine Krise geraten: die Vorlesung, die Wahlkampfrede, der Vortrag und eben auch die Predigt. Es reicht nicht mehr aus für die Zuhörer, einfach nur zuzuhören. Selbst in einem Rotary Club wird erwartet, dass der Vortragende eine Powerpoint Präsentation mitbringt, um seine Worte mit Bildern und kleinen Filmen anschaulich zu machen. Diese uneingestandene, aber immer häufiger artikulierte Weigerung der Zuhörer, sich nur auf gehörte Worte zu konzentrieren, beeinflusst fundamental alle Formen des gesprochenen Wortes. Die Predigt ist deshalb besonders betroffen, weil in ihr ja Zusammenhänge des Glaubens illustriert werden sollen, die gar nicht so leicht illustriert und bebildert werden können. Wenn es jemand dennoch versucht, dann wirkt es oft kitschig. Deswegen ist im digitalen Zeitalter die Predigt in eine Krise geraten. Sie wird immer kürzer und immer banaler. An die Stelle der Auslegung treten vielfach stark aufgeblasene Gefühle, die immer häufiger in der abgestandenen Sprache schlechter Alltagslyrik artikuliert werden. Hermeneutik, Auslegung und Theologie treten in den Hintergrund. Wenn es ein Prediger doch versucht, wird seine Predigt als menschenfern, zu abstrakt, zu intellektuell kritisiert. Die Zuhörer greifen zum Handy, weil ihre Aufmerksamkeit allein durch Worte (solo verbo) nicht mehr abgedeckt ist.
16. Schriftkultur: Buchreligionen stiften in ihrer Entwicklung ein besonderes Verhältnis zum Mündlichen und zum Schriftlichen. Es geht um Reden und Schreiben, mit dem Ziel der sinnstiftenden Verständigung. Die Digitalisierung verändert die schriftliche wie die rhetorische Kultur von Grund auf, und zwar durch einen Verlust an Unmittelbarkeit. Wer sich einen Vortrag oder eine Predigt als Youtube Video anschaut, hat die Unmittelbarkeit des Gegenübers von Redner und Zuhörern verloren. Wer einen Text nicht mehr von Hand oder – wie Winston Churchill – auf der Schreibmaschine tippt, der gewinnt auf dem Bildschirm eine Vielzahl von Veränderungsmöglichkeiten, der verliert aber auf der anderen Seite die Unmittelbarkeit der Schreiberfahrung.
17. Papier anfassen: PPapier kann man anfassen, und es ist entscheidend wichtig, wie das Schreibwerkzeug (Füller, Bleistift, Kugelschreiber) mit dem Papier harmoniert. Papier[10] hat etwas Reines, Glattes, manchmal auch Raues, manchmal auch Schweres und Steifes, manchmal auch sehr Dünnes, schnell und leicht Zerreißbares. Papier will berührt sein. Und es fasziniert durch die Vielfalt seiner Sorten. Dabei meine ich nicht das furchtbare ökologische Papier, das dem Schreiber die politisch korrekte Rechthaberei seiner Propagandisten schon beim Begreifen ostentativ entgegenstreckt. Das Aufkommen des Digitalen hat keineswegs dazu geführt, dass die Menschen nicht mehr auf Papier schreiben. Im Gegenteil: Leere Notizbücher mit linierten oder unlinierten Seiten haben Konjunktur, die Marke Moleskine, die der Schriftsteller Bruce Chatwin bekannt gemacht hat, hat mit diesem Trend enorme Umsätze erzielt.[11] Auch wenn die Verlage solcher Notizbücher mit Techniken experimentieren, bei denen die Aufschreiber ihre Notizen unmittelbar digitalisieren können, bleibt der – garstig breite – Graben zwischen Analogem und Digitalem dennoch bestehen. Wie man früher die Poesiealben mit selbstklebenden Bildchen verschönerte, tut man das heute mit den beliebt gewordenen Bullet Journals[12].
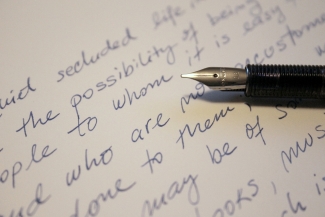 18. Von eigener Hand: Sehr fortschrittliche Schulen sind der Meinung, Kinder müssten überhaupt nicht mehr mit der Hand schreiben lernen, weil über kurz oder lang sowieso nur noch auf einer Tastatur getippt werde[13]. So weit ist man in Deutschland noch nicht, obwohl das Thema Schreibschrift Grundschullehrer, Eltern und ABC-Schützlinge endlos beschäftigen kann. Früher schrieb man nicht lateinisch, sondern in Sütterlin[14], was heute, wenn man nicht Archivar oder über achtzig ist, beim Lesen Schwierigkeiten bereitet. Schreiben ist eine entscheidend wichtige Kulturtechnik, um sich Zusammenhänge anzueignen und sie zu verstehen. In der eigenen Schrift zeigt sich etwas vom eigenen Charakter, von Identität und Persönlichkeit. Das lässt sich behaupten, ohne der leicht anrüchigen Wissenschaft von der Graphologie, die stets in die Nähe der Astrologie gerückt wird, gleich auf den Leim zu gehen. Psychologische Studien zeigen, dass, derjenige, der sich von einem Vortrag oder einem gelesenen Text handschriftliche Notizen macht, ihn besser verstehen kann als derjenige, der diese Notizen nur in seinen Laptop oder auf sein Tablet getippt hat. Wer mit der Hand – manu proprio – schreibt, versteht besser, was er selbst oder andere gedacht haben[15]. Dabei stehen jedem Schreiber verschiedene Schriften zu Gebote, lässigere für Fälle, in denen es schnell gehen muss, genauere und sorgfältigere, wenn Zeit zum Nachdenken und Notieren ist und es nicht drängt. Im Übrigen profitieren Lehrer für Kalligraphie, neuerdings Handlettering genannt, von den Versäumnissen der Grundschulen[16], denn in der Schrift ist selbstverständlich auch eine ästhetische Komponente enthalten, die an Volkshochschulen und in Schreibkursen gelehrt wird. Dem gegenüber wirken digitale Computerschriften (Fonts), die im Schriftbild den Charakter einer Handschrift suggerieren, lächerlich.
18. Von eigener Hand: Sehr fortschrittliche Schulen sind der Meinung, Kinder müssten überhaupt nicht mehr mit der Hand schreiben lernen, weil über kurz oder lang sowieso nur noch auf einer Tastatur getippt werde[13]. So weit ist man in Deutschland noch nicht, obwohl das Thema Schreibschrift Grundschullehrer, Eltern und ABC-Schützlinge endlos beschäftigen kann. Früher schrieb man nicht lateinisch, sondern in Sütterlin[14], was heute, wenn man nicht Archivar oder über achtzig ist, beim Lesen Schwierigkeiten bereitet. Schreiben ist eine entscheidend wichtige Kulturtechnik, um sich Zusammenhänge anzueignen und sie zu verstehen. In der eigenen Schrift zeigt sich etwas vom eigenen Charakter, von Identität und Persönlichkeit. Das lässt sich behaupten, ohne der leicht anrüchigen Wissenschaft von der Graphologie, die stets in die Nähe der Astrologie gerückt wird, gleich auf den Leim zu gehen. Psychologische Studien zeigen, dass, derjenige, der sich von einem Vortrag oder einem gelesenen Text handschriftliche Notizen macht, ihn besser verstehen kann als derjenige, der diese Notizen nur in seinen Laptop oder auf sein Tablet getippt hat. Wer mit der Hand – manu proprio – schreibt, versteht besser, was er selbst oder andere gedacht haben[15]. Dabei stehen jedem Schreiber verschiedene Schriften zu Gebote, lässigere für Fälle, in denen es schnell gehen muss, genauere und sorgfältigere, wenn Zeit zum Nachdenken und Notieren ist und es nicht drängt. Im Übrigen profitieren Lehrer für Kalligraphie, neuerdings Handlettering genannt, von den Versäumnissen der Grundschulen[16], denn in der Schrift ist selbstverständlich auch eine ästhetische Komponente enthalten, die an Volkshochschulen und in Schreibkursen gelehrt wird. Dem gegenüber wirken digitale Computerschriften (Fonts), die im Schriftbild den Charakter einer Handschrift suggerieren, lächerlich.
 19. Tintenblau: Neben dem Papier gewinnt auch das Schreibgerät Bedeutung. Kinder in der Grundschule sind erpicht darauf, ihren Füller-Führerschein zu erhalten. Tinte, auch aus der Patrone, kann schmieren und kleksen. Die alte Kontroverse zwischen Geha und Pelikan in den Schulklassen ist längst Vergangenheit, und vermutlich benutzt auch niemand mehr die merkwürdigen Tintenkiller, die so merkwürdig rochen, dass die „Killer“ mit Zitronengeschmack unter Schülern zu einem Renner wurden. Wie das leere Notizbuch erleben Füller eine Renaissance, auch unter Studierenden[17], die wieder häufiger mit der Hand schreiben. Papier, Notizbücher und Füller[18] gehören zusammen: Ihr zunehmender Gebrauch dokumentiert den Widerstand gegen das Digitale, obwohl in diesem Fall niemand in Alternativen denken sollte.
19. Tintenblau: Neben dem Papier gewinnt auch das Schreibgerät Bedeutung. Kinder in der Grundschule sind erpicht darauf, ihren Füller-Führerschein zu erhalten. Tinte, auch aus der Patrone, kann schmieren und kleksen. Die alte Kontroverse zwischen Geha und Pelikan in den Schulklassen ist längst Vergangenheit, und vermutlich benutzt auch niemand mehr die merkwürdigen Tintenkiller, die so merkwürdig rochen, dass die „Killer“ mit Zitronengeschmack unter Schülern zu einem Renner wurden. Wie das leere Notizbuch erleben Füller eine Renaissance, auch unter Studierenden[17], die wieder häufiger mit der Hand schreiben. Papier, Notizbücher und Füller[18] gehören zusammen: Ihr zunehmender Gebrauch dokumentiert den Widerstand gegen das Digitale, obwohl in diesem Fall niemand in Alternativen denken sollte.
20. Eine Zeile Display: Als ich Student war, schrieb ich die letzten Seminararbeiten und die Examensarbeit auf einer Schreibmaschine, die damals als revolutionär galt. Sie besaß ein winziges Display und einen Speicher von einer Zeile Text. Die Schreibmaschine stammte von der Firma Brother. Nach jeder Zeile konnte man den gesamten Text durch das Display laufen lassen und dann die nötigen Korrekturen vornehmen, bevor die Maschine die einzelnen Zeilen auf das Blatt druckte. Das ersparte den exzessiven Gebrauch der briefmarkengroßen Tipp-Ex-Blättchen, an denen man sich stets die Finger mit weißer Farbe verschmierte. Für uns Studenten bedeutete diese Brother-Schreibmaschine, die wir uns gegenseitig ausliehen, einen enormen Fortschritt, ersparte sie doch das wiederholte Abtippen von Seiten, die durch zu viele Druckfehler verunstaltet waren.
21. Zehn Kopien eine Mark: Das Tippen war nötig, um Texte mit dem Kopierer vervielfältigen zu können, auch um aus Büchern Texte zu kopieren, wenn man sich das gesamte Buch nicht kaufen oder nur aus der Bibliothek leihen konnte. In der Frühzeit des Digitalen war an Farbkopien noch nicht zu denken. Eine Kopie kostete den berühmten einen Groschen. Ich erinnere, jahrelang Kopien in Heftern und Aktenordnern gesammelt zu haben. Diese Ordner habe ich längst zum Altpapier gegeben. Wenn ich noch kopiere, dann scanne ich die Texte und lasse mir die Scans automatisch auf mein Email-Konto schicken. Die Seminarordner, die früher in der Bibliothek stets dann verstellt worden waren, wenn man sie dringend suchte, werden nicht mehr eingerichtet. Kopiervorlagen haben ausgedient. Eine Ansammlung von Kopierern nennt man Copy-Shop, und diese sind wichtig für die Vervielfältigung von Master- und Bachelorarbeiten, Dissertationen und Habilitationen. Aber nach meinem Eindruck sterben die Copyshops aus wie die Buchhandlungen, vor allem wenn jeder Student seine Kopien mit einer Scan-App auf dem Handy anfertigen kann. Die App verwandelt die Scans automatisch in eine pdf-Datei. Im Grunde bedeutet das, dass immer weniger Texte ausgedruckt werden. Ich habe in meinen Seminaren schon Studierende beobachtet, die die für die Sitzung zu lesenden Aufsätze auf dem Smartphone verfolgt haben.
22. Matrizendrucker: Vor den Kopierern standen für die Vervielfältigung von Texten nur Matrizendrucker zur Verfügung. Das war jedoch mit Schwierigkeiten verbunden. Die Vorlage, die getippt wurde, durfte keine Druckfehler enthalten, weil wegen des Durchschlags nicht korrigiert werden konnte. Matrizenvorlagen wurden stets auf gelblichem Papier in blauer, in der Regel schlecht lesbarer Schrift ausgedruckt. Charakteristisch war der beißende Geruch nach Alkohol, den die einen als berauschend, die anderen als unangenehm empfanden. Wie beim Tintenkiller sorgte der Geruch dafür, dass alle, die auf solchen Matrizenblättern ihre Klausuraufgaben erhielten, das Gerät fest in der Erinnerung behielten.
 23. Zettelkasten: Wer liest und schreibt, interpretiert und deutet, der sammelt und ordnet seine Erkenntnisse häufig in einem Zettelkasten. Die einfachste Form ist der alphabetische Buchkatalog in den Bibliotheken. Diese werden mittlerweile nicht mehr weiter bestückt, und aus den meisten Bibliotheken sind sie verschwunden. Viel spannender sind die Zettelkästen, die Wissenschaftler angelegt haben, um ihre Gedanken zu ordnen und zu systematisieren, Bücher und Aufsätze zu schreiben. Innerhalb gewisser Grenzen bieten Zettelkästen die Möglichkeit, Systematiken nach den eigenen intellektuellen Bedürfnissen einzurichten. Deswegen sind die Zettelkästen des Kulturphilosophen Hans Blumenberg und des Soziologen Niklas Luhmann Gegenstand ehrfürchtiger Bewunderung geworden, weil beide ihre ganz unterschiedlichen Zettelkästen leidenschaftlich pflegten. Das Literaturarchiv in Marbach hat vor einiger Zeit ganz unterschiedlicher Modelle literarischer und wissenschaftlicher Zettelkästen in einer faszinierenden Ausstellung gezeigt.[19] Leider ist das jeweilige System, dem sich beide verschrieben hatten, nicht so einfach übertragbar. Der Zettelkasten ist der Versuch, innerhalb des eigenen Denkens und der eigenen Lektüre dergestalt Ordnung zu stiften, das sich kleinere oder größere Teile daraus zu neuen Büchern und Aufsätzen ordnen. Das konnte so weit gehen, dass Luhmann mit einem gewissen Maß an Ironie zu bemerken pflegte, dass es sein Zettelkasten sei, der seine Bücher schreibe. Diese Ordnung der Zettel lässt sich im Digitalen reproduzieren; selbstverständlich gibt es längst Programme für digitale Zettelkästen, insbesondere für die Verwaltung von Literaturverzeichnissen und Anmerkungen. Aber die Programme können die Faszination, die ein analoger Zettelkasten aus Holz, Karteikästen und beschrifteten Karten ausübt, nicht ersetzen.
23. Zettelkasten: Wer liest und schreibt, interpretiert und deutet, der sammelt und ordnet seine Erkenntnisse häufig in einem Zettelkasten. Die einfachste Form ist der alphabetische Buchkatalog in den Bibliotheken. Diese werden mittlerweile nicht mehr weiter bestückt, und aus den meisten Bibliotheken sind sie verschwunden. Viel spannender sind die Zettelkästen, die Wissenschaftler angelegt haben, um ihre Gedanken zu ordnen und zu systematisieren, Bücher und Aufsätze zu schreiben. Innerhalb gewisser Grenzen bieten Zettelkästen die Möglichkeit, Systematiken nach den eigenen intellektuellen Bedürfnissen einzurichten. Deswegen sind die Zettelkästen des Kulturphilosophen Hans Blumenberg und des Soziologen Niklas Luhmann Gegenstand ehrfürchtiger Bewunderung geworden, weil beide ihre ganz unterschiedlichen Zettelkästen leidenschaftlich pflegten. Das Literaturarchiv in Marbach hat vor einiger Zeit ganz unterschiedlicher Modelle literarischer und wissenschaftlicher Zettelkästen in einer faszinierenden Ausstellung gezeigt.[19] Leider ist das jeweilige System, dem sich beide verschrieben hatten, nicht so einfach übertragbar. Der Zettelkasten ist der Versuch, innerhalb des eigenen Denkens und der eigenen Lektüre dergestalt Ordnung zu stiften, das sich kleinere oder größere Teile daraus zu neuen Büchern und Aufsätzen ordnen. Das konnte so weit gehen, dass Luhmann mit einem gewissen Maß an Ironie zu bemerken pflegte, dass es sein Zettelkasten sei, der seine Bücher schreibe. Diese Ordnung der Zettel lässt sich im Digitalen reproduzieren; selbstverständlich gibt es längst Programme für digitale Zettelkästen, insbesondere für die Verwaltung von Literaturverzeichnissen und Anmerkungen. Aber die Programme können die Faszination, die ein analoger Zettelkasten aus Holz, Karteikästen und beschrifteten Karten ausübt, nicht ersetzen.
 24. Bibliothek: Bibliotheken erweitern die Möglichkeiten von Zettelkästen stark. Abgesehen davon bieten sie das ästhetische Erlebnis von Büchern und Regalen[20]. Die Karteikästen mit den alphabetischen Katalogen sind, wie erwähnt, verschwunden. Die Kataloge sind digitalisiert worden und bieten, vor allem in Kombination mit einer Online-Recherche, sehr viel mehr Möglichkeiten als die alte analoge Variante. Wenn ich meine eigenen Erfahrungen mit einbringe, so recherchiere ich mittlerweile 80 % meiner Arbeitszeit im Internet. Dafür nutze ich lokale und thematische Bibliotheksportale. In die Bibliothek gehe ich nur noch, um Bücher abzuholen, auszuleihen oder Teile daraus zu scannen. Das hat Konsequenzen für die Bibliotheken selbst. Ihr Angebot geht neuerdings weit über das Verleihen von Büchern hinaus.[21]
24. Bibliothek: Bibliotheken erweitern die Möglichkeiten von Zettelkästen stark. Abgesehen davon bieten sie das ästhetische Erlebnis von Büchern und Regalen[20]. Die Karteikästen mit den alphabetischen Katalogen sind, wie erwähnt, verschwunden. Die Kataloge sind digitalisiert worden und bieten, vor allem in Kombination mit einer Online-Recherche, sehr viel mehr Möglichkeiten als die alte analoge Variante. Wenn ich meine eigenen Erfahrungen mit einbringe, so recherchiere ich mittlerweile 80 % meiner Arbeitszeit im Internet. Dafür nutze ich lokale und thematische Bibliotheksportale. In die Bibliothek gehe ich nur noch, um Bücher abzuholen, auszuleihen oder Teile daraus zu scannen. Das hat Konsequenzen für die Bibliotheken selbst. Ihr Angebot geht neuerdings weit über das Verleihen von Büchern hinaus.[21]
 Wer einmal die Bodleian Library[22] in Oxford oder die Library of Congress in Washington, D.C. gesehen hat, der kann ermessen, welche gigantischen Ausmaße das Sammeln von Büchern annehmen kann. Neben großen und riesigen Bibliotheken stehen auf der anderen Seite die Bücherbusse, welche viele kleinere Mengen von Büchern in die Dörfer und Vorstädte transportieren, dorthin wo sonst eine Bibliothek schwer erreichbar wäre.
Wer einmal die Bodleian Library[22] in Oxford oder die Library of Congress in Washington, D.C. gesehen hat, der kann ermessen, welche gigantischen Ausmaße das Sammeln von Büchern annehmen kann. Neben großen und riesigen Bibliotheken stehen auf der anderen Seite die Bücherbusse, welche viele kleinere Mengen von Büchern in die Dörfer und Vorstädte transportieren, dorthin wo sonst eine Bibliothek schwer erreichbar wäre.
Digitalisierung hat zu dem umstrittenen Projekt geführt, mit Hilfe des Google-Konzerns alle Bücher dieser Welt zu digitalisieren und damit sämtlichen geographischen Schranken für die Einsichtnahme in Bücher zu beseitigen. Leider ist dieses Projekt ins Stocken geraten. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, denn es würde die allgemeine Verfügbarkeit literarischer, wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse beträchtlich erweitern. Und ich bin sicher, dass solch ein Projekt nicht zur Abschaffung von Bibliotheken führen würde – im Gegenteil.
 25. Die digitale Akte: Durch die Schreibstuben geistert die Vision digitaler Akten. Eingehende Schriftstücke werden in Pdf-Dateien verwandelt, verschlagwortet und so abgelegt, dass jeder Berechtigte schnell finden kann, was er sucht. Im Endeffekt soll so ein papierloses Büro entstehen, das langfristig Aktenschränke und -regale, später dann auch Archive überflüssig macht. Die Dokumente werden auf Festplatten oder gleich in der Cloud gelagert. Digitalisierung steigert die Möglichkeiten zur Recherche, aber genauso die Wahrscheinlichkeit, dass Unbefugte an Schriftstücke herankommen, die nicht für ihre Augen bestimmt sind. Je mehr Schriftstücke in Pdf-Dateien verwandelt werden, desto wichtiger wird der Bildschirm als Schnittstelle. Es braucht mehr Rechenleistung und vor allem größere und genauer auflösende Bildschirme, vielleicht sogar mehrere pro Arbeitsplatz. Wer recherchieren will, möchte vielleicht mehrere Dokumente nebeneinander legen, dazu ein weiteres Bildschirmfenster öffnen, in dem er sich Notizen machen kann. Wer aber stundenlang auf einen Bildschirm starrt, um Akten und Dokumente zu studieren, der braucht einen Bildschirm, der ihm diese Lektüre so weit wie möglich erleichtert, ohne Flimmern und Farbverschiebungen. Egal ob Gerichtsakte, Patientenakte oder Verwaltungsdokumente, sie werden vermutlich in der näheren Zukunft nur noch digital vorhanden sein. Wichtig erscheint, dass die Zugänge geregelt sind. Nicht jeder soll auf Patientendaten, Gerichtsurteile und Personalakten zugreifen können.
25. Die digitale Akte: Durch die Schreibstuben geistert die Vision digitaler Akten. Eingehende Schriftstücke werden in Pdf-Dateien verwandelt, verschlagwortet und so abgelegt, dass jeder Berechtigte schnell finden kann, was er sucht. Im Endeffekt soll so ein papierloses Büro entstehen, das langfristig Aktenschränke und -regale, später dann auch Archive überflüssig macht. Die Dokumente werden auf Festplatten oder gleich in der Cloud gelagert. Digitalisierung steigert die Möglichkeiten zur Recherche, aber genauso die Wahrscheinlichkeit, dass Unbefugte an Schriftstücke herankommen, die nicht für ihre Augen bestimmt sind. Je mehr Schriftstücke in Pdf-Dateien verwandelt werden, desto wichtiger wird der Bildschirm als Schnittstelle. Es braucht mehr Rechenleistung und vor allem größere und genauer auflösende Bildschirme, vielleicht sogar mehrere pro Arbeitsplatz. Wer recherchieren will, möchte vielleicht mehrere Dokumente nebeneinander legen, dazu ein weiteres Bildschirmfenster öffnen, in dem er sich Notizen machen kann. Wer aber stundenlang auf einen Bildschirm starrt, um Akten und Dokumente zu studieren, der braucht einen Bildschirm, der ihm diese Lektüre so weit wie möglich erleichtert, ohne Flimmern und Farbverschiebungen. Egal ob Gerichtsakte, Patientenakte oder Verwaltungsdokumente, sie werden vermutlich in der näheren Zukunft nur noch digital vorhanden sein. Wichtig erscheint, dass die Zugänge geregelt sind. Nicht jeder soll auf Patientendaten, Gerichtsurteile und Personalakten zugreifen können.
26. Recherchelust: Wenn ich meine eigene Arbeitsweise im Rückblick betrachte, so ist das Recherchieren im Internet und in mir zugänglichen Datenbanken immer wichtiger geworden, gerade im Vergleich mit der Nutzung von Bibliotheken. Letztere nutze ich am Schreibtisch, um in Suchmaschinen zu recherchieren. In Bibliotheken gehe ich nur noch, wenn ich wirklich Bücher ausleihen will. Ich gestehe, dass mir die Recherche im Internet einen gewissen Spaß bereitet, denn man muss detektivischen Scharfsinn entwickeln, um das zu finden, was einen interessiert. Umso größer ist dann die Freude, wenn sich im Internet ein Hinweis genau das findet, wonach ich gesucht habe. Noch besser, wenn ich als User dann sofort unmittelbaren Zugang zu dem gesuchten Dokument habe. Ich muss nicht in die Bibliothek gehen, sondern kann mir gleich die pdf anschauen oder sie ausdrucken. Verwertbares Material im Internet zu suchen und zu sammeln[23], scheint mir einer der faszinierendsten Vorteile der Digitalisierung zu sein.
27. Digital Humanities: Im alten, hermeneutischen, vordigitalen Modus der wissenschaftlichen Abhandlung war die Interpretation die klassische Form, mit der Philosophen, Theologen und Kulturwissenschaftler sich bestimmten Themen näherten: das Abendmahl bei Lukas, das Sonett bei Goethe oder der Einfluss Hegels auf Adornos negative Ästhetik, das waren Themen, denen sich Kulturwissenschaftler auf dem Weg der Textinterpretation näherten. Mit der Digitalisierung haben solche Studien erheblich an Einfluss verloren. Plötzlich werden nicht mehr einzelne Texte, sondern riesige Textmengen zur Grundlage von Untersuchungen gemacht. Die alte Hermeneutik wird abgelöst und/oder ergänzt von den Digital Humanities. Mit Hilfe von Suchmaschinen und Datenbankprogrammen lassen sich riesige Textmengen untersuchen. Die gegenwärtige Konjunktur der Digital Humanities[24] lebt von der Aussicht auf neue, unerwartete Ergebnisse. Ob das den Hype um diese neue Forschungsrichtung rechtfertigt, bleibt abzuwarten. Ob man mit letztlich statistischen Methoden Texten (Verhältnissen und Menschen) näher kommen kann als mit empathischer, nach-denkender Interpretation, scheint mir genauso eine offene Frage.
28. Papierstau! Der Papierstau[25] ist das negative Ausrufezeichen, das gesetzt wird, wenn das Digitale in die Kohlenstoffwelt zurückkehren will. Die digitale Nahrungskette in Bürokratie und Wissenschaft lockt ihre Anwender mit der Vision der Papierlosigkeit. Auch diese Zeitschrift „tà katoptrizómena“ erscheint nur noch im Internet, sie wird nicht gedruckt, aber trotzdem in Bibliotheken gelistet. Im Moment ist es für Wissenschaftler, Richter, Verwaltungsbeamte und andere irgendwann doch notwendig, ihre Texte, die Ergebnisse ihrer Recherchen auszudrucken. Der Drucker ‚spuckt‘ dann den Text aus, und regelmäßig kommt es dabei, vor allem wenn es schnell gehen muss, zum Papierstau. Das nötigt den User, umständlich den Drucker zu öffnen und alle noch nicht oder nur halb bedruckten Blätter müssen aus dem Gewirr von Leitungen, metallischen Walzen, Hebeln und Klappen herauszuziehen. Besonders schwierig wird das, wenn die Blätter reißen und Teile im Drucker stecken bleiben. Denn der Drucker schaltet nicht auf das grüne Licht zum Weiterdrucken, bevor nicht jedes Fitzelchen Papier aus der Maschine entfernt ist. Je länger es dauert, desto größer wird der Ärger des Users. Verwandt ist dieser Ärger mit der Unruhe, die entsteht, wenn vor einem Vortrag mit zahlreichem Publikum der Beamer des Vortragssaals und der Laptop des Vortragenden nicht kooperieren wollen, weil die Schnittstellen nicht zusammenpassen oder weil irgendeine unbekannte technische Neurose die beiden Geräte hindert, sich miteinander zu verbinden.
29. Die Buchhandlung Ihres Vertrauens: Neben der Recherche im Internet zählt es zu meinen großen Vergnügen, in Buchhandlungen nach Büchern zu stöbern. Ich mag es, wenn in großen Buchhandlungen auch ein Café eingerichtet ist, in dem ich bei einem Cappuccino die Bücher durchblättern kann, die ich gekauft habe. Obwohl Buchhandlungen also vergnügliche und angenehme Orte[26] sind, ist ihre Zahl in den meisten großen Städten in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. An die Stelle von eigentümergeführten Buchhandlungen treten große, anonyme Ketten, deren Auslagen stets auf Verkaufszahlen und nicht auf Kennerschaft und Liebhaberei beruhen. Auch Fachbuchhandlungen für Philosophie, Theologie oder andere Themen sind fast ganz verschwunden. Dasselbe gilt für Antiquariate. Legendäre Buchhandlungen wie zum Beispiel Blackwell in Oxford, das sich ungebrochener Beliebtheit erfreut, bilden die große Ausnahme. Die Gründe für das Sterben von Buchhandlungen sind vielschichtig: Niemand kauft mehr einen gebundenen Straßenatlas, wenn ihm im Auto ein Navi beim Erreichen des Ziels hilft. Viele Menschen gehen nicht mehr in eine Buchhandlung, wenn sie den Buchkauf bequemer im Internet erledigen können. Und für die immer beliebteren Ebooks muss man schon gar keine Buchhandlung aufsuchen, es genügen ein Computer und W-LAN. Auch bei Ebooks kann man stöbern, aber es besitzt weit weniger Charme, in einer zur pdf konzentrierten Leseprobe zu blättern als in einem „echten“, in Leinen gebundenen Buch mit schönem Schriftbild und originellem Umschlag.
 30. Die private Bibliothek: Früher galt es als chic, viele Regale mit Büchern in der Wohnung aufzustellen. Das galt besonders für die Arbeitszimmer von Pfarrern, Professoren, Rechtsanwälten und Lehrern. Heute gilt das nicht mehr. Bücherregale scheinen den digitalen Verweigerern vorbehalten, Rentnern, Pensionären und Leuten, die den Verdacht nicht ausräumen können, Messies zu sein. Bücher gelten als umständlich, schwerfällig, schwierig (und schwer) bei Umzügen, als Staubfänger und grobes Hindernis auf dem Weg zu einer minimalistischen Wohnkultur[27]. Niemand mehr muss ein Konversationslexikon in 24 Bänden besitzen. Wer seine Bücher loswerden will, wählt den brutalen Weg über die Altpapiersammlung[28] oder den humanistischen Weg über die Büchertausch-Telefonzellen, die allenthalben auf Plätzen und an Bushaltestellen aufgestellt werden. Antiquare, wenn es sie überhaupt noch gibt, nehmen keine alten Bücher mehr an[29]. Sie erzielen damit keine Erlöse mehr. Bei Testamentsvollstreckungen werden als erstes die alten Bücher entsorgt, weil sie angeblich niemand mehr lesen will. Eine private Bibliothek ist vom Merkmal sozialer Distinktion zum Ballast, ja zum Makel geworden. Dass trotzdem noch Bibliophile enthusiastisch Bücher sammeln und zu Bibliotheken zusammenstellen, dementiert nicht die Grundtendenz des Niedergangs von privaten Bibliotheken.
30. Die private Bibliothek: Früher galt es als chic, viele Regale mit Büchern in der Wohnung aufzustellen. Das galt besonders für die Arbeitszimmer von Pfarrern, Professoren, Rechtsanwälten und Lehrern. Heute gilt das nicht mehr. Bücherregale scheinen den digitalen Verweigerern vorbehalten, Rentnern, Pensionären und Leuten, die den Verdacht nicht ausräumen können, Messies zu sein. Bücher gelten als umständlich, schwerfällig, schwierig (und schwer) bei Umzügen, als Staubfänger und grobes Hindernis auf dem Weg zu einer minimalistischen Wohnkultur[27]. Niemand mehr muss ein Konversationslexikon in 24 Bänden besitzen. Wer seine Bücher loswerden will, wählt den brutalen Weg über die Altpapiersammlung[28] oder den humanistischen Weg über die Büchertausch-Telefonzellen, die allenthalben auf Plätzen und an Bushaltestellen aufgestellt werden. Antiquare, wenn es sie überhaupt noch gibt, nehmen keine alten Bücher mehr an[29]. Sie erzielen damit keine Erlöse mehr. Bei Testamentsvollstreckungen werden als erstes die alten Bücher entsorgt, weil sie angeblich niemand mehr lesen will. Eine private Bibliothek ist vom Merkmal sozialer Distinktion zum Ballast, ja zum Makel geworden. Dass trotzdem noch Bibliophile enthusiastisch Bücher sammeln und zu Bibliotheken zusammenstellen, dementiert nicht die Grundtendenz des Niedergangs von privaten Bibliotheken.
31. Digitale Kultur: Ziffer oder Buchstabe: Dem Niedergang, vielleicht besser: der Veränderung der Buch- und Schriftkultur steht der Aufstieg der digitalen Kultur gegenüber. Ziffern überwinden Buchstaben, und elektrischer Strom überwindet Tinte und Graphit. Der Schreiber wird endgültig zum Tipper, und das virtuelle Dokument (die Präsentation, das Video etc.) tritt an die Stelle von Schallplatte, Cassette, Filmrolle und Buch. Die digitale Kultur verändert nicht nur die Tätigkeiten des Lesens und Schreibens, sondern auch den Umgang mit anderen Medien. Weder Ausmaß noch Intensität, weder Ergebnisse noch Spätfolgen dieser fundamentalen kulturellen Umwälzung sind bisher abzusehen. Alles verwandelt sich: Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören. An die Stelle von Buch, Handschrift, Face to Face Kommunikation treten Laptop, Smartphone, Tippen, virtuelle Kommunikation.
32. Zuwachs an Wirklichkeit? Wer es sich einfach macht, behauptet, dass das, was Menschen bisher an Wirklichkeit erlebt haben, einfach um das Virtuelle erweitert wird. Aber so einfach verhält es sich nicht, die ‚Kohlenstoffwirklichkeit‘ wird nicht einfach um die Virtual Reality erweitert. Beide Spielarten der Wirklichkeit durchdringen sich gegenseitig. Die vordigitale Welt war bestimmt durch ihre „Lesbarkeit“ (Hans Blumenberg), durch ein bestimmtes Verhältnis von Schrift, Dokument, Erfahrung, Intellekt und Handeln. Mit dem Aufkommen des Digitalen bricht dieses etablierte Modell zusammen. Aber es ändern sich eben nicht nur die Gebrauchsmodi, sondern es scheint so zu sein, dass man von einem Zuwachs an Wirklichkeit, von einer Erweiterung sprechen muss. Digital natives haben von augmented reality, erweiterter Wirklichkeit gesprochen. Das soll vor allem in unförmigen Brillen Gestalt werden, die Informationen auf die Gläser einspiegeln und damit für ihren Träger verfügbar machen. Wenn solche Brillen technisch für ein Massenpublikum richtig serienreif sind, dann wird das, was bisher Neuland am Horizont war, zu einer neuen Gegenwart, welche die notorischen Optimisten der Technokultur schon jetzt für gekommen halten.
33. Informationsüberflutung: Man täusche sich nicht, dass die Verbreitung der digitalen Kultur nur ein Segen sei. Die Klage über Informationsüberflutung, über den – wie zu lesen war – „Permaregen der Informationen“ ist in den letzten Jahren immer lauter geworden. Aber vor einem Regen kann man sich durch einen Schirm schützen, wenn man die Angst, etwas zu verpassen oder abgehängt zu werden, überwunden hat. Es ist nicht nötig, kontinuierlich am Tropf der Informationen zu hängen. Wer dauernd gespannt auf neue Nachrichten wartet, kann sich nicht mehr entspannen oder beruhigen. Der User stolpert in die Aufmerksamkeitsfalle: Die Überflutung mit Neuem hindert ihn daran, sich zu orientieren. Ganz wichtig: Es reicht nicht, neue Informationen einfach aufzunehmen. Sie müssen auch verarbeitet werden. Verarbeitung bedeutet Einordnung, Zuordnung, das Entwickeln von Perspektiven, Hypothesen und Meinungen. Pure Information ist wertlos, Sinn macht sie nur, wenn sie so durchgearbeitet wird, dass sie zu neuer Orientierung führt. Diese Reflexionsarbeit nimmt dem User kein Tablet und kein Smartphone ab. Unnötig zu sagen, dass das selbstverständlich auch für religiöse Kommunikation gilt. Wer der Informationsflut standhalten will, muss lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist auch theologisch interessant: Denn der Glaubende trifft Entscheidungen darüber, was er für sinnstiftend wichtig hält und was nicht.
34. Globale Netzwerkgesellschaft: Die meisten User und Digital Natives träumen von der globalen Netzwerkgesellschaft. Alles verbindet sich mit allem, nicht nur Menschen mit Menschen, auch Smartphones mit Laptops oder Kühlschränke mit Supermärkten. Wenn alles miteinander vernetzt ist, löst auch die kleinste Bewegung Wellen im Netz aus – wie der berühmte Stein, der ins Wasser fällt. Vernetzung kann Persönlichkeit, die Individualität eines Menschen, korrumpieren, denn alles wird beobachtet, alles wird nachgeahmt. Influencer bestimmen die Trends, und der Rest der Follower macht es nach. Unvernetzte Einsamkeit, splendid isolation, wird zum Luxusgut. Gegenseitige Beobachtung steigert sich ins Massenhafte und Uferlose. Diese Kombination von Statistik, Kalkül und massiver Beobachtung macht vielen Menschen zu Recht Angst.
35. Cyberspace: Trotzdem fühlt sich das Ich im virtuellen Raum freier, ungebundener, oft auch unabhängig von den sozialen Regeln des Respekts. Das gibt es auch in der Kohlenstoffwirklichkeit. Biedere Finanzbeamte geben sich im Internet als cholerische Trolle, wie es Ärzte und Lehrer gibt, die in ihrer Freizeit als Hooligans und Ultras für ihren Fußballclub ‚kämpfen‘. Cyberspace ist ein unverbindlicher Raum: Niemand muss Bindungen eingehen, der User kann sich frei umschauen, einmal hier, einmal dort schnuppern. Es ist virtuelles Leben im virtuellen Raum. Es ist ein Leben ohne Körper. Das Buch aus Papier wird abgelöst vom Ebook. Ähnlich verhält es sich mit dem User: Die Bürger mit Adresse, Pass und Identität werden abgelöst von den anonymen Avataren, die scheinbar unerkannt durch die Datenräume surfen. Es gibt Internet-Pastoren, die verteilen sogar das Abendmahl im virtuellen Raum. Und längst macht es keinen Sinn mehr, zwischen dem Virtuellen und der Kohlenstoffwirklichkeit (dem Sozialen oder dem Handfesten) zu unterscheiden. Die Grenzen beginnen zu verschwimmen. In der Kulturwissenschaft hat diese verschwimmende Grenze mit dazu beigetragen, dass der Körper des Menschen[30] (inklusive Sex und Gender als sozialen Konstruktionen) große neue Aufmerksamkeit gefunden hat.
36. Rückeroberung des Visuellen: Schriftkulturen und Schriftreligionen waren durch Texte geprägt. Die Beschreibung von Wirklichkeit in Texten unterscheidet sich von den neuen Methoden, Wirklichkeit abzubilden. Man hat gesagt, dass es sich in Schrift, Worten und Sätzen besser reflektieren lässt, während Bilder unmittelbarer wirken und den Betrachter ohne die in Worte gefassten Hilfskonstruktionen des Intellektuellen gefangen nehmen. Im Zeitalter des Smartphones gilt jedenfalls die Regel: Was früher notiert wurde, wird jetzt fotografiert. Wo man früher die Gebrauchsanweisung studierte, schaut man sich jetzt ein Youtube-Video an. Wo man sich früher von Freunden Buch-, Restaurant- und Filmempfehlungen geben ließ, schaut man jetzt im Internet. Der Erfolg der Bilderplattform Instagram ist der Beweis für die sich ausbreitende Macht des Visuellen. Wo von den Usern Fotografien und Videos erwartet werden, da gelten Texte nur noch als Bleiwüste. Wo nur noch an Gefühle appelliert wird, sind Texte, die den Leser in die reflexive Versuchung des Intellektuellen führen, nicht mehr nötig.
37. Glückliches Babel (Barthes): Texte führen nicht auf geradem Weg zu glücklicher Verständigung. Schon die Bibel wusste in der Erzählung vom Turmbau in der Genesis, dass es zu Sprachverwirrungen kommen kann. Roland Barthes störte sich an der negativen Bewertung dieser Verwirrung. Für ihn war Babel ein Schlaraffenland: „Der alte biblische Mythos kehrt sich um, die Verwirrung der Sprachen ist keine Strafe mehr, das Subjekt gelangt zur Wollust durch die Kohabitation der Sprachen, die nebeneinander arbeiten: der Text der Lust, das ist das glückliche Babel.“[31] Das Internet hat die Sprachverwirrung des glücklichen Babel noch einmal potenziert. Augustin und Martin Luther konnten sich noch auf die Bibel konzentrieren. Diese Konzentration auf ein Buch wurde abgelöst durch den Blick auf viele Bücher; im digitalen Zeitalter kommen dazu alle virtuellen Texte und nochmals alle Fotos und alle Videos sowie sonstige Datensätze. Das glückliche Babel ist aus einer Kleinstadt zur Megapolis geworden. Entsprechend hat sich die Deutungs- und Interpretationsaufgabe vervielfacht. Und es lohnt sich, die Frage zu stellen, ob wir User mit so vielen Deutungen und Sprachverwirrungen noch glücklich werden können.
38. Interaktivität: Das ist der große Vorteil des Digitalen, jeder kann kommentieren, simsen, chatten, whattsappen, sich unterhalten, reagieren. Der User kann ein Dauergespräch führen, anonym oder nicht anonym. Im guten Fall entwickelt sich eine Diskussion, im schlechten Fall nur dauerhaftes Geplapper, das wie ein Hintergrundrauschen im Cyberspace verhallt. Kommunikation verkommt zum Selbstzweck, und das bedeutet leider einen Qualitätsverlust. Wer die Anstrengung unternimmt, ein Buch zu planen und zu schreiben oder wenigstens einen Aufsatz, wird genötigt, sich über seinen Text Gedanken zu machen, und im Erfolgsfall kommt ein elaborierter, diskutierenswerter Text heraus. Das ist keinesfalls zwingend, aber die Vermutung höheren Reflexionsniveaus hat durchaus etwas Wahrscheinliches, wenn man sie den im Internet verbreiteten spontanen und unmittelbaren Kommentaren und Meinungen von nicht mehr als ein paar hundert Zeichen, wie es bei Twitter üblich ist, gegenüberstellt. Interaktivität sorgt nicht notwendig für Qualität. Trotzdem haben sich insbesondere Parteien darauf eingestellt. Politiker halten keine Reden mehr, sondern stellen sich im Chat den Usern eines Netzwerkes. An die Stelle der Wahlkampfrede ist die Bürgerfragerunde getreten. Sogar im Fernsehen wird diese Entwicklung sichtbar: Politiker halten ihre Rede nicht mehr beim Parteitag mit Logo und Motto der Partei im Hintergrund, sondern die Kamera zeigt sie inmitten von (vorzugsweise jungen) Menschen, mit denen sie diskutieren und deren Fragen sie geduldig beantworten.
39. Social Media: Was früher Gespräche in der Straßenbahn, in der Kneipe oder im Eiscafé waren, verlagert sich immer mehr in die sozialen Medien. Das face to face Gespräch zweier (oder mehrerer) körperlich anwesender Menschen hat sich in den digitalen Raum, in die sozialen Medien verändert. In der Wohnung hat der Computer-Arbeitsplatz den Wohnzimmerplatz, auf dem in früheren Zeiten der Fernseher stand. Wohnräume sind heute bestimmt durch scheußliche Ablagerungen von Kabeln, Anschlüssen, Ladegeräten. Auch soziale Netzwerke unterliegen Moden, der Hype von Facebook ist schon wieder geschwunden und hat sich auf Instagram oder Snapchat verlagert. Die Erkenntnis, dass Freunde auf Facebook im richtigen Leben nicht ziemlich beste Freunde sein müssen, hat sich überall herumgesprochen. Soziale Medien haben eine Gesprächskultur sui generis entwickelt, die sich von alltäglicher Gesprächskultur unterscheidet.
40. Iconic Turn: Der Wechsel von der Schrift zu Bild und Film ist schon angesprochen worden, auch der damit verbundene Gewinn an Emotion und der Verlust an Reflexion. Die Kulturwissenschaften haben ihre Aufmerksamkeit in Reaktion auf solche Entwicklungen weitgehend umgestellt von der Interpretation von Texten auf die Untersuchung von Bildern. Man hat das den iconic turn genannt, und das macht durchaus Sinn, Reflexion auf Bildwirkungen, auf Produktions- und Rezeptionsästhetik zu richten. Letztlich führt das zurück zur theologischen Auseinandersetzung über Bilder und Schrift, von den Kontroversen Martin Luthers mit den Bilderstürmern über die visuelle Pracht des katholischen Barock bis zu den Reflexionen über das Heilige in moderner Kunst. Wobei der Rückgriff auf das Theologische auch zeigt, dass das Problem der Bilder nicht unbedingt an das Digitale gebunden ist. – Seit ich auf Instagram angemeldet bin, frage ich mich, ob man mit Hilfe eines oder mehrerer Bilder auch einen theologischen Gedanken darstellen kann, ohne sich gleich auf das Niveau spirituellen und pictorialen Kitsches zu begeben.
41. Open Source: Diese Reflexionen konzentrieren sich auf Schreiben, Fotografieren, Sichtbarmachen, Publizieren. Damit aber gelangt man nur an die Oberfläche des Digitalen. Sein Innenleben, Motoren und Prozessoren, Festplatten, Grafikkarten, Server und alle weitere Technik, bleibt unberücksichtigt. Die Ebene des Programmierens von Algorithmen, der Soft- und Hardware, wird nicht einmal gestreift. Sie bleibt außen vor, weil der Verfasser dieser Zeilen, gleich den meisten Usern, davon nie mehr als nur eine kleine Ahnung hatte. Diese Verbindung von technischer Unwissenheit und Versiertheit im Gebrauch von digitalen Medien ist kein Kennzeichen der Moderne: Jeder Zeitgenosse benutzt Dinge, von deren Aufbau, Reparatur, Herstellung er kein großes Wissen besitzt. Das gilt für das Auto, die Küchenmaschine und vieles andere mehr. Entsprechend zeigen der Papierstau, der Ausfall des WLAN-Netzes oder das langsame Internet Schwäche und Hilflosigkeit des unkundigen Users, der seine Hilfslosigkeit dann in Zorn auf die Hersteller von Drucker und die Betreiber von WLAN-Netzen wendet. User lieben es, an den Hotlines Telefonisten in indischen Callcentern mit ihrem Zorn zu quälen.
42. Wille zur Wollust (Barthes): Das Internet hat die schiere Menge an Texten, Bildern und Filmen erheblich vergrößert. Umso wichtiger wird dann der Prozess der Auswahl. Der Rezipient muss lernen, sich nicht von seiner oberflächlichen Aufmerksamkeit täuschen zu lassen. Roland Barthes unterschied in den Siebzigern die plappernden Texte von den Texten, die durch den „Wille[n] zur Wollust“[32] gekennzeichnet seien. Für ihn waren plappernde Texte am häufigen Gebrauch von Adjektiven zu erkennen. Wollust scheint nicht in einem verengt sexuellen Sinn gemeint, sondern im Sinne von Begehren (désir) als dem Verfolgen eines Zieles. Was für Texte gilt, gilt umso mehr für die Medien des Internet: Entweder sie plappern und verbreiten nur Langeweile, weil sie nichts wollen, sondern nur wiederholen und bestätigen. Oder sie versuchen, Emotion und Empathie zu wecken, eine These oder ein Argument zu entwickeln. Sie fordern den Leser, Nutzer, Betrachter heraus, und der Leser nimmt diese Herausforderung nach einem – wie auch immer gestalteten – Dialog an.
43. Bin ich schon drin? Öffentliches, freies W-LAN breitet sich weiter aus. Der User will stets online sein, nichts verpassen, keine Mail, keinen Blogpost, keine Sondersendung. Der Zwang, stets online zu bleiben, wirkt sich auch auf viele Berufe aus. So verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit. Der Arbeitnehmer, der ständig auf sein Smartphone schaut, ob neue Nachrichten eingetroffen sind, kann sich nicht mehr entspannen. Er kommt nicht zur Ruhe, weil er stets gewahr sein muss, von Mails mit Arbeitsaufträgen überrascht zu werden. Diese permanente Konnektivität hat auch Gegenbewegungen ausgelöst. Firmen haben angefangen, außerhalb der Kernarbeitszeit keine Mails mehr zu verschicken. Eine alltagstaugliche Kultur des vernünftigen und maßvollen Umgangs mit den digitalen Medien hat sich noch nicht richtig ausgebildet.
44. Intertext (Barthes): Für Roland Barthes, der das Internet noch nicht kennen konnte, stand der Leser nicht nur einem Text gegenüber, sondern einem Gewebe von Texten. Er sprach deshalb vom „Inter-Text“ und meinte damit „die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben“[33]. In der alten Kultur bedeutete Intertext die Verknüpfung von Texten und Lebenswelt, in der neuen, digitalen Kultur kommen zu den Texten im eigentlichen Sinn noch Filme, Fotos und andere Medien hinzu, und man kann mit einem gewissen Recht die Frage stellen, ob durch die Vervielfachung des Genres Text das Gleichgewicht zwischen letzterem und dem Leben nicht aus den Fugen geraten ist. Jeder User, gleich ob er Texte liest, Videos schaut, Games spielt oder Fotos betrachtet, kann sich in der Unendlichkeit des Virtuellen verlieren. Damit gibt er den Kontakt zum Leben preis, der für Barthes entscheidend wichtig war.
45. High Tech Propheten: Viele User haben das Bedürfnis, sich stets an die Spitze des technologischen Fortschritts, im Digitalen High Tech genannt, zu setzen. Sie müssen stets das neueste Gadget einer bestimmten Computerfirma besitzen. Das Streben nach dem Neuen ist auch Ausdruck eines Bedürfnisses nach dem Intensiven, wie Tristan Garcia[34] überzeugend herausgearbeitet hat. Aber diejenigen, die stets an der vordersten Front des Technisch-Digitalen marschieren, stehen auch in der Gefahr, auf die überoptimistischen Propheten hereinzufallen, die stets die Ankündigung einer neuen technischen Entwicklung schon als ihre Verwirklichung verkaufen und Probleme der technischen wie lebensweltlichen Umsetzung tunlichst verschweigen. Der Besitzer des neuesten Gadgets wird dann als unfreiwilliger Tester missbraucht.
 46. Digital Literacy: Wer mit Texten umgehen will, muss schreiben, lesen und deuten (interpretieren) können. Internet und Laptop sind sehr viel komplexere Instrumente als Stift und Papier. Der User muss lernen, damit umzugehen, nicht nur in einem technischen, sondern auch in einem kulturellen Sinn. Er muss wissen, wann es genug ist. Bei Kurznachrichten wie Twitter und SMS hat sich eine eigene Abkürzungssprache herausgebildet. In Facebook und anderen Plattformen werden Emojis genutzt, um die eigenen Sätze mit Bekundungen von Empfindungen und Gefühlen zu unterstreichen. Neulich las ich in einem Artikel, dass immer mehr Empfänger von Emails befremdet sind, wenn eine Email mit der Anrede „Sehr geehrter Herr X“ oder „sehr geehrte Frau Y“ beginnt. Eigentlich ist das eine simple Wahrheit: Wer Medien nutzt, muss die darin gebräuchlichen Regeln kennen. Ob die Regeln immer Sinn machen, ist eine andere Frage.
46. Digital Literacy: Wer mit Texten umgehen will, muss schreiben, lesen und deuten (interpretieren) können. Internet und Laptop sind sehr viel komplexere Instrumente als Stift und Papier. Der User muss lernen, damit umzugehen, nicht nur in einem technischen, sondern auch in einem kulturellen Sinn. Er muss wissen, wann es genug ist. Bei Kurznachrichten wie Twitter und SMS hat sich eine eigene Abkürzungssprache herausgebildet. In Facebook und anderen Plattformen werden Emojis genutzt, um die eigenen Sätze mit Bekundungen von Empfindungen und Gefühlen zu unterstreichen. Neulich las ich in einem Artikel, dass immer mehr Empfänger von Emails befremdet sind, wenn eine Email mit der Anrede „Sehr geehrter Herr X“ oder „sehr geehrte Frau Y“ beginnt. Eigentlich ist das eine simple Wahrheit: Wer Medien nutzt, muss die darin gebräuchlichen Regeln kennen. Ob die Regeln immer Sinn machen, ist eine andere Frage.
47. User: Alteuropäisch bildet sich der mit Würde ausgestattete Mensch zur Persönlichkeit aus. So legt es zum Beispiel das Grundgesetz nahe. Der Bürger wird philosophisch zum Subjekt, das sein Leben in der Hand hat und vor allem gestaltet. Die Rede vom (bürgerlichen) Subjekt ist allerdings längst fragwürdig geworden. Und das Digitale hält eine neue anthropologische Wendung bereit. Die Persönlichkeit, das Subjekt wird zum User. Der handelnde und denkende Mensch, der gestaltet, ist zu einem Wesen geworden, das von digitaltechnischen Maschinen Gebrauch macht – und von ihm abhängig wird. Das Subjekt zeichnete sich durch Freiheit und Gestaltungsspielraum aus; frei im Übrigen auch in der Wahl seiner Hilfsmittel. Der User ist von den Gadgets, der Hard- und Software abhängig. Er hat einiges vom Gestaltungsspielraum des Subjekts verloren. Das Subjekt gestaltet seine Lebenswelt. Der User macht von der Technik Gebrauch.
48. Digitale Apokalyptik: In der Welt der digitalen Utopie wird der noch anthropologisch formierte User bald durch andere, nicht mehr körpergebundene Formen des Bewusstseins abgelöst. Feuilletons verkaufen solche Ideen über den Transhumanismus alle paar Jahre als den letzten und neuesten Schrei digitaler Eliten und Avantgarden, dabei hat sich an den Grundideen seit den Überlegungen Ray Kurtzweils nicht viel geändert.[35] Intellektualität und vernünftiges Handeln binden sich nicht mehr an den Menschen, sondern gehen auf in Supercomputern digitalen Wolken. Die Menschheit entwickelt sich weiter zu einem gigantischen Netzwerk von digitaler Technik. Das hat gleichermaßen die Aura von New Age und Spinnerei, eine Art Post-Anthroposophie für Technofreaks. Aber das spricht nicht gegen anspruchsvolle literarische Science Fiction, so zum Beispiel im auch von Barack Obama hoch gelobten Roman „Amalthea“[36], dessen letzter Teil mit einem der berühmtesten Zeitsprünge in der Literaturgeschichte beginnt: 5000 Jahre später.
49. Prothesengott: Interessanter als der Transhumanismus scheint mir immer noch die berühmte These Sigmund Freuds aus seiner Schrift „Das Unbehagen in der Kultur“[37]wonach sich der Mensch in der Moderne aus einem Mängelwesen in einen Prothesengott verwandelt: Der Mensch arbeitet sich an seinen Mängeln ab und entwickelt technische Hilfsmittel, die ihn schützen, stärker, schneller, kräftiger etc. machen. Durch technische und digitale Prothesen vergrößert der Mensch seine Macht, Reichweite und seinen Einfluss – und macht sich so selbst zum Gott. Dieser technische und – über Freud hinausgehend – digitale Gott steht allerdings auf tönernen Füßen. Wobei man dem Digitalen nicht beikommt, wenn man es einfach pauschal als Götzendienst verdammt.
-> Teil II
Anmerkungen
[2] Vgl. dazu Wolfgang Reinhard, Sakrale Texte. Hermeneutik und Lebenspraxis in den Schriftkulturen, München 2009.
[4] Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, übers. und kommentiert von Klaus Berger, Christine Nord, Frankfurt/M. 2005.
[6] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Nimm und lies! Lektüre, Konversion und Hermeneutik, tà katoptrizómena, H. 99, 2016, https://www.theomag.de/99/wv23.htm. Zum Thema Lesen der sehr interessante Blogbeitrag: „silvae: Wälder: Lesen“ (https://loomings-jay.blogspot.de/2015/05/silvae-walder-lesen_25.html) sowie über das intensive Lesen Rolf Dobelli, Weniger lesen, dafür doppelt, NZZ 27.8.2016, https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/buchkultur-weniger-lesen-dafuer-doppelt-ld.113256: „Wir lesen falsch. Wir lesen zu wenig selektiv und zu wenig gründlich. Wir lassen unserer Aufmerksamkeit freien Lauf, als wäre sie ein zugelaufener Hund, den wir gleichgültig weiterstreunen lassen, anstatt ihn auf prächtige Beute abzurichten. Wir verschleudern unsere wertvollste Ressource an Dinge, die sie nicht verdient haben.“ Zuletzt noch Wolfram Schütte, Über die Zukunft des Lesens, Berlin 24.6.2015, https://www.perlentaucher.de/essay/ueber-die-zukunft-des-lesens.html.
[7] Roland Barthes, Die Lust am Text, Berlin 2017 (französ. 1973), 94.
[8] Vgl. dazu die Arbeiten des Münsteraner Praktischen Theologen Christian Grethlein, exemplarisch Christian Grethlein, Kommunikation des Evangeliums in der digitalisierten Gesellschaft, Dresden 11.11.2014, https://www.ekd.de/synode2014/schwerpunktthema/s14_iv_4_impulsreferat_grethlein.html. Die Frage, ob man aus dieser Behauptung zwischen Kommunikation und Inhalt einen Gegensatz konstruieren muß, kann vorläufig offen bleiben. Sie wird weiter unten (s.u. Nr. 98) nochmals aufgeworfen.
[16] Vgl. dazu Katrin Blawat, Das Ende der Tinte, SZ 10.-11.3.2018, über Formen und Kultur von Handschriften.
[18] Vgl. s.o. Nr. 2 sowie 17-19.
[22] Für Digital Natives: Das ist die Bibliothek, in der Szenen der Harry Potter-Filme gedreht wurden.
[23] Zur Kultur und Erotik des Sammelns (noch vor dem Internet) vgl. Manfred Sommer, Sammeln. Ein philosophischer Versuch, Frankfurt/M. 1999.
[24] Vgl. exemplarisch Franco Moretti, Der Bourgeois. Eine Schlüsselfigur der Moderne, Berlin 2014.
[28] Dazu Wolfgang Vögele, Wehe allen, die sie wegschmeißen. Darf man Bibeln oder Bücher einfach so auf den Müll werfen? Eine Antwort, Die Kirche Nr. 1, 6.1.2008, 11.
[30] Vgl. dazu, auch aus theologischer Sicht Wolfgang Vögele, Gottesebenbildlichkeit, Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit, in: Sibylle van der Walt, Christoph Menke (Hg.), Die Unversehrtheit des Körpers. Geschichte und Theorie eines elementaren Menschenrechts, Frankfurt/M. New York 2007, 136-149.
[31] Barthes, a.a.0., Anm. 7, 8.
[32] Barthes, a.a.O., Anm. 7, 21.
[33] Barthes, a.a.O., Anm. 7, 54f.
[34] Tristan Garcia, Das intensive Leben. Eine moderne Obsession, Berlin 2017.
[35] Ray Kurzweil, Homo s@piens, Düsseldorf 1999.
[36] Neal Stephenson, Amalthea, München 2015 (engl. Seveneves).
[37] Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt/M. 2009 (1930).

