
Singularitäten |
Singularisierung, Säkularisierung oder sichere Schrumpfung?Eine Auseinandersetzung mit Andreas Reckwitz‘ These von der Singularisierung unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage in Religionssoziologie und KirchentheorieWolfgang Vögele Für Michael Vester zum 80. Geburtstag 1. Kirchliche Sehnsucht nach dem Coaching der Religionssoziologen
Kirchen nehmen für solche Konsultationsprozesse besonders gerne die Religionssoziologie in Anspruch. Interessierte Kreise in Kirchenleitungen, Synoden und Theologie haben diese seit der Nachkriegszeit schon immer gerne zum Gespräch eingeladen, um sich mit Hilfe von Daten, Statistiken und sozialen Landkarten auf anstehende Reformprozesse vorzubereiten. In Debatten und Zeitschriften stellen sich Experten der Aufgabe, den gegenwärtigen Ort der Kirche in der Gesellschaft zu bestimmen. Dafür bot sich die Makro- und Mikrodiagnostik der etablierten und prominenten Gegenwartssoziologie stets an, sofern sie die religiöse Situation der Gesellschaft überhaupt noch in den Blick nahm. Innerhalb der Theologie genügte es oft, an den „Zwang zur Häresie“, an den „Glauben als Option“ oder an die „skeptische Generation“ zu erinnern, um sich auf die Grundlage einer soziale Situationsbeschreibung zu einigen. In einem zweiten Schritt entwickelten die Kirchentheoretiker dann orientierende, normative Theorien der Kirche, gelegentlich samt Reformprogrammen. Sie verdichteten sich zu Schlagworten, hinter denen sich innerkirchlich konservative und liberale Gruppen versammelten. Zu diesen Schlagworten zählten die jahrzehntelang dominierende „Volkskirche“, die heute vergessene „Ladenkirche“ , die „Profilgemeinden“, die berüchtigten „Leuchttürme“ bis zur „Minderheit mit Zukunft“, die mir in ihrer Mischung aus ostdeutscher Verklemmtheit und trotzig-performativem Selbstbewußtsein stets ein wenig randständig und verschüchtert vorkam.
Es ist notwendig, über diesen Prozess gegenseitiger Erwartungen zwischen Theologie und Religionssoziologie zu reflektieren, um Missverständnisse auszuräumen, falsche Erwartungen zu desillusionieren und die Reichweite soziologischer Empfehlungen besser zu würdigen und einzuordnen. Dem gelten in diesem Essay nach der Einleitung (1.) einige Bemerkungen über Gesellschaftsdeutungen der Soziologie (2.), danach Notizen zum besonderen Verhältnis von Kirchentheorie und Religionssoziologie (3.). In zwei Beispielen soll diese Neubestimmung dann durchgespielt werden. Seit ihrer Veröffentlichung haben die Thesen des Berliner Soziologen Andreas Reckwitz von der Singularisierung der Gesellschaft (4.) prominente Aufmerksamkeit als aktuelle Gesellschaftsdeutung erhalten. Sie sind deshalb zu Recht populär geworden, weil sie den Übergang von der alten Mittelstandsgesellschaft der Bundesrepublik zu einer Gesellschaft neuen Typs beschreibt, in der sich neue, globalisierte und ‚singularisierte‘ Eliten einer Front aus Populisten, Nationalisten und extremen Rechten gegenüber sehen. Schon deshalb lohnt sich die Frage, ob sich aus Reckwitz‘ Thesen auch etwas über den gegenwärtigen Zustand der Kirchen (5.) entnehmen lässt. Das zweite Beispiel bildet die neue Schrift der EKD-Bildungskammer über Konfessionslosigkeit aus dem Jahr 2019 (6.). Das ist keine religionssoziologische Schrift, wohl aber ein kirchliches Dokument, was in breitem Rahmen Thesen aktueller Religionssoziologie und Theologie fruchtbar machen will, um dann zu orientierenden Empfehlungen zu gelangen. Am Ende dieses Essays stehen eine Reihe von theologischen Schlussfolgerungen (7.). 2. Vom Verlust der Mitte zur beschleunigten Gesellschaft
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien aufgeführt: Die fünfziger Jahre waren bestimmt durch den „Verlust der Mitte“[1] (Hans Sedlmayr): Sedlmayer entwickelte diese These als Kunsthistoriker, der in der Moderne eine Radikalisierung des Menschen und einen Verlust allen Maßes erkannte. Diese verlorene Mitte sollte wieder ins konservative Lot gerückt werden. Die Angehörigen der „skeptischen Generation“[2] (Helmut Schelsky), die im Weltkrieg noch als Flakhelfer gedient hatten, mussten nach der Kriegsgefangenschaft die Traumata des Krieges und des Nationalsozialismus aufarbeiten und sich mit Fragen nach Kollektivschuld und Mitläufertum auseinandersetzen. Dies machte sie nach Schelsky besonders skeptisch gegenüber allen Parolen und Ideologien und führte sie zu einem nüchternen Pragmatismus, dem Visionen und Begeisterung fehlten. Die Achtundsechziger-Generation – ein Schlagwort, das keinem bestimmten Soziologen zugeordnet werden kann – rebellierte gegen Notstandsgesetze und gegen die eigenen Väter, die sich mit Schuld und Vergangenheit nicht auseinandersetzen wollten. Die Studenten kritisierten den „eindimensionalen Menschen“[3] (Herbert Marcuse), der sich, verstrickt in Fließbandarbeit und technische Innovationen und gelähmt durch Konsum, Massenmedien und Entertainment, nicht mehr zur revolutionären Veränderung der versteinerten Verhältnisse aufraffen kann.
Alle diese soziologischen Schlagworte, so sehr sie gegenwartsbezogen sind, haben ihren historischen Ort; sie sind zeitgebunden und lösen sich darum in schneller Folge ab. Sie kommen zusammen im Versuch einer prägnanten, zusammenfassenden Gegenwartsdiagnose, die jeweils einzelne Aspekte heraushebt. Ähnliches verbindet sich im Übrigen mit dem Begriff der Moderne. Wer Stichworte zur (geistigen) Situation der Zeit[10] auflisten wollte, der tat und tut das häufig, indem er versucht, Merkmale und Charakter der Moderne zu beschreiben. Und wenn ein Soziologe dann von Post-Moderne[11] spricht, so enthält das Stichwort eine gewisse Ironie in dem Versuch, Moderne als historische Epoche und als Gegenwart zu unterscheiden. Und es ist auch erwähnen, dass Gegenwartsdiagnosen häufig in politische, soziale, ökonomische und kulturelle Zukunftsprogramme umgemünzt werden, was eine prekäre Nähe zur stets ein wenig belächelten Zukunftsforschung[12] mit sich bringt.
Über diesen Diskurs zu Gegenwartsdiagnosen und Zukunftsprogrammen wäre noch eine ganze Menge zu sagen. Hier soll es sein Bewenden haben mit wenigen skizzenhaften Bemerkungen, die aber deutlich gemacht haben, dass manche Schlagworte und Diagnosen eben doch eine Halbwertszeit besitzen, was Plausibilität, kulturelle Prägnanz und orientierende Deutungskraft angeht. Die aufgerufenen Stichworte heben stets nur Teilaspekte heraus. Sie fassen das gesamte soziale Panorama, den Hintergrund der Gesellschaft zusammen. Die Prägnanz geht allerdings auf Kosten des differenzierten Gesamtbildes. 3. Zwang zur Häresie und MilieusensibilitätRichtet man den Blick von den allgemeinen Gesellschafts- und Modernitätsdiagnosen ein paar Schritte näher auf Diagnosen zum Ort der Kirchen in der Gesellschaft, dann ergibt sich ein ähnliches Bild. Zum aktuellen, zeitgeschichtlich bedingten Moment der Gegenwartsdiagnosen treten Fragen nach Methode und Ergebnissen. In Gesprächen, Umfragen, Tiefeninterviews werden soziologische Daten erhoben, aber kein Datensatz entkommt der Notwendigkeit einer subjektiven, bewertenden Deutung. Der Gegensatz zwischen erhobenen Daten und ihrer Interpretation spielt in den Untersuchungen des verstorbenen österreichisch-amerikanischen Religionssoziologen Peter L. Berger noch keine große Rolle. Ihm kommt eher das Verdienst zu, im deutschsprachigen Raum schon in den sechziger und siebziger Jahren die Frage nach den Wandlungsprozessen der Kirchen in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft hervorgehoben zu haben. Plötzlich erscheinen die beiden großen Konfessionen nicht mehr als die beiden einzigen institutionellen, staatlich in Gestalt einer Körperschaft des öffentlichen Rechts akzeptierten Vertretungen von Religion. Unter einer Verfassung, die Religionsfreiheit garantiert, steht den Bürgern eine Vielzahl religiöser Optionen offen, eingeschlossen die Option, gar keiner Religion anzugehören. Die Kirchen finden sich plötzlich als Konkurrenten in einem religiösen Markt wieder[14]. Sie müssen um Anhänger werben und sich der dauernden Mitgliedschaft ihrer Glaubenden versichern. Es ist nicht mehr völlige Selbstverständlichkeit, einer der beiden Konfessionen anzugehören. Unter den Bedingungen rechtsstaatlicher und demokratischer Modernität ist die alte Allianz zwischen Kirchen und Staat zerbrochen. Alte gesicherte und traditionell etablierte Zugehörigkeiten verwandeln sich in „Optionen“, revidierbaren privaten Entscheidungen für das eine oder andere Modell religiösen Lebens.
Aber unabhängig von der Zuordnung einzelner Theologen zu diesen idealtypischen Modellen scheint doch wichtig, dass sich ihre Bewertung gerade aus der Stellung von Kirche und Theologie zur modernen Gesellschaft ergibt. Entweder man bejaht sie kirchlich und akzeptiert diese Bedingungen, oder man bekämpft sie und zieht sich in einen frommen Elfenbeinturm zurück. Genau dieses Kriterium der Stellung zu modernen gesellschaftlichen Entwicklungen wird sich in verwandelter Form bei Reckwitz wiederfinden. Die EKD selbst hat sich der Religionssoziologie in regelmäßigen Mitgliedschaftsuntersuchungen bedient, die zuletzt ein immer weiter differenziertes Bild kirchlicher Einprägung in die gesellschaftliche Wirklichkeit gezeitigt haben.[16] Das differenzierte Bild, was diese Untersuchungen ergaben, erschwerte es den Interpreten, sie für bestimmte Reformstrategien in Dienst zu nehmen. Man konnte diesen Untersuchungen nicht ohne Berechtigung zum Vorwurf machen, dass über allen genau ermittelten Details das große Gesamtbild verlorenging. Und es kam wie in einem großen blinden Fleck diejenige klerikale Bürokratie nicht in den Blick, deren Reformunfähigkeit die Trägheit und Schwerfälligkeit institutionellen kirchlichen Handelns wesentlich mit verursacht[17]. Die Vielzahl von Landeskirchen bedeutete stets auch ein Übermaß paralleler bürokratischer Strukturen, die mit kirchenhistorischen Entwicklungen begründet wurden, welche ins 16. Jahrhundert zurückreichen und längst obsolet geworden sind. Was im politischen Bereich unter dem Stichwort des Föderalismus zu einem zugegeben mühsamen, aber doch balancierten Interessenausgleich führte, verblieb im kirchlichen Bereich als eine Variante der Kleinstaaterei, befeuert von regionalen Identitätsbeteuerungen, die eher in christliche Folklore als in Dogmatik und Bekenntnisrelevanz hineinreichen. Alle Modifizierungsversuche gingen unter in einer Mischung aus Protesten und Intrigen gegen die Versuche der EKD, sich als eine Art evangelischer Vatikan mit klerikaler Weisungsbefugnis – minus Pomp, minus Glaubenskongregation und minus Diplomatenstatus – zu inszenieren. Im Pochen auf regionale Besonderheiten gingen die meisten Versuche pragmatischer und sinnvoller Kooperation und Restrukturierung unter.
Ungefähr seit dem Jahr 2000 wurden in der evangelischen Kirche Milieuuntersuchungen[19] populär, die sich von verschiedenen Intuitionen anleiten ließen. Zum einen misstraute man dem herrschenden Individualisierungsparadigma, das es ausschloss, Gruppen von Individuen in Schichten, Klassen, soziale Cluster zusammenzufassen. Zum anderen mutmaßte man, kirchliche Verkündigung richte sich unbewusst nur noch an ein bestimmtes (Kern-)Gemeindepublikum. Die Favorisierung einer vom Mittelstand bestimmten Kerngemeinde verdränge andere Milieus der Gesellschaft, die man nicht mehr erreiche. Man sprach von Milieuverengungen, die es aufzulösen gelte. Diese Untersuchungen lebten von der breiten Rezeption der sozialen Erkenntnistheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, insbesondere der Begriffe des Habitus und des Milieus. Während allerdings die an solchen Untersuchungen beteiligten Soziologen wie Michael Vester und Helmut Bremer stets betonten, dass man die Ergebnisse solcher Milieulandkarten nicht in unmittelbare sozialtechnologische Rezepte praktisch-theologischen Handelns umprägen könne, geschah genau solches in Nachfolgeuntersuchungen immer wieder.[20] Man ging davon aus, dass völlig substantiell und eindeutig bestimmt werden könne, was Verkündigung und Evangelium sei. Diese Verkündigung müsse nun – so die Autoren – nur noch mit den jeweiligen Akzidentien der Milieunähe versehen werden, um die Attraktivität des Evangeliums neu in Gang zu bringen. Pfarrern, Diakonen und Religionslehrern sei selbstverständlich zuzutrauen, wie fromme Schauspieler von einem Milieu ins andere zu springen und sich das Kleid des jeweiligen Habitus anzuziehen – je nach Missionsbedarf. Um es vorsichtig zu formulieren, kam solche sozialtechnologische Umformung der Theorie Bourdieus einem Verrat an dessen Grundideen gleich. Denn seine Milieutheorie fußt ja nicht auf der These, dass alle Milieus ansprechbar und erreichbar seien, sondern darauf, dass alle Subjekte und Objekte der Wirklichkeit in irgendeiner Weise milieuhaft geprägt sind. Alles menschliche Handeln, Denken und Wahrnehmen ist durch einen bestimmten Habitus und also sozial geprägt.[21] Nicht zufällig endete Bourdieus lebenslange Auseinandersetzung mit der Reichweite und Wirksamkeit sozialer Theorie mit einer Beschreibung des „Elends der Welt“[22], die sich der soziologischen Reformvorschläge völlig enthielt. Bei seinen Schülern mündete seine Theorie zumindest in Frankreich, aber nun auch in Deutschland breit rezipiert, in literarische Arbeiten, insbesondere bei Annie Ernaux, die in ihrem Roman „Die Jahre“[23] Subjektivität, soziale Bindungen und Milieuzugehörigkeit in einer lakonisch beschreibenden Sprache ausdruckte, die auf das Personalpronomen „ich“ völlig verzichten konnte.
Der Soziologe Hans Joas griff in seinen kirchentheoretischen Arbeiten nicht auf Interviews und Statistik zurück, sondern setzte sich mit dem Säkularisierungstheorem auseinander, dessen Status als geschichtsphilosophische Prophetie er dekonstruierte. In Arbeiten wie „Glaube als Option“ oder „Braucht der Mensch Religion?“[25] verteidigte er die Präsenz des Religiösen in modernen Gesellschaften. Er operierte dabei mit einem Begriff religiöser Erfahrung, der sich mehr noch als auf Schleiermacher auf den Religionsphilosophen William James und die amerikanischen Pragmatisten bezog. Anders als in manchen zum Autoritären neigenden Strömungen deutscher Schleiermacher-Rezeption, die viel zu schnell religiöse Erfahrung auf einen besonderen Typus lutherischer Neo-Orthodoxie festlegten und nichts anderes zuließen, arbeitet Joas mit einem demokratischen, offenen Erfahrungsbegriff, in dem Kirchen und Konfessionen zu Interpretationsgemeinschaften werden, die sich durch gemeinsame Deutungen und gemeinsame Geschichten konstituieren. Kirchen sind für Joas mehr als ein liberaler, offener Diskussionsraum, aber genauso auch weniger als fundamentalistische Burgen zur Selbstvergewisserung eines traditionshaft bestimmten Glaubens.
Es wurde – planmäßig oder nicht? – der Eindruck herbeigeführt, als solle nun die Demographie die harten Fakten bereitstellen, um den Boden für eine neue – theologische? – Reformdiskussion zu bereiten. Innerkirchlich werden (Religions-)Soziologie, Demographie, Demoskopie, Milieuforschung zu Hilfswissenschaften degradiert, die indirekt Argumente für das beabsichtigte Reformprogramm bereitstellen sollen. Aus dem erwähnten Zirkel zwischen sozialwissenschaftlicher Analyse und praktisch-theologischen Reformprogrammen scheint keiner der wichtigen Akteure ausbrechen zu können. Und das Fazit ist nicht von der Hand zu weisen: Keines der kirchlichen Reformprogramme aus den letzten Jahrzehnten konnte die von der Demoskopie beschriebenen Negativtrends aufbrechen. Dabei machte es keinen Unterschied, ob das Reformprogramm auf liberaleren oder konservativeren Grundannahmen aufbaute oder ob es sich der einen oder anderen sozialwissenschaftlichen Methode verschrieb. Im Grunde sind das deprimierende Ergebnisse. Die Negativtrends halten an, und die Steuerungsmöglichkeiten erscheinen minimal. Man kann diese Ergebnisse nun mit Hilfe der wolkigen Schönwettersprache klerikalen Marketings schönreden. Man kann einfach so weiter machen wie bisher, von der offiziösen Politikberatung der EKD im Medium öffentlicher Theologie über die anhaltenden Querelen zwischen liberalen Dialogbefürwortern und evangelikal-fundamentalistischen Substanzverteidigern bis zu den kleinen Maßnahmen auf parochialer Ebene, in Corona-Zeiten wackeligen Youtube-Videos mit den Ansprachen schlecht ausgeleuchteter Pfarrer mit ungebügeltem Beffchen. Es dürfte auch klar sein, dass die klügeren Jungfrauen unter den klerikalen Bürokraten schon Gründe sammeln, um in den nach dem virusbedingten Rückgang der Einkommens- und dann Kirchensteuer anstehenden Kürzungsdiskussionen um Finanzmittel die Stellen der eigenen Abteilung zu erhalten. Aber irgendwann mittelfristig – spätestens! – müsste doch die Frage gestellt werden, ob die Kollusion zwischen bereits interpretierenden soziologischen Studien und unzureichenden kirchlichen Reformprogrammen nicht doch aufgebrochen werden kann. Und eine Teilfrage dieser Grundsatzfrage bestünde darin, ob das, was der Soziologe Andreas Reckwitz als Prozess der Singularisierung der Gesellschaft beschrieben hat, als Grundlage von neuen kirchlichen Reformüberlegungen taugt. 4. Singularisierung
Dabei verblüfft der Terminus „Singularität“ auf den ersten Blick. Reckwitz vermeidet bewusst den Begriff der Individualität, der sich nur auf Menschen anwenden lässt und zudem ideologisch und kulturphilosophisch belastet sei. ‚Singulär‘ dagegen können nicht nur Menschen sein, sondern auch Sachen (Bilder, Möbelstücke) oder Ereignisse (Reisen, Sportveranstaltungen, Konzerte). Die Menschen treten der Welt so gegenüber, dass sie ihr Leben ‚kuratieren‘, von der Kleidung über die Wohnung bis zu Freunden. „Das spätmoderne Subjekt performed sein (dem Anspruch nach) besonderes Selbst vor den Anderen, die zum Publikum werden.“ (9) Die Subjekte wählen aus, was zu ihrem Leben passt, und schaffen damit ihre eigene ‚singularisierte‘ Lebenswelt. Damit wird ein Gegensatz geschaffen zur Massenproduktion der Industriegesellschaft. Diese strebte nach Rationalisierung der Lebenswelt und auf Gleichförmigkeit. Die politische und soziale Aufgabe bestand darin, formal alle Menschen gleich zu behandeln. Ist dies mehr oder weniger gewährleistet, so ergibt sich aus der erreichten formalen Gleichheit und Allgemeinheit zwingend ein neuer Differenzierungs- und Abgrenzungsprozess: In der Sphäre der Kultur, die in der nachmodernen Gesellschaft immer wichtiger wird, haben die Menschen die Möglichkeit zu wählen, zu entscheiden, sich nach ihren eigenen Wünschen einzurichten.
Zuschauer dagegen werden degradiert, sie spielen eine passive, rein rezeptive Rolle. Der Begriff der Darstellung (im wissenschaftlichen Jargon: Performativität oder Performanz) kommt ebenso aus dem Bereich der Kunst wie der Begriff des Kuratierens. Wie der Museumsdirektor seine Ausstellung kuratiert, so kuratiert nun der Durchschnittsbürger sein Leben: Er richtet seine Wohnung ein. Er schafft sich ein Arbeitszimmer oder einen Heimwerkerkeller. Er kauft sich ein Elektro-Auto, wenn er sich vor dem Klimawandel fürchtet, oder einen der im Moment gerade so verschrienen SUVs, wenn er sich vor Massenverkehr und den Aggressionen anderer Autofahrer schützen will. Die soziale Aufgabe besteht nicht mehr in der Anpassung an eine vorgegebene soziale Tradition oder im bloßen Funktionieren als Rad im gesellschaftlichen Getriebe. Das Ziel besteht nun darin, das eigene Leben zu gestalten, auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Früher war das dem romantischen Genie vorbehalten, dass sich durch eigene Kreativität von der Masse der Spießbürger absetzte. Heute ist die Gestaltung eines singularisierten Lebens zur allgemeinen gesellschaftlichen Erwartung geworden. Wer sich nicht selbst darstellt, fällt nicht mehr auf, er wird vergessen. Es entsteht ein sozialer und kultureller „Attraktivitätsmarkt“ (9), auf dem Menschen als soziale Wesen um Aufmerksamkeit konkurrieren. Aufmerksamkeit ist nichts anderes als die Zeit und die gedankliche Kraft, die Menschen auf eine Person, einen Gegenstand (Kunstwerk, Wohnung) oder ein Ereignis (Konzert, Fußballspiel) aufwenden.[28] Singularisierte Menschen pflegen einen Kult des Authentischen (11), der allerdings dem Essay Thomas Bauers[29] zufolge, ein ganz ambivalenter Begriff ist, der Individuelles und Zur-Schau-Gestelltes miteinander vermischt. Das lässt sich gerade an den angeblich so stark singularisierten Künstlern zeigen: Sie bringen oft nur quasi-authentische Kunstwerke hervor, die dann doch nicht aus dem höchst besonderen eigenen Inneren kommen und sich stattdessen schamlos bei den großen, erfolgreichen Vorbildern bedienen. Jeder Gang über eine Kunstmesse wie die ART Basel oder die ART Karlsruhe gibt über Imitation und Konvention in der Kunst der Gegenwart Auskunft. Ob das Authentische glaubwürdig ist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle, was für Reckwitz zählt, ist die Bevorzugung des Individuellen vor dem Allgemeinen, des Außergewöhnlichen vor dem Normalen (14). Dabei verbindet sich dieses Besondere mit Geschichten darüber, wie es dazu gekommen ist. Singularitäten sind erklärungsbedürftig und werden darum narrativ in Erzählungen eingebunden.
Drei Entwicklungen haben zu dieser sozialen Singularisierung beigetragen: zum einen der Aufstieg des ‚Kulturkapitalismus‘, der Werte statt Waren schafft, zweitens die Digitalisierung und drittens die „postromantische Authentizitätsrevolution“ (19). Die Wahlmöglichkeiten, die mit der neuen singularisierten Gesellschaft gegeben sind, bieten dem einzelnen auf der einen Seite die große Chance, nach seinen Vorlieben und Prägungen zu wählen und zu kuratieren, sich in seinem Leben nach seinen Wünschen aus- und einzurichten, auf der anderen Seite erschrecken ihn diese Wahlmöglichkeiten und überfordern ihn (21). In der Ausarbeitung dieser soziologischen These verbirgt sich die politische Erklärung für die Spaltung europäischer Gesellschaften in liberale, demokratische Eliten und rechtspopulistische und demagogische Gegenbewegungen. Die Erfahrung der modernen Gesellschaft bleibt ambivalent; konsequent spricht Reckwitz von „multiple modernities“ (21, Anm. 14). Reckwitz unterscheidet in Gesellschaften eine „soziale Logik des Allgemeinen“ und eine „soziale Logik des Besonderen“. Die erste zielt auf einen Prozess der Rationalisierung, die zweite auf einen „Prozess der „Kulturalisierung“ (27). Dem liegt ein bestimmter Begriff der sozialen Welt zugrunde. Sie besteht aus „sozialen Praktiken, an denen Subjekte und Objekte partizipieren, aus denen sich Kollektive bilden und die Zeit und Raum auf eine bestimmte Weise strukturieren“ (36).
Genau dieser erzwungene emotionale Nichtangriffspakt der Subjekte verändert sich radikal in der Moderne der Singularitäten. Das Abweichende wird nicht mehr unterdrückt, es wird ausdrücklich gefördert und kultiviert. Nicht mehr das Gleichförmige, sondern das Singuläre wird zum Ideal erhoben. Aber das Diverse und Pluriforme hebt das, was auf Gleichheit und gleicher Herrschaft beruht, auf oder dementiert es. Auch in der Nach-Moderne ist Gleichheit gewährleistet: Auf dieser Basis erst können Ungleichheiten kultiviert werden. Was nun ist Singularisierung? Singularisiert sind Dinge, Personen, Events, die einzigartig sind und nicht durch andere Dinge, Personen und Events ersetzt werden können. Singularitäten werden verstanden als „Eigenkomplexitäten mit innerer Dichte“ (52). Differenztheoretiker meinen, alles sei verschieden, es gäbe nichts Gemeinsames, das Diverse werde totalisiert. Reckwitz arbeitet im komplizierten philosophischen ersten Kapitel seines Buches im Gegensatz dazu genau heraus, was sozial verallgemeinerbar und was singularisierbar ist. Singularitäten begründen absolute „qualitative Andersheit“ (54). Dinge, Personen und Events werden inkommensurabel, nicht mehr vergleichbar – wie Äpfel und Birnen. Einzelne betrachten Dinge oder Personen in ihrer Perspektive, also subjektiv, als singulär. Dann handelt es sich allerdings zunächst ‚nur‘ um Idiosynkrasien, die eine Vorstufe zur Singularität bilden. Zu dieser wird die Idiosynkrasie erst, wenn sie sozial anerkannt wird. Die Logik des Individualismus greift gegenüber der Singularitätstheorie zu kurz, denn sie bezieht sich in Aufnahme der romantischen Bewegung des 19.Jahrhunderts nur auf Individuen, wogegen der Singularitätsstatus neben Personen eben auch Dinge und Ereignisse bezeichnen kann. Das exemplarische singularisierte Objekt ist das Kunstwerk. Exemplarisch singularisierte Personen sind das Genie (Romantik) oder der Charismatiker (Max Weber), der Künstler oder der Prophet, letzterer ein erster Hinweis auf Religion. Exemplarisch singularisierte Zeit findet sich im Event, beim jährlichen Fest oder im wiederkehrenden Ritual.
Die Gesamtheit der Singularitäten bildet eine Kultur (75), verstanden als die Summe der „Wissensordnungen und Klassifikationssysteme, vor deren Hintergrund soziale Praktiken erst denkbar werden“ (76). Deshalb ist es wichtig, sie nachhaltig aufrechtzuerhalten. „Kultur ist dort, wo gesellschaftlich Wert zugeschrieben wird.“ (79) Werte entstehen durch Wertzuschreibungen, Prozesse der Valorisierung und Entvalorisierung. Kultur zeichnet bestimmte Personen, Dinge, Ereignisse aus – und entwertet andere (81). In dieser Gesellschaft gehören zu den entwerteten Typen beispielsweise Amokläufer, Selbstmordattentäter, Serienmörder, Querulanten, Troublemaker, Außenseiter. Reckwitz nimmt die Unterscheidung zwischen Allgemeinheit und Besonderheit auf und vergleicht Prozesse der Kulturalisierung und Rationalisierung. Während Rationalisierung vereinfacht und Komplexität in auf Gleichheit beruhenden Gesellschaften nur stört, fördert die Kulturalisierung Komplexität. Kulturalisierung versteht Reckwitz als Singularisierungsmotor und charakterisiert sie durch „Eigenkomplexität und innere Dichte“. Beides mache „den Reiz der Sache aus; sie sind das, worum es geht.“ (85)
Kultur lädt Personen, Dinge, Ereignisse ästhetisch, narrativ-hermeneutisch, ethisch, gestalterisch oder ludisch auf (87). „In ihrer narrativ-hermeneutischen Qualität bieten die Einheiten der Kultur Erzählungen der Welt, der Natur und des Sozialen, über Vergangenheit und Zukunft, Menschen, Dinge und Götter; hier geht um ein Verstehen der Zusammenhänge der Welt und des Ortes des Subjektes in diesem Weltzusammenhang.“ (88) Diese Zusammenhänge werden in Geschichten ausgebreitet: Das Geschichtenerzählen schafft und begründet erst Singularisierungsprozesse (121). Bei diesem Zusammenhang von Kultur und Erzählung zeigt sich ein expliziter Übergang zur Religion. „Informationen beanspruchen Nutzen und Funktion, Narrationen und ästhetische Wahrnehmungen beanspruchen Wert. Informationen sind emotionsarm und sachlich, Narrationen und ästhetische Wahrnehmungen mobilisieren die Affekte.“ (89) Traditionale Gesellschaften sind durch einen sakralen Kern fixiert, der durch Wiederholungen und Rituale, die Berufung auf das stets Wiederkehrende erhalten wird. Dagegen opponiert zum ersten Mal die bürgerliche Gesellschaft, die Leistung und Individualität an die Stelle von Stand und Gruppenzugehörigkeit setzt. Aus dem Bürgertum heraus entwickelt sich der Kult des romantischen Genies, das der eigenen Intuition und Kreativität, nicht mehr den Vorgaben traditioneller Regeln folgt. Die Romantik des 19.Jahrhunderts entwickelt einen „kulturrevolutionären Singularismus“ (97), der sich in der Spätmoderne vom gelegentlichen Einzel- zum ubiquitären Massenphänomen umgestaltet. Nun praktizieren Massen, was vorher nur Einzelne gewagt haben. Die Romantiker haben die Welt wieder verzaubert, sie entdecken sie neu als einen „Raum faszinierender Eigenkomplexitäten“; darin bewegen sich die Subjekte und machen authentische Erfahrungen (99). Das Streben nach Singularität ist eine Gegenbewegung zur Massenkultur, der kapitalistischen wie der sozialistischen. Reckwitz sieht drei Ursachen für den Aufstieg der Singularisierung: 1. das Streben nach Authentizität in der neuen bildungsbeflissenen akademisierten Mittelklasse, 2. die Umwandlung der Serien- und Massenökonomie in eine ‚creative economy‘; 3. das Aufkommen der Digitalisierung (103).
Kultur verwandelt sich in Hyperkultur. Normale Kultur folgt einem Kanon. In der Hyperkultur findet eine Erweiterung der kulturalisierbaren Güter statt. Schlechthin alles kann valorisiert und damit kulturalisiert werden. Die Kultur der singularisierten Gesellschaft befindet sich im Zustand der „Dauerrezension“ (168). Alles wird bewertet, beurteilt, eingeteilt. Sicher sein können sich die Rezensenten nur bei Klassikern (Mozart, die Beatles), eingeführten Marken (Nivea, Chanel, Mercedes) und bestimmten Stars (169). Singularisierung betrifft auch die Industrie. Die Fabriken der Moderne zielten auf Massenproduktion, sie wurden in der Spätmoderne durch die wachsende Dienstleistungsgesellschaft abgelöst. Diese wiederum tritt in der folgenden Singularisierungsphase gegenüber den creative industries zurück. Letztere umfaßt Kunst, Musik, Film, Werbung, Software, Architektur, Computerspiele (115). An die Stelle der Trias Produzent, Produkt, Konsument tritt die Trias Autor, Werk, Rezipient (117). Güter verwandeln sich in kulturelle Güter und damit in „Affektgüter“ (121). Das beste Beispiel sind die Produkte der Firma mit dem Apfel. Singularitätstheorie affiziert nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Arbeitswelt. Man unterscheidet „lovely jobs“ der Hochqualifizierten, die eine kreative und befriedigende Arbeit ermöglichen, und „lousy jobs“, die langweilig sind und nur dem Geldverdienen dienen (183). Lovely jobs sind anerkannt, normale Arbeit wird nur geduldet. „Kreativ zu sein, sich in der Arbeit schöpferisch entfalten zu können, ist ein Ideal der postindustriellen Arbeitskultur, die vom postmaterialistischen Wertewandel beeinflusst ist.“ (187) Die Aufgabe besteht darin, ein originelles und einzigartiges Produkt zu schaffen und dieses dann performativ in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn, was das Publikum nicht wahrnimmt, wird vergessen.
Arbeitskultur ist durch das so genannte Künstlerdilemma geprägt: Der Künstler will ad personam sein eigenes Genie verwirklichen, auf der anderen Seite kann er coram publico nur dann Geld verdienen, wenn er die Erwartungen des Publikums befriedigt (217). Auf ein Wirtschaftsunternehmen übertragen heißt das: Arbeit soll affektiv befriedigen, aber nur Arbeit, die gebraucht wird, wird auch bezahlt. Der Wettbewerb funktioniert nach dem erwähnten Prinzip: The winner takes it all. Stars verdienen überdurchschnittlich. Die Unauffälligen, die ebenfalls gute Leistung bringen, bleiben unterbezahlt.
Digitalisierung dient also zum einen der Rationalisierung der Kommunikation, durch Emails, durch einfacheres Verfassen von Texten, aber sie trägt auch zur Singularisierung bei: Sie schafft Zerstreuung, Ablenkung und Entertainment. Sie ermöglicht es den Usern, sich durch Blogs, Youtube-Kanäle, Instagram und Facebook zu singularisieren. Und so verändert sich der Subjektbegriff (244). Denn die Subjekte sind nun quasi gezwungen, sich an Medien der Performanz im Internet zu beteiligen. Das Subjekt muss an seiner digitalen wie nicht-digitalen Selbstdarstellung arbeiten und möglichst im Rahmen seiner „performativen Authentizität“ (247) bleiben, wenn es Aufmerksamkeit erlangen will. Es strebt nach Originalität, Andersheit und Überraschung. Es will sich selbst zuschreiben, was anderen fehlt. Es geht um eine nachhaltige „Performanz des Neuen“ (250). „Ich bin nicht nur meine Links, ich bin auch meine Likes, das heißt, ich setze mich zusammen aus den Dingen, die mir ‚gefallen‘.“ (251) Das ist die Methode von Facebook: Links setzen und Likes vergeben. Die Nutzer geben sich performativ ein ‚Profil‘. Diese ‚Profile‘ beobachten sich gegenseitig, sie können aber auch mittels der Methoden von big data beobachtet werden, damit andere Institutionen oder Personen Wahlerfolge oder Umsatzsteigerungen zu erzielen. Sein Profil kuratiert der User mit Hilfe von cut and paste. Er schafft nichts Neues, er ist kein Künstler oder Wissenschaftler. Er bedient sich einfach bei anderen Websites. Aus der Bündelung von Profilen entstehen digitale Neogemeinschaften (261), die wiederum singularisierte Kollektive eigener Art sind. Digitale Neogemeinschaften konstituieren sich aus „textuell-visueller Kommunikation unter Abwesenden“ (265). Aus den singularisierten Menschen bilden sich Neogemeinschaften, nicht mehr Vereine, die durch ein gleichartiges Interesse (Skatspielen, Briefmarkensammeln, Chorsingen) bestimmt sind, sondern Gemeinschaften singularisierter Menschen (Netzwerke, Projekte, Clubs, Facebook-Gruppen).
Die Kosten dafür tragen diejenigen Institutionen, die zuvor für Vergemeinschaftung standen: Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, die alle gleichermaßen schrumpfen, weil sich niemand mehr Bevormundung und Gängelung durch Großorganisationen gefallen lassen will. Hier ist allerdings ein Fragezeichen zu setzen, denn es vermag nicht zu überzeugen, dass bei Reckwitz Religion hauptsächlich in Gestalt von Sekten und fundamentalistischen Gruppen vorkommt, die sich mit aller Kraft gegen Singularisierung und Globalisierung wehren. Der Soziologe kann sich die Kirchen nicht mehr als Institutionen vorstellen, die den Ausgleich zwischen Glaube und Moderne suchen. Aber diese Kritik wird bei weitem aufgewogen durch die nach meiner Meinung überzeugende Interpretationskraft der Singularisierungsthese. Singularisierte Menschen der Spätmoderne organisieren sich nicht mehr in ‚besitzergreifenden‘ Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, sondern in dem, was Reckwitz ‚Neogemeinschaften‘ nennt. Daraus folgt, dass sich Kirchen als Institutionen verändern müssen, wenn sie für singularisierte Menschen attraktiv sein wollen. Darauf ist zurückzukommen. Wie lässt sich nun diese neue Mittelklasse charakterisieren? Für Reckwitz sucht sie eine „‘Ethisierung‘ des Lebens“ (292). Sie will ihren Alltag (Essen, Gesundheit, Erziehung, Fitness) nach eigenen Maßstäben gestalten. Arbeit zielt nicht nur auf Geldverdienen, sondern auch auf Selbstverwirklichung (294). Alltag ist nicht mehr durch Traditionen vorgegeben, sondern er wird zur Gestaltungsaufgabe, mit einem bestimmten Ziel, Lebensqualität zu schaffen, die als „wertvoll, authentisch und befriedigend“ (294) erlebt wird. Das Subjekt führt sein Leben vor der Familie, sich selbst und einer wie immer gestalteten Öffentlichkeit auf. Es versucht, im eigenen Leben Regie zu führen. Dabei ist die Praxis des Gestaltens des eigenen Lebensstils bestimmt durch das mehrfach erwähnte Prinzip des Kuratierens. „Der Kurator erfindet nicht von Grund auf Neues, er stellt klug zusammen. Er wählt aus, eignet sich Kunstwerke und Traditionen an, er macht Dinge erst zu Ausstellungsstücken, bindet scheinbar Disparates (…) zusammen.“ (295) Wenn der Begriff der Lebenskunst je einen Sinn gemacht hat[31], dann in diesem Zusammenhang, auch wenn ihn Reckwitz selbst nicht gebraucht.
Das allgegenwärtige Kuratieren hat sich befreit von den alten normativen Engführungen bildungsbürgerlicher Kanons (Oper, Museum, Konzert, Abendkleid, Frack und Fliege). Inhalte und Medien weiten sich global und sozial, Grenzen zwischen Hoch- und Subkulturen fallen. Es entsteht ein „Kulturkosmopolitismus (…), der vom Wert der Vielfalt des Lokalen lebt“ (302). Es ist interessant zu sehen, dass sich sämtliche akademisch gebildeten Milieus der Länder der Erde in dieser Richtung bewegen. Die alten, akademischen Bildungsmilieus des Mittelstandes sind am besten auf diese neuen sozialen Entwicklungen vorbereitet. Sie bringen Netzwerke, Bildung und ein „psychophysisches Subjektkapital“ (306) mit, das ihnen hilft, sich zu singularisieren und am Milieu des neuen Mittelstandes teilzuhaben. Ist solch ein Prozess erfolgreich, drängt er förmlich nach Selbst-Darstellung: „Ist die Selbstverwirklichung sozial erfolgreich, wird sie nach außen in Form eines attraktiven Lebens sichtbar.“ (307) Wer seinen Lebensstil kuratiert und kreativ gestaltet, beschäftigt sich mit Essen, Wohnen, Reisen, Körpererleben, Kinder und Schule (308). Beim Essen geht es um regionale Küchen, Experimente (Molekularküche), Ethik (vegane oder vegetarische Ernährung). Wohnen ist eine Frage der eigenen Gestaltung (Innenarchitektur) und der Inszenierung. Beim Reisen stehen attraktive Ziele und das Vermeiden des Eindrucks, ein Tourist zu sein, im Vordergrund. Die Gebildeten unter den Touristen verwandeln sich in urbane Flaneure, traveller und Globetrotter (321). „Im Durchstreifen der Welt in ihrer kulturellen und natürlichen Fülle und Vielfalt reichert das Subjekt sich selbst mit Erlebnissen und Erfahrungen an. (…) Globalität in allen ihren Facetten wird zu einer Ressource für die Entwicklung des Ichs.“ (324) Entscheidend ist nicht die Fremdheit und Andersheit der Welt, sondern deren Anschlussfähigkeit.
„Das spätmoderne Subjekt zieht enorme Befriedigung daraus, nicht ein für allemal festgelegt zu sein, sondern in grenzenlosem Aktivismus immer wieder neu noch ganz andere Aktivitäten und Möglichkeiten für sich entdecken zu können (…). Das Ziel lautet dann, möglichst alle Potentiale, die in einem schlummern, zu mobilisieren und ihnen zur Entfaltung zu verhelfen. Der Maßstab dieses Lebensstils ist die größtmögliche Fülle des Lebens. Die Kehrseite der Selbstentgrenzung ist die Selbstüberforderung.“ (343) Hier wird deutlich, dass die Singularitätsaktivitäten auch mit Kosten verbunden sind. Nicht umsonst verweist Reckwitz auf die Arbeiten des französischen Soziologen Alain Ehrenberg[32], der Burnout und Depression als typische Zeitkrankheiten der Spätmoderne diagnostiziert. Für Reckwitz gilt: Das spätmoderne Ich leidet an einem „starken Gefühl subjektiven Ungenügens angesichts nicht bewältigter Enttäuschungserfahrungen“ (349). Es fällt auch auf, dass Reckwitz Altern und Sterben aus dem Singularisierungsdiskurs heraushält. Beim Thema Altern ist man längst zu Best-Agern und ‚jungen‘ Alten als kaufkräftigen Konsumenten gelangt. Sie sind also ‚singularistisch‘ längst entdeckt. Beim Thema Sterben und Tod bleibt Reckwitz stumm. Und das könnte sich als Fehler der gesamten Theorie erweisen: Die mittelständische Singularisierungskultur ist auf Happiness, Erfolg, performative Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit gepolt, während sie Trauer, Depression und Lethargie, Langeweile ausblendet. Hier wäre zumindest die Frage zu stellen, ob religiöse Lebensentwürfe nicht eher eine Gesamtperspektive auf das Leben entwickelt, die Krankheit, Leiden, Gewalt, Sterben und Tod, wenn nicht integriert, so doch zu bearbeiten versucht. Spannend sind darum die Kapitel zu Kosten und Ambivalenzen des Strebens nach Selbstverwirklichung. Reckwitz spricht davon, die Schattenseite des Singularitätsstrebens sei eine „Verzichtsaversion“ (344), nämlich der Zwang, aus Zeit-, Talent- und Finanzgründen bestimmte Möglichkeiten nicht verwirklichen zu können. Das spätmoderne Subjekt ist enttäuscht, nur eine bestimmte Spanne an Lebenszeit und Lebensenergie zur Verfügung zu haben. Er ist von seiner Konzeption der Lebenskunst her dazu verurteilt, Schwäche, Lethargie, Langeweile, Alter und Sterben zu ignorieren oder außer Betracht zu lassen. R Im Gegensatz zum neuen Mittelstand kapituliert die neue Unterschicht vor den modernen Herausforderungen. Sie bringt höchstens die Selbstdisziplin auf, nicht noch weiter abzusinken. Der Unterschied zur Mittelklasse ergibt sich vor allem aus dem anderen Verhältnis zur Arbeit: Arbeit als Kreativität vs. Arbeit, um Geld zu verdienen. Die Unterklasse ist nicht mehr durch „doing singularity“, sondern durch „muddling through“ (354) charakterisiert. Unterklasse zeigt sich an Übergewicht, Fernsehkonsum und Erziehungsschwierigkeiten. Dagegen entwickeln deren Angehörige „plebejische Authentizitäten“ (362), zum Beispiel Maskulinismus und Machotum. Die Oberklasse ist im Vergleich zur Mittelklasse mit mehr Geld, das heißt größeren Singularisierungsmöglichkeiten ausgestattet (364). Neue Sozialstrukturen bewirken neue Formen der Politik. Die alte Politik des Gemeinwohls wird von einer „Politik des Besonderen“ (371) abgelöst. Singularisierungsprozesse bewirken einen neuen Liberalismus, der die kulturellen Freiheiten betont (371). In dieser Perspektive fordern dessen Anhänger eine Politik der kulturellen Diversität und der Nicht-Diskriminierung (380); nötig wird ein „diversity management“ (382), um all die unterschiedlichen Diversitäten zusammenzuhalten. Deswegen konzentriert sich Politik auf das Lokale und Regionale, auf die Situation vor Ort. Die Gestaltung der Großstadt, also Stadtplanung rückt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Städte singularisieren sich, sie werden nach ihrer Attraktivität bewertet, zum Beispiel Paris, Venedig, New York gegen Bielefeld, Mannheim und Wanne-Eickel. Und an diesem Punkt wird es ebenfalls spannend für die Theologie. Reckwitz sagt, dass sich analog zum religiösen Fundamentalismus ein neuer Kulturessenzialismus entwickelt. „Unabhängig davon, ob es sich um eine ethnische, religiöse, nationale oder völkische Gemeinschaft handelt, der Träger des Wertes ist im Kulturessenzialismus nun ein Kollektiv, genauer: das eigene Kollektiv als kulturelle Einheit.“ (395) Und das erklärt für ihn die religiösen Fundamentalismen, die nationalistischen Bewegungen und die rechtspopulistischen Parteien.
Kulturessenzialistische Neo-Gemeinschaften haben eine politische Dimension, die Reckwitz im aufblühenden Rechtspopulismus findet. Dieser ist für ihn keine Verlängerung des Rechtsradikalismus, sondern eine Reaktion auf die spätmodernen Singularisierungsbestrebungen (413). „Die subjektiven Enttäuschungen, welche die Kultur der Selbstverwirklichung, der Hyperkompetitivität, der Singularitätsmärkte und das Kreativitätsdispositiv hervorrufen können, werden mit einem radikalen Gegenmodell gekontert, das antiindividuelle Gemeinschaft, Egalität und Tradition setzt.“ (419) Das ist eine „Mobilisierung der Peripherien gegen das Zentrum“ (419). Insgesamt steht ein „apertistisch-differenzielle[r] Liberalismus“ (421) gegen neue Formen des Kulturessenzialismus. Der Widerstand gegen den neuen Liberalismus nimmt gelegentlich die Form von Radikalität und Terror an. Bei Attentätern, Amokläufern und Terroristen handelt es sich um „selbstbewusste negative Singularitäten“ (426), und Reckwitz spricht vom „negativen Heroismus des Täters“ (427). Am Ende kommt Reckwitz zu einem merkwürdig resignierten Fazit des gesamten Buchs. Es ist nicht vorherzusagen, wer die Oberhand behalten, der singularisierte Liberalismus des neuen Mittelstands oder die alten kulturessenzialistischen Gemeinschaften religiöser, sozialer, nationaler oder politischer Natur: „Die sozialen Asymmetrien und kulturellen Heterogenitäten, welche dieser Strukturwandel der Moderne potenziert, seine Freisetzung positiver und negativer Affekte lassen Vorstellungen einer rationalen Ordnung, einer egalitären Gesellschaft und einer balancierten Gesellschaftsstruktur, wie sie manche noch hegen mögen, als das erscheinen, was sie sind: pure Nostalgie.“ (442) I Aber die Bewertung der Zukunft ist ein weites, unsicheres Feld, Reckwitz‘ Analysen lohnen allerdings noch einen genaueren Blick, was die Behandlung von Religion angeht. 5. Nur Affekte und Fundamentalisten?Mit Ausnahme des sehr genau herausgearbeiteten Verhältnisses zwischen Kulturessenzialismus und fundamentalistischen Gruppen kommen Religionen und Kirchen in Reckwitz‘ Überlegungen leider nur am Rand vor. Trotzdem lohnt es sich, den wenigen Hinweisen nachzugehen und daraus praktisch-theologische Schlussfolgerungen zu ziehen. Der erste wichtige Hinweis zielt auf die narrativ-affektive kirchliche Kultur, der zweite auf Performanz im klerikalen System, der dritte auf Religion als eine Kultur der Enttäuschungstoleranz, der letzte auf die Verwandlung der Kirchen in fundamentalistische, gegen Moderne und Öffentlichkeit abgeschlossene Gruppen. 1. Die Kirchen der Bundesrepublik sind in den letzten Jahrzehnten dazu übergegangen, sich als intermediäre Institutionen[33] zu verstehen, die zwischen dem Allgemeinen, den Interessen des Gemeinwohls, und dem Besonderen, also individuellen Glauben und seiner privaten Lebensorientierung eine Vermittlerposition einnehmen. Durch die konstant hohe Zahl der Kirchenaustritte ist diese Position allerdings fragwürdig geworden. Und damit geht auch das konstitutive Selbstverständnis verloren, nach dem die Kirchen als Volkskirchen für alle Protestanten bzw. alle Katholiken zuständig sind. Das ist eine sehr ambivalente Entwicklung: Auf der einen Seite tendieren die Kirchen in Gestalt ihrer amtskirchlichen Bürokratien zur ethischen Rationalisierung, denn man würde den eigenen Kirchenmitgliedern gar zu gerne verbindliche Vorschriften machen, wie sie sich in prominenten ethischen Fragen (Flüchtlinge, Sterbehilfe, Demenz, Organtransplantation, Rassismus, Rechtsextremismus) zu verhalten haben. Auf der anderen Seite haben die protestantischen Kirchen den Prozess der Individualisierung erheblich mit befördert, indem sie – typisch volkskirchlich – unterschiedliche Positionen innerhalb der Kirche gelten ließen und sich darauf beschränkten, in einer Moderatorenrolle die aus den Konflikten resultierenden Brüche (und damit Austritte) zu vermeiden: We agree to disagree. D Kirchen und Religionen tauchen ein erstes Mal an der Stelle auf, an der Reckwitz den Übergang zwischen rational zu verarbeitenden Informationen und die Affekte mobilisierenden Narrationen (89) beschreibt. Kann man eine Religion, eine Kirche nicht gerade als die spirituelle Unternehmung der Beschreibung und Gestaltung von Lebenswelt verstehen, die eingebunden ist in einen affektiv-narrativen Rahmen, der von der Bibel bis zu den Bekenntnisschriften reicht? Eine evangelische Kirche verbindet, formal beschrieben, einen Komplex heiliger Erzählungen (Bibel, Evangelium, Heilsgeschichte) mit den Erfahrungen, die Menschen in ihrer Alltagswelt machen. In gemeinsamen liturgischen (Gottesdienst, Andacht, Singen etc.) und individuell spirituellen (Gebet, Bibellektüre etc.) Vollzügen wird den Glaubenden eine Möglichkeit an die Hand gegeben, eigene Erfahrungen anhand von Leitbegriffen wie Rechtfertigung, Sünde, Glaube, Hoffnung religiös zu deuten. Diese Deutung wird mit dem Ziel unternommen, die letztendlich geschenkte Erfahrung von Gewissheit, Vertrauen und Glauben zu erleben. Be Es ist das Problem der aktuellen Kirchen-Innenpolitik, dass hier, sofern diese Analyse richtig ist, die Praxis der singularisierten, an Spiritualität durchaus interessierten Menschen, nicht mehr mit den starren Erwartungen und den abstrakten strategischen Programmen der kirchlichen Bürokratie übereinstimmt. Letztere fixiert sich hilflos auf den Erhalt von Bindung und Zugehörigkeit. Weil sie diese nicht mehr erhalten kann, breiten sich unter einem Schutzschild des Zweck- und Glaubensoptimismus gravierende Verlustängste aus. Zu gerne würde man die Bewegung der Kirchenaustritte stoppen. Aber kein singularisierter Glaubender mag sich auf Bindung und Zugehörigkeit einlassen, wenn er davon keinen affektiven und theologischen Nutzen hat. Bindungen sind für keine Institution umsonst zu haben. Sie muss Werte und Affekte vermitteln, ohne die eine Kirchenmitgliedschaft dieselben Ergebnisse zeitigt wie die Mitgliedschaft in einem Fitness-Studio, das man nie besucht. Irgendwann wird man die Gebühren nicht mehr zahlen wollen, weil man das Geld nicht nutzlos ausgeben will, selbst dann, wenn Leistungen und Trainingsmodalitäten des Fitness-Studios einen hervorragenden Ruf genießen. Den Nutzen dieser Bindung bestimmt auf kirchlicher Seite im Übrigen nicht die episkopal-klerikale Leitung der Institution, sondern dieser Nutzen wird durch die Praxis, die Erfahrungen der Glaubensanhänger bestimmt.
2. Beim Verhältnis von Laien und Experten, ausgebildeten Theologen und ehrenamtlichen Mitarbeitern bestehen weitere Sollbruchstellen, die mit Hilfe von Reckwitz‘ Analysen ans Licht gelangen. Hier ist anzuschließen an seine These von der Umstellung der Arbeitswelt von ‚Leistung‘ auf ‚Erfolg‘ und ‚Performanz‘[35]. Kirchliche Bürokratie besteht gar nicht mehr nur aus ‚Experten‘, sondern hinzu kommen eine Vielzahl von ‚Laien‘, also Synodale, Älteste, Prädikanten, Erwachsenenbildner mit einer theologischen Schmalspurausbildung, die sich in Gremien, Ausschüssen und Kommissionen langatmig und ineffizient darüber austauschen, was als ‚Erfolg‘ bewertet wird. ‚Erfolg‘ meint hier in der Regel nicht Erfolg beim Publikum außerhalb der Kirchen, das in die Gemeinde hineingezogen wird, sondern Übereinstimmung mit der kirchlichen Binnenkultur, die nicht gefährdet werden darf. Das gilt für die semantischen wie die psychologischen Aspekte des Erfolgs sowie für die Gruppenzugehörigkeit in der Bürokratie oder im Funktionärswesen. Auf diesem Weg geschieht es ganz schnell, dass neben der bürokratischen Beratungs- und Entscheidungskultur die gesamte kirchliche Kultur banalisiert und simplifiziert wird. Das Binnenpublikum der Ausschüsse und Kommissionen will auf keinen Fall überfordert werden. ‚Wir‘ müssen doch ‚alle mitnehmen‘, um einmal trivial-ekklesialen Jargon zu gebrauchen. Darum werden den Experten nur noch sehr niedrige theologische Stöckchen hingehalten, um darüber zu springen. Und so entsteht aus den Niederungen der Performanzkultur sehr schnell ein harter Legitimationsdiskurs für die eigenen Arbeitsfelder. Der (theologische) Performer schaut nur noch auf sein Publikum, das ihn beständig ‚evaluiert‘, nämlich Gelder für ‚Projekte‘ bewilligt, die die jeweils eigene Stelle erhalten. In der Drittmittelkultur der Universitäten mit ihren Exzellenzclustern und -initiativen, mit Graduiertenkollegs und anderem geschieht im Moment etwas sehr Ähnliches. Die Unterschiede liegen in den Fetischen (‚wir wollen alle mitnehmen‘ in die ‚gestaltete Mitte‘ versus Expertokratie) und in der Exklusion der Laienkultur. 3. Reckwitz kommt in seiner Analyse ein weiteres Mal auf die Religion, an dem Punkt, als er nach den Folgen der Singularisierungsprozesse fragt. Denn wenn die singularisierten Individuen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, dann reproduzieren sich charakteristische Schemata: The winner takes it all. Die Gesellschaft als Singularisierungsgenerator produziert wenige Gewinner, die im Rampenlicht stehen und sehr, sehr viele Verlierer, deren Anerkennungserwartungen nicht befriedigt werden. Für solche Enttäuschungen stellt die Gesellschaft keine alltagstauglichen Strategien parat, diese zu adäquat bewältigen. Reckwitz zählt dazu ausdrücklich auch „Enttäuschungen, die sich aus existenziellen ‚Unverfügbarkeiten‘ ergeben“ (347). Er verweist dann auf Hanya Yanagiharas bedeutenden Roman „Ein wenig Leben“[36], in dem ein reicher New Yorker Anwalt schließlich Suizid begeht, weil er die Traumata seiner Kindheit (sexueller Missbrauch, sadistische Gewalt) therapeutisch nicht bewältigen konnte.
Reckwitz sagt nun ausdrücklich, er wolle das Ertragen der Unverfügbarkeit nicht theologisch verstehen. Stattdessen verweist er auf die Kunst und nennt das erwähnte literarische Beispiel von Yanagihara, das allerdings besonders in seinen Schlusskapiteln das Scheitern solcher Enttäuschungsverarbeitung nachdrücklich dokumentiert. Es wäre zu fragen, ob man diese Bewertung von Reckwitz unbedingt teilen muss und ob hier nicht doch eine besondere Funktion der Religion ins Spiel kommt. Religion wäre dann zu verstehen als eine Kultur des Verhaltens zu den Unverfügbarkeiten des Lebens, also Geburt, Tod, Leiden und Krankheit. Man wird nicht leugnen können, dass Religion Menschen instand setzt, nicht nur mit den Erfolgen, sondern auch mit den Enttäuschungen und Grenzen eines Lebens einen plausiblen, akzeptierenden Umgang zu finden. Wobei warnend zu sagen ist: Religion geht in dieser Funktionalität nicht auf, hier ist auf die Momente von Narrativität und Affekten hinzuweisen, die ich im zweiten Punkt dieses Abschnitts entwickelt habe. 4. An einem letzten Punkt kommt Reckwitz auf die Religion zu sprechen, nämlich dann, wenn er von Fundamentalismen spricht. Er stellt die These auf, dass sich in Reaktion auf den Umbau der Moderne zu einer singularisierten Gesellschaft ein neuer Kulturessenzialismus entwickelt, der analog zum religiösen Fundamentalismus zu begreifen ist. Religiöse Fundamentalisten ziehen sich vor der Moderne in kleine abgeschlossene Gemeinschaften zurück, in denen sie eine eigene Moral, eine eigene Dogmatik und eigene Gemeinschaftsrituale pflegen. Aber hier wäre zu entgegnen, dass Religion missverstanden wäre, wenn sie allein als Kitt für Reservate gemeinsamen Lebens in der singularisierten Gesellschaft dienen würde. Es ist Reckwitz nicht zu widersprechen, dass evangelikale und theologisch konservative Gruppen diesen Weg des Rückzugs aus der Moderne gegangen sind. Aber es ist entschieden zu widersprechen, wenn man dieses als den einzigen Weg begreift, der religiösen Gemeinschaften und Kirchen zur Verfügung steht. Ihnen stehen auch andere Wege zur Verfügung, als sich aus modernisierten Gesellschaften zurückzuziehen.
Gibt es also gar keine Hoffnung mehr? 6. „Kultur der Konfessionslosigkeit“ (Detlev Pollack)Im Jahr 2020 veröffentlichte eine aus der Bildungskammer der EKD heraus gebildete Studiengruppe ein längeres Papier unter dem Titel „Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit“[38]. Schon der altertümelnde Titelbegriff der Konfessionslosigkeit erstaunt. Nicht überraschend nimmt er Detlev Pollacks Wendung von der „Kultur der Konfessionslosigkeit“ (13) auf, die sich dem Münsteraner Religionssoziologen zufolge schon in der DDR entwickelt habe (24) und weiter fortbestehe. Auf der anderen Seite gehört dieser Terminus doch in die alte Sprache des Säkularisierungs-Narrativs, welches Kirchen und Staat benutzten, um die Nicht-Zugehörigkeit zu einer der beiden großen Kirchen (Konfessionen) mit einem Wort zu markieren, dem mindestens ein leichter Geruch von Despektierlichkeit anhaftete. Immer noch ist in diesem Sprachgebrauch die vormoderne und nicht besonders pluralistische Unterscheidung zwischen vera und falsa religio bzw. zwischen wahrer und keiner Religion herauszuhören. In der Konsequenz haben die Autoren der Studie Schwierigkeiten, die Gruppe der Konfessionslosen durch etwas anderes zu kennzeichnen als durch die Nicht-Zugehörigkeit zu einer Religion. Deswegen wird auch die Heterogenität der Konfessionslosen betont (35). Diese Schwäche liegt schon in der Konstruktion des Begriffs begründet. Ob das eine Merkmal der fehlenden Religionszugehörigkeit genügt, um eine ‚Kultur‘ zu bilden, mag dahingestellt sein, zumal Konfessionslosigkeit in der Regel nicht gegen die Kirchen gelebt wird, sondern ihnen gegenüber gleichgültig.
Als konfessionslos gelten in der Bundesrepublik ca. 30 Millionen Menschen, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung (26), gegenüber 47,2 Millionen Angehörigen der christlichen Kirchen. Wie erwähnt, liegt der Anteil der Konfessionslosen in den neuen Bundesländern deutlich höher als in den alten (29). Das bedingt die Ungleichheit konfessioneller Verhältnisse: In Sachsen zum Beispiel stellen die Konfessionslosen die große Mehrheit der Bevölkerung (80 %), in ländlichen Teilen der südlichen Bundesländer bilden sie weiterhin eine Minderheit (41). Nun haben die Kirchen in ihrer funktionalen gesellschaftlichen Differenzierung eine Vielzahl von diakonischen und sozialen Angeboten entwickelt, die keineswegs nur für Kirchenmitglieder offenstehen. Die Studie betont also, es böten sich „Kontaktflächen zwischen Kirchen und Konfessionslosen“ (50), deren Potential genutzt werden müsse. Dazu zählen Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Religions- und Konfirmandenunterricht etc. Die Studie stellt fest: Je mehr der Status der Kirche als öffentlicher Institution abnimmt, desto weniger selbstverständlich ist die Bereitschaft der Konfessionslosen, sich auf diese Angebote einzulassen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese lieber andere, religiös neutrale Angebote annehmen oder solche sofort selbst entwickeln. Es wird festgestellt: Wer keiner Religion als Mitglied angehört, für den bedeutet das noch lange nicht, dass er spirituell nicht interessiert ist. Religiosität ist also keineswegs gebunden an die Mitgliedschaft in einer religiösen Institution. Und weiter: Möglicherweise bestehen auffällige Gemeinsamkeiten zwischen „spirituell interessierte[n] Konfessionslosen und kritisch-zweifelnde[n] Kirchenmitglieder[n]“ (52ff.) Die Studie sieht hier Chancen zu orientierenden Angeboten, die allerdings genau auf diese Zielgruppen abgestellt sein müssen. Nicht zu Unrecht erhebt sich dabei die Frage nach den Unterschieden zwischen religiösen und nicht-religiösen Orientierungen, Weltdeutungen und -anschauungen sowie zwischen Alltagsethiken. Diese Unterschiede zwischen Religion und Nicht-Religion bedürfen der theologischen Reflexion, um daraus besondere Angebote für die Konfessionslosen zu entwickeln (55.59). Das bedeutet einen „Streit um die Auslegung der Wirklichkeit“ (81). Dabei würdigt die Studie ausdrücklich die Erschließungskraft der systematischen Theologie (68ff.), der die Aufgabe zugeteilt wird, religiöse und nicht-religiöse Lebensdeutungen miteinander zu vergleichen und füreinander dialogfähig zu machen (70).
Der einladende Charakter des Evangeliums zeigt sich darin, dass sie missionarisch ausgerichtet ist. Kirche hat Anteil an der Missio Dei; sie versteht sich als Element bei dem Bemühen Gottes, seine Barmherzigkeit und Gnade unter den Menschen bekannt zu machen (87). Missionarische Kirche steht also vor der Aufgabe, „Kontaktflächen“ (91) zu schaffen und das religionspädagogische Handeln entsprechend auszurichten. „Ziel ist es, an den Kontaktflächen Menschen eine veränderte Beziehung zur christlichen Botschaft zu ermöglichen – mit offenem Ergebnis, aber in der Hoffnung, dass sich konfessionslosen Menschen die Kommunikation des Evangeliums als relevant erschließt.“ (92; Hervorhebungen wv) Relevanz bedeutet, die „Lebensdienlichkeit des Evangeliums“ (93) herauszuarbeiten. Wenige Seiten später folgt eines der Schlüsselzitate, das das Dilemma der Studie klar und deutlich vor Augen führt: „Die hier entwickelten Überlegungen zur religiösen Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit sind von der Hoffnung getragen, konfessionslose Menschen für den (Wieder-)Eintritt in die evangelische Kirche zu gewinnen, aber sie beleuchten vor allem das, was Kirche und Theologie dazu beitragen können – ohne sie unter statistischen Ertragsdruck zu stellen und geistliche Renditeerwartungen zu formulieren.“ (96) Um es ganz hart auf einen Punkt zu bringen: Das ist nun doch wieder die pluralismusfähige und deswegen wolkige Umschreibung des alten augustinischen „Cogite intrare!“ Auf der einen Seite werden Orientierungen und Lebensentwürfe diskutiert, auf der anderen Seite stehen die harten Fakten der Statistik[39]. Dieses Papier zur Konfessionslosigkeit zehrt religionspädagogisch noch immer von den alten Gegensätzen zwischen der kerygmatischen Evangelischen Unterweisung der fünfziger Jahre und dem volkskirchlichen problemorientierten Unterricht aus den sechziger und siebziger Jahren. Sorgfältig vermeiden es die Autoren, zwischen den immer noch vertretenen Mustern eines theologischen Autoritarismus und einer stärkeren Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen im Alltag eine Wertung zu treffen. Genau an diesem Punkt hätte eine Rezeption der Singularisierungstheorie von Reckwitz die Perspektiven öffnen können. Denn vor einem singularisierten Publikum führt sich jeder theologische oder evangelikale Missions-Autoritarismus selbst ad absurdum. Bei der Empfehlung von Strategien, mit der gegenwärtigen Situation umzugehen, zeigen die Verfasser eine merkwürdige Ambivalenz und Unsicherheit. Sie wollen Chancen statt Verluste sehen (99), inneren und äußeren Pluralismus wahren (100); sie fordern religiöse Dreisprachigkeit: Richtung Ökumene, Richtung Konfessionslose, Richtung andere Religionen (101). Ihnen geht es um Offenheit und Dialog, Mut, Zuversicht und Dankbarkeit (104). Die folgenden Neuvorschläge werden dann unter dem Wechsel der Prioritäten, dem Wechsel der Blickrichtung und dem mutigen Experimentieren rubriziert (106f.). Das Experimentieren ist als Stoßrichtung kirchlichen Handelns in letzter Zeit dort populär geworden, wo sich auch die klerikale Bürokratie mittlerweile in die sozialen Medien traut. Nach dem Motto: Schauen wir uns die Einzelprojekte an, wir nehmen das, was sich als ‚best practice‘ (ein anderes dieser anglisierten Unwörter) bewährt.
Interessanter erscheint die Aufforderung an die Kirchen, dabei mitzuarbeiten, Wissen über Religion schon im Elementarbereich anzubieten (112), damit alle Kinder, ob religiös oder nicht-religiös über den Beitrag der Religionen zur europäischen Kultur elementare Kenntnisse und Kompetenzen besitzen. Das bedeutet wohlgemerkt nicht eine Erweiterung des Religionsunterrichts, sondern eine Verankerung von Religion als Thema in den Bildungsplänen der anderen kulturorientierten Fächer. Eine weitere Zuspitzung gilt dem Ethikunterricht, der oft als nicht-religiöse Alternative zum Religionsunterricht verstanden wird, obwohl eine Mehrheit ethischer Entwürfe nicht ohne religiöse Elemente auskommt (114). Man muss unterscheiden zwischen Religionsfreiheit und Bildungsauftrag. Alle Mitglieder der Gesellschaft, auch die jungen, sollen zwischen Religionen und Nicht-Religion frei wählen können. Das bedeutet aber nicht die Freiheit von dem Bildungsauftrag, über die historischen und aktuellen Leistungen von Religion – in welchem Schulfach auch immer – informiert zu werden. Jeder Schüler benötigt Orientierungswissen über den faktischen, gegenwärtigen und historischen Einfluss von Religionen auf Kultur und Politik. Was den Pluralismus angeht, so weist die Studie auf den inneren Pluralismus der Kirchen hin, wobei es, das zeigen die Analysen von Reckwitz, nicht genügt, auf die Vielfalt evangelischer Frömmigkeitsstile aufmerksam zu machen. Denn Vielfalt unterstellt stets Gleichwertigkeit. An Reckwitz wurde jedoch sichtbar, dass im Moment liberale und fundamentalistisch-pietistische Frömmigkeitsstile gegeneinanderstehen. Das geschieht nicht in aller Vielfalt, sondern dieser Prozess ist behaftet mit Konflikten, ja sogar Intrigen. Die Studie empfiehlt weiter, die Lebens- und Weltdeutungen konfessionsloser Menschen herauszuarbeiten, darzustellen und sich mit ihnen theologisch auseinanderzusetzen (116). In diesem Zusammenhang mutet es merkwürdig an, die Arbeit der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen herauszustellen und ihr neue Aufgaben zuzuweisen (121), arbeitet diese doch seit Jahrzehnten, von der offiziellen Kirche nahezu unbemerkt und unbeachtet, an diesen Themen. L Die Botschaft einer Neuorientierung kirchlicher Bildungsarbeit an denen, die keiner Religion mehr angehören, ist angekommen. Aber es wäre zu fragen, ob diese Diagnose nicht mit ein wenig mehr Selbstkritik hätte verbunden werden können. Auch in der Vergangenheit war es ja schon so, dass die Kirche sich auf die missio Dei berufen hat und sich denen zuwandte, die außerhalb der Kirche standen: in der Akademiearbeit, die jahrelang kaputtgespart wurde, in der fälschlich so genannten Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, in einer Erwachsenenbildung, die wehrlos und theologisch unreflektiert die Selbstbanalisierung der eigenen theologischen Überzeugungen hinnahm und auch noch beförderte. Die Studie, so wird man zusammenfassen müssen, bringt wenig Neues in die Diskussion. Ihr Verdienst liegt darin, dass sie vorhandene Bestrebungen und Perspektiven neu zu Bewusstsein bringt und neu fokussiert. Ob die klerikalen Bürokratien zu solchen Veränderungsprozessen in der Lage sind, bleibt abzuwarten. Gesprächsbedarf wäre bei der (Religions-)Soziologie erneut anzumelden. Dann es müsste einmal, so eine Forderung der Studie, konkret beschrieben werden, welche Orientierungen, Handlungen und philosophischen Entwürfen, vielleicht auch welche Spiritualität sich hinter den vermuteten Kulturen der Konfessionslosigkeit verstecken. Kandidaten wären ja genügend da: Agnostizismus, Pragmatismus, Szientismus, Rationalismus, Esoterik, Mystik. All das einmal zu untersuchen auf Kerngehalte, auf theologische Themen, auf Felder der notwendigen dogmatischen Debatte, das würde größeren theologischen Aufwand lohnen. Es setzt voraus, dass man sich der eigenen Orientierungen, der eigenen Alltagsethik und Spiritualität bewusst ist. Es wären also auch Habitusformen oder Lebenshaltungen (beides im Plural!) des Christlichen herauszuarbeiten, ein über Jahrzehnte hinweg vernachlässigtes Schnittfeld von Praktischer Theologie und Dogmatik. Insgesamt ist diese Neuorientierung des Papiers über Konfessionslosigkeit zu begrüßen, wenn man sie denn als Kritik einer andauernden Tendenz der kirchlichen Bürokratie zur Beschäftigung mit sich selbst versteht. Dann erscheint sie als der Versuch, die Ziele praktisch-theologischer Arbeit neu nach außen zu richten, auf diejenigen, die von Religion in größerem oder kleinerem Maße Gebrauch machen, ohne sich deswegen für eine Mitgliedschaft in der Kirche im tieferen (regelmäßige Gottesbesuche, regelmäßige Mitarbeit) oder im theologischen Sinn (Taufe) zu entscheiden. Im Blick auf die bisherigen religionssoziologischen Deutungsversuche (s.o. Abschnitt 3) und im Blick auf Reckwitz‘ Singularisierungstheorie ist zu fragen, ob die Studie nicht zu optimistisch bleibt, was die Planbarkeit und Rationalisierung kirchlicher Arbeit angeht. Im klerikalen Jargon taucht gelegentlich das Bild von evangelischen Landeskirchen als schwer zu steuernden Tankern auf, mit sehr langem Bremsweg und sehr großem Kurvenradius. Darin ist etwas von dem Bewusstsein aufbewahrt, dass Kirchen sich nur mit Mühe gegen auch in die Kirchen selbst durchschlagende soziale Entwicklungen wehren können. Die erwähnten Zahlen der Freiburger Studie sprechen dazu eine eindeutige Sprache. Man kann sie defätistisch verstehen und resignieren. Man kann aber auch über die Veränderbarkeit des Unabänderlichen nachdenken.
7. Menetekel der ZahlenAm Ende dieses Beitrags sollen die Ergebnisse in einer Reihe von Beobachtungen und Reflexionen zusammengefasst werden. 1. Manche emotionale Befindlichkeit in den evangelischen Kirchen erinnert an die deutsche Sozialdemokratie, die wie die Kirchen als Institution von einer andauernden Krise betroffen ist, die sie Mitglieder kostet und die Struktur der Ortsvereine schwächt, während keine Regierungsbeteiligung oder Oppositionsarbeit in irgendeiner Weise das öffentliche Bild von ihr verbessert. Die SPD kann gegenwärtig tun, was sie will, sie verliert bei den meisten Wahlen deutlich an Stimmen. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg im Frühjahr 2020 war eine Ausnahme. Die SPD macht den Eindruck einer ratlosen, zerstrittenen, schrumpfenden Partei, die mit sich selbst nicht im Reinen ist. Ähnliches gilt für die Kirchen, ohne den Vergleich weiter treiben zu wollen. Man scheint immun gegenüber allen Formen der Kritik, aber die vermiedenen öffentlichen Debatten über den Kurs der Kirchen treiben die Gegenargumente nur in das Unausgesprochene, hinter vorgehaltener Hand Gesagte. Flüstereien und Intrigen um innerkirchliche Ziele gewinnen an Bedeutung. Die vermiedenen öffentlichen Diskussionen verdecken eine Stimmung der Resignation, die sich unter der Hand verwandelt in die klerikale Bereitschaft, sich jedem Heilspropheten, der Coaching-Kultur, der psychologischen Betreuungskultur, den Marketing-Experten in die Arme zu werfen und von ihnen billige Ratschläge für eine dauerhafte Besserung zu erhoffen.
3. Nach meiner Überzeugung zeigen die Studien von Reckwitz, aber auch vorher schon von Berger, Joas und anderen, dass es nicht, wie die EKD-Schrift suggeriert, um einen Prozess der Entkonfessionalisierung und der Abwanderung des Religiösen vom institutionell Gesicherten ins beliebige Private geht. Vielmehr sind die Kirchen mit umfassenden Modernisierungsprozessen der Gesellschaft konfrontiert. Prozesse der Entkonfessionalisierung sind nur ein kleiner Teil davon. Man kann darüber streiten, ob Reckwitz‘ Singularisierungstheorie die Veränderungen der gegenwärtigen Moderne genau umschreibt, aber sie hat in jedem Fall einen empfindlichen Punkt getroffen. Die Wirkungen der singularisierten Moderne zeigen sich in einer schleichenden Aufspaltung der Gesellschaft in liberale, akademisch gebildete Globalisierungsgewinner und reaktionäre, regionale Gegner, die sich in populistischen Parteien sammeln. Politisch haben diese eine Neigung zur extremen Rechten, theologisch zum evangelikalen Fundamentalismus, wenn sie auch mit keinem von beiden zu verwechseln sind. Insofern gilt, dass sich der Gegensatz zwischen Liberalen und Populisten auf der Ebene der Gesellschaft auf der Ebene der Kirche abbildet im Gegensatz zwischen liberalen Verteidigern der (ehemaligen) Volkskirche und evangelikalen, zum Fundamentalismus neigenden Gruppen. Bergers Modell einer deduktiven, reduktiven und induktiven Reaktion der Kirchen und Theologien auf die Moderne ist also unter veränderten Bedingungen immer noch aktuell geblieben.
Die für die Kirchen relevanteste Entwicklung der Moderne scheint mir der Pluralismus zu sein. Es war verhängnisvoll für die Landeskirchen der Nachkriegszeit, den sich entwickelnden Pluralismus der Bundesrepublik nur oberflächlich zu akzeptieren und unter dieser Oberfläche weiter von der flächendeckenden Versorgung der Volkskirche zu träumen. Es war genauso verhängnisvoll, dass die evangelische Kirche der DDR die Versuche des Parteistaats, zu einer Zwangssäkularisierung der Bevölkerung zu gelangen, defätistisch als Schicksal hinnahmen. Bis heute stellen sich deren kirchliche Erben deshalb als theologisch besonders gewappnet dar, um mit Entkonfessionalisierungsvorgängen umzugehen. Es hilft aber nicht viel weiter, den kirchlichen Widerstand gegen die Einheitspartei einfach auf einen nebulösen Widerstand gegen die Zumutungen der modernen Gesellschaft zu übertragen. Solche Ratschläge sind eher der Nostalgie und mangelnder Veränderungsbereitschaft geschuldet. Deswegen ist das EKD-Papier so wichtig, weil es beide zu kurz greifenden Haltungen durch eine neue Perspektive auf die anstehenden Fragen ablöst.
5. Zu befragen ist die implizite These von Reckwitz, nach der Religionen, wenn sie überhaupt weiterexistieren, stets auf der Seite von Populisten und Fundamentalisten zu stehen kommen, die sich aus der Moderne zurückziehen. Es muss die Frage gestellt werden, ob man modernitätskompatible Formen von Religion soziologisch denken kann. Ansätze dazu bei Reckwitz selbst sind durchaus vorhanden, wenn er nach Enttäuschungstoleranzen, nach dem Umgang mit Niederlagen und Depressionen fragt. Sollen solche Formen von Religion die institutionelle Gestalt einer Kirche annehmen, so dürfen sie sich nicht mehr wie im alten, hierarchischen Gesellschaftsmodell als unabdingbare Institutionen der Daseinsvorsorge verstehen, sondern müssen sich für neue Formen der Partizipation (und der Mitgliedschaft) öffnen. Sie müssen, um es in Reckwitz‘ Terminologie auszudrücken, stärker zu Neo-Gemeinschaften werden. – Es ist bei Reckwitz schließlich kritisch zu fragen, ob die von ihm so gründlich analysierte Singularisierung nach seiner Vorstellung so weit führt, dass darüber alle traditionellen Gemeinschaftsinstitutionen (Parteien, Gewerkschaften, Kirchen) zum Untergang verurteilt sind, weil sie Formen sozialer Bindung voraussetzen, die nicht mehr modernitätskompatibel sind. Als einzige Ausnahme einer sozialen Institution bleibt dann nur noch der Staat, auf globaler Ebene als Staatengemeinschaft wie die Europäische Union, auf nationaler Ebene als demokratischer Rechtsstaat, auf lokaler Ebene als kommunaler Verband, urban oder ländlich. Ich frage mich, ob das nicht auf die Dauer ein Zuwenig an kommunitären Formen des Zusammenlebens darstellt, ob hier nicht Kirchen, Parteien und Gewerkschaften in modernisierter Form doch noch ein soziales Medium darstellen, um partikulare Interessen gemeinsam zum Ausdruck zu bringen. Wenn das nötig ist, ist es auch nötig, diese Aufgaben (Arbeitnehmerinteressen, Gruppenbildung, Bearbeitung von Sinnfragen) institutionell zu verankern, denn das kann privatim und individuell nicht geleistet werden. 6. Ist diese letzte Bemerkung richtig, dann gäbe es auch für die evangelischen Kirchen trotz alarmierender Zahlen, genügend Gründe, in verwandelter, modernisierter Gestalt weiter zu arbeiten an der Auseinandersetzung mit drängenden theologischen Fragen. Die Zugehörigkeitsfrage würde darüber erst einmal in den Hintergrund rücken – und Platz machen für die Theologie, verstanden nicht als eine moralisierende Sozialtheorie, sondern als nüchterne Bearbeitung derjenigen Fragen, die sich Menschen über Trost, Erfolg und Leistung, Scheitern, Geburt und Tod sowie den Sinn des Lebens stellen.
Anmerkungen[1] Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte. Bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, Wien Salzburg 1948. [2] Helmut Schelsky, Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Frankfurt/M. u.a. 1975 (1957). [3] Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, München 2004 (amerikan. 1964). [4] Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/M. 1986. [5] Gerhard Schulze, Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/M. 1992. [6] Florian Illies, Generation Golf. Eine Inspektion, Frankfurt/M. 2000. [7] Manuel Castells, Das Informationszeitalter. Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Bd.1, Opladen 2001 (engl. 1996). [8] Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt/M. 2005. [9] S.u. Abschnitt 4. [10] Exemplarisch Jürgen Habermas (Hg.), Stichworte zur Geistigen Situation der Zeit, es 1000, Frankfurt/M. 1979. [11] Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Berlin 2002 (7.Aufl., 1987). [12] Als Beispiel dafür mag der Publizist Matthias Horx stehen (https://www.horx.com/). [13] Dazu zum Beispiel Wolfgang Vögele, Auf dem Altar der Algorithmen. Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen, tà katoptrizómena, Heft 112, April 2018, Teil I https://www.theomag.de/112/wv042.htm, Teil II https://www.theomag.de/112/wv043.htm. [14] Peter L. Berger, Ein Marktmodell zur Analyse ökumenischer Prozesse, IJRS 1, 1965, 235–249. [15] Ders., Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt/M. 1980 (engl. 1979). [16] Zuletzt: Heinrich Bedford-Strohm, Volker Jung (Hg.), Vernetzte Vielfalt. Kirche angesichts von Individualisierung und Säkularisierung: die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2015. [17] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Kirchenkritik. Beiträge zu Kirchentheorie, praktischer und ökumenischer Theologie, KirchenZukunft konkret 12, Münster u.a. 2019, und darin besonders ders., Kritik der aufblasbaren Kirche, a.a.O., 45-74. [18] S.u. Abschnitt 7. [19] Wolfgang Vögele, Helmut Bremer, Michael Vester (Hg.), Soziale Milieus und Kirche, Religion in der Gesellschaft 11, Würzburg 2002. [20] Vgl. dazu Vögele, Kirchenkritik, a.a.O., Anm. 17, 36-39. [21] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Habitus – Individualität – Alltagsethik, in: I.U.Dalferth, Ph.Stoellger (Hg.), Krisen der Subjektivität, Religion in Philosophy and Theology 18, Tübingen 2005, 561-582. [22] Pierre Bourdieux et al., Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz 1997 (frz. 1993). [23] Annie Ernaux, Die Jahre, Berlin 2017 (frz. 2008) sowie dies., Erinnerung eines Mädchens, Berlin 2018 (frz. 2016). [24] Andreas Feige, Bernhard Dressler et al. (Hg.), Religion bei ReligionslehrerInnen. Religionspädagogische Zielvorstellungen und religiöses Selbstverständnis in empirisch-soziologischen Zugängen. Berufsbiographische Fallanalysen und eine repräsentative Meinungserhebung unter evangelischen ReligionslehrerInnen in Niedersachsen, Münster u.a. 2000. Vgl. dazu Wolfgang Vögele (Hg.), Gelehrte und gelebte Religion. Religion bei Religionslehrerinnen und Religionslehrern – Befragungsergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung in der gesellschaftlichen Diskussion, Loccumer Protokolle 22/01, Rehburg-Loccum 2001. [25] Hans Joas, Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Freiburg 2012 und ders., Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg Basel Wien 2004. [26] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Kirche im Umbruch. Zwischen demografischem Wandel und nachlassender Kirchenverbundenheit, Hannover 2019, https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Kirche-im-Umbruch-2019.pdf. Vgl. dazu auch Jörg Herrmann, Die Zukunft der Religion, tà katoptrizómena, H. 121, August 2019, https://theomag.de/121/jh34.htm. [27] Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, Berlin 2017.Alle folgenden Seitenangaben im Text dieses und des nächsten Abschnitts beziehen sich auf dieses Buch. [28] Zum Begriff der Aufmerksamkeit Georg Franck, Ökonomie der Aufmerksamkeit, München 1998. [29] Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt, Ditzingen 2017. [30] Schon im Mittelalter setzten sich Theologen in einer via moderna und einer via antiqua auseinander. Französische Schriftsteller im späten 17. Jahrhundert setzten sich in der Querelle des Anciens et des Modernes mit der Bedeutung der Antike für die Literatur auseinander. [31] Wolfgang Vögele, Weltgestaltung und Gewissheit. Alltagsethik und theologische Anthropologie, Protestantische Impulse für Gesellschaft und Kirche 4, Münster 2007. [32] Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Frankfurt/M. 2008 (frz. 1998). [33] Wolfgang Vögele, Kirchen als freiwillige Assoziationen der Zivilgesellschaft. Theologische Überlegungen im Anschluss an Ronald Thiemanns Rezeption des Kommunitarismus, PTh 87, 1998, 175-183. [34] Zur Kirchenanalyse, Vögele, Kirchenkritik, a.a.O., Anm. 17. [35] S.o. Abschnitt 4. [36] Hanya Yanagihara, Ein wenig Leben, München 2017 (engl. 2015). Der Verweis auf diesen hochinteressanten, bewegenden Roman wäre eine eigene Analyse wert, die im Rahmen dieses Essays nicht geleistet werden kann. [37] Ehrenberg, a.a.O., Anm. 32. [38] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit. Aufgaben und Chancen, Leipzig 2020, https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/konfessionslosigkeit_2020.pdf. Alle Seitenangaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf diese Studie. [39] Vgl. dazu die erwähnte EKD-Studie aus Freiburg, a.a.O., Anm. 26. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/125/wv059.htm |
 Wer sich seiner selbst nicht mehr sicher ist, der sucht das vertrauliche Gespräch mit der Partnerin, der guten Freundin oder dem Kumpel. Das Gegenüber wird dem Gesprächssuchenden seine Einschätzung der Lage mitteilen und ihm helfen, sich durch eine Dosis Wertschätzung und Selbstbestätigung seiner selbst neu zu vergewissern. Auf dieser Grundlage werden beide die nächsten Schritte für die kommende Zeit behutsam andenken, planen und Szenarien ausprobieren. Solche Orientierungsgespräche finden im Privaten informell statt, aber man findet sie auch auf institutioneller, organisatorischer und sozialer Ebene. Der Sachbearbeiter wird jährlich zum Zielvereinbarungsgespräch bei der Abteilungsleiterin gebeten. Und nicht selten suchen auch Institutionen wie Parteien, Kirchen, Unternehmen Hilfe im weiten Feld der Beratungskultur, beim Coach, bei der Unternehmensberatung, bei einem wissenschaftlichen Institut. Institutionen wie die evangelischen und katholischen Kirchen haben einen Bedarf nach externer Selbstvergewisserung und dem Blick von außen entwickelt. Solche Beratungsprozesse sollen im günstigen Fall zu Reformen und neuer Selbstausrichtung führen. Die Praxis zeigt, dass solche Beratungen oft nicht zum erwünschten Ergebnis führen.
Wer sich seiner selbst nicht mehr sicher ist, der sucht das vertrauliche Gespräch mit der Partnerin, der guten Freundin oder dem Kumpel. Das Gegenüber wird dem Gesprächssuchenden seine Einschätzung der Lage mitteilen und ihm helfen, sich durch eine Dosis Wertschätzung und Selbstbestätigung seiner selbst neu zu vergewissern. Auf dieser Grundlage werden beide die nächsten Schritte für die kommende Zeit behutsam andenken, planen und Szenarien ausprobieren. Solche Orientierungsgespräche finden im Privaten informell statt, aber man findet sie auch auf institutioneller, organisatorischer und sozialer Ebene. Der Sachbearbeiter wird jährlich zum Zielvereinbarungsgespräch bei der Abteilungsleiterin gebeten. Und nicht selten suchen auch Institutionen wie Parteien, Kirchen, Unternehmen Hilfe im weiten Feld der Beratungskultur, beim Coach, bei der Unternehmensberatung, bei einem wissenschaftlichen Institut. Institutionen wie die evangelischen und katholischen Kirchen haben einen Bedarf nach externer Selbstvergewisserung und dem Blick von außen entwickelt. Solche Beratungsprozesse sollen im günstigen Fall zu Reformen und neuer Selbstausrichtung führen. Die Praxis zeigt, dass solche Beratungen oft nicht zum erwünschten Ergebnis führen. Die Soziologen ignorierten gelegentlich diese Gesprächsangebote aus dem theologischen Bereich, andere nahmen sie bereitwillig auf und wurden zu gerne gesehenen Gästen und Vortragenden bei Akademie-Tagungen, öffentlichen Kongressen und Expertenkonferenzen, auch wenn die Starsoziologen bei den entsprechenden Vorträgen stets vorsichtig ihre religiöse „Unmusikalität“ betonten. Soziologische Analyse und Orientierungsempfehlungen bildeten stets einen geschlossenen hermeneutischen Zirkel, der Einwände und vor allem Gegner auf vernünftig-argumentative Weise beiseiteschieben sollte. Gegenüber den Warnungen der Soziologie, dass die eigenen Thesen nicht notwendig die handlungstheoretische Beherrschbarkeit religiöser Krisen voraussetze, stellte man sich auf Seiten der Kirchen taub, denn „irgendwie“ musste die Kirche ja gesteuert werden, wenn schon nicht durch die theologische Kommunikation des Glaubens, so doch mindestens durch die nüchtern-rationalen Handlungsempfehlungen einer operativen Religionssoziologie. Man muss konstatieren: Auf der kirchlichen Seite überschätzte man die Fähigkeiten der Leitungsebene, den Ort der Kirchen in der Gesellschaft durch Reformen und Marketingprogramme neu zu bestimmen und zu verändern, auf der soziologischen Seite konnte man sich durch die Erwartung, religionskybernetische Heilsbringer zu sein, geschmeichelt fühlen, und man ersparte es sich großzügig, kirchliche Erwartungen zu enttäuschen – mit wenigen Ausnahmen. Kirchenleitungen und religionssoziologische wie demoskopische Institute gingen miteinander um wie vertraute Freundinnen. Irgendwann wurden Freundschaftsbeziehungen wichtiger als harte, unangenehme Wahrheiten.
Die Soziologen ignorierten gelegentlich diese Gesprächsangebote aus dem theologischen Bereich, andere nahmen sie bereitwillig auf und wurden zu gerne gesehenen Gästen und Vortragenden bei Akademie-Tagungen, öffentlichen Kongressen und Expertenkonferenzen, auch wenn die Starsoziologen bei den entsprechenden Vorträgen stets vorsichtig ihre religiöse „Unmusikalität“ betonten. Soziologische Analyse und Orientierungsempfehlungen bildeten stets einen geschlossenen hermeneutischen Zirkel, der Einwände und vor allem Gegner auf vernünftig-argumentative Weise beiseiteschieben sollte. Gegenüber den Warnungen der Soziologie, dass die eigenen Thesen nicht notwendig die handlungstheoretische Beherrschbarkeit religiöser Krisen voraussetze, stellte man sich auf Seiten der Kirchen taub, denn „irgendwie“ musste die Kirche ja gesteuert werden, wenn schon nicht durch die theologische Kommunikation des Glaubens, so doch mindestens durch die nüchtern-rationalen Handlungsempfehlungen einer operativen Religionssoziologie. Man muss konstatieren: Auf der kirchlichen Seite überschätzte man die Fähigkeiten der Leitungsebene, den Ort der Kirchen in der Gesellschaft durch Reformen und Marketingprogramme neu zu bestimmen und zu verändern, auf der soziologischen Seite konnte man sich durch die Erwartung, religionskybernetische Heilsbringer zu sein, geschmeichelt fühlen, und man ersparte es sich großzügig, kirchliche Erwartungen zu enttäuschen – mit wenigen Ausnahmen. Kirchenleitungen und religionssoziologische wie demoskopische Institute gingen miteinander um wie vertraute Freundinnen. Irgendwann wurden Freundschaftsbeziehungen wichtiger als harte, unangenehme Wahrheiten. Es ist die Aufgabe der Soziologie, soziale Veränderungsprozesse mit Blick auf die Gesamtgesellschaft zu deuten. Die Religionssoziologie bestimmt dabei den besonderen (sozialen) Ort von Religionen und Kirchen. Es ist unbestritten, dass letztere nicht nur der theologischen Selbstdeutung, sondern auch der Interpretation von außen bedürfen. Was die Gesellschaft angeht, so haben sich die Deutungen der Soziologie stets zu Schlagworten verdichtet, die sich seit der Nachkriegszeit in einem bestimmten Turnus von vier bis sechs Jahren ablösen. An ihrer Prägung waren keineswegs nur Soziologen beteiligt. Die Indexwörter zur Gesellschaftsdeutung unterliegen also gewissen Moden.
Es ist die Aufgabe der Soziologie, soziale Veränderungsprozesse mit Blick auf die Gesamtgesellschaft zu deuten. Die Religionssoziologie bestimmt dabei den besonderen (sozialen) Ort von Religionen und Kirchen. Es ist unbestritten, dass letztere nicht nur der theologischen Selbstdeutung, sondern auch der Interpretation von außen bedürfen. Was die Gesellschaft angeht, so haben sich die Deutungen der Soziologie stets zu Schlagworten verdichtet, die sich seit der Nachkriegszeit in einem bestimmten Turnus von vier bis sechs Jahren ablösen. An ihrer Prägung waren keineswegs nur Soziologen beteiligt. Die Indexwörter zur Gesellschaftsdeutung unterliegen also gewissen Moden. Die technischen Innovationen der modernen Gesellschaft nahm Ulrich Beck mit seiner These von der Risikogesellschaft
Die technischen Innovationen der modernen Gesellschaft nahm Ulrich Beck mit seiner These von der Risikogesellschaft Wer von Generationen spricht, der hat diesen historischen Kontext schon eingerechnet in die eigene Theorie, denn Generationen werden älter und verlieren an gesellschaftlichem Einfluss. So sitzt die skeptische Generation – mit Ausnahme von Jürgen Habermas - in ihrer Mehrheit schon im Altersheim und pflegt ihren Ruhestand. Die digital natives erinnern sich kaum noch an die Generation Golf. Schaut man sich all diese Stichworte an, so wird der Bezug zu den Kirchen oft nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber wenn die ganze Gesellschaft auf digitale Kommunikation umgestellt wird, so lässt das auch das Sprechen und Handeln der Kirchen nicht unberührt.
Wer von Generationen spricht, der hat diesen historischen Kontext schon eingerechnet in die eigene Theorie, denn Generationen werden älter und verlieren an gesellschaftlichem Einfluss. So sitzt die skeptische Generation – mit Ausnahme von Jürgen Habermas - in ihrer Mehrheit schon im Altersheim und pflegt ihren Ruhestand. Die digital natives erinnern sich kaum noch an die Generation Golf. Schaut man sich all diese Stichworte an, so wird der Bezug zu den Kirchen oft nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber wenn die ganze Gesellschaft auf digitale Kommunikation umgestellt wird, so lässt das auch das Sprechen und Handeln der Kirchen nicht unberührt. Dafür machte Berger fruchtbar, was er an den amerikanischen Verhältnissen über Religionsfreiheit, staatsunabhängige Kirchen und Liberalismus erfahren und studiert hatte. In seinem Buch „Der Zwang zur Häresie“
Dafür machte Berger fruchtbar, was er an den amerikanischen Verhältnissen über Religionsfreiheit, staatsunabhängige Kirchen und Liberalismus erfahren und studiert hatte. In seinem Buch „Der Zwang zur Häresie“ Alle Landeskirchen sind seit Jahrzehnten geprägt durch die Auseinandersetzung zwischen liberalen und evangelikalen Strömungen, manche stärker – wie Württemberg, Sachsen und Baden, andere schwächer. Liberal bedeutet im kirchlichen Fall: offen für die Öffnung der evangelischen Kirche in die pluralistische Gesellschaft, keine Einwände gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, keine Einwände gegen inklusive und leichte Sprache, Offenheit für ökumenische Annäherungen. Diese liberalen kirchlichen Strömungen sind an den entsprechenden politischen Strömungen orientiert, in der Regel eher die Grünen als die FDP, und so sehr auf Dialog fixiert, dass darüber Bekenntnis und Theologie gelegentlich sträflich vernachlässigt werden. Die evangelikalen Strömungen dagegen neigen zum Fundamentalismus, zu einem engen, autoritären Schriftverständnis mit kruder Hermeneutik, zu weiterhin substantiell, objektiv und metaphysisch für wahr gehaltenen Glaubensvorstellungen, die man der pluralistischen Diskussion enthoben sieht. Versuche, Dialoge und Debatten mit den innerkirchlichen Gegnern, mit katholischer Theologie, mit nicht-christlichen Positionen zu initiieren, werden als Verrat an der eigenen Glaubenssache interpretiert. Dieser Gegensatz zwischen Liberal und Evangelikal, der auch aktuell noch eine wichtige Rolle spielt
Alle Landeskirchen sind seit Jahrzehnten geprägt durch die Auseinandersetzung zwischen liberalen und evangelikalen Strömungen, manche stärker – wie Württemberg, Sachsen und Baden, andere schwächer. Liberal bedeutet im kirchlichen Fall: offen für die Öffnung der evangelischen Kirche in die pluralistische Gesellschaft, keine Einwände gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, keine Einwände gegen inklusive und leichte Sprache, Offenheit für ökumenische Annäherungen. Diese liberalen kirchlichen Strömungen sind an den entsprechenden politischen Strömungen orientiert, in der Regel eher die Grünen als die FDP, und so sehr auf Dialog fixiert, dass darüber Bekenntnis und Theologie gelegentlich sträflich vernachlässigt werden. Die evangelikalen Strömungen dagegen neigen zum Fundamentalismus, zu einem engen, autoritären Schriftverständnis mit kruder Hermeneutik, zu weiterhin substantiell, objektiv und metaphysisch für wahr gehaltenen Glaubensvorstellungen, die man der pluralistischen Diskussion enthoben sieht. Versuche, Dialoge und Debatten mit den innerkirchlichen Gegnern, mit katholischer Theologie, mit nicht-christlichen Positionen zu initiieren, werden als Verrat an der eigenen Glaubenssache interpretiert. Dieser Gegensatz zwischen Liberal und Evangelikal, der auch aktuell noch eine wichtige Rolle spielt Weitere Studien, die Tiefen-Interviews und demoskopische Methoden kombinierten, galten, ohne Rückgriff auf Milieu- und Habitustheorie, den Religionslehrern, die deshalb so interessant wurden, weil der Religionsunterricht als ein Feld entdeckt wurde, in dem religiöse Reflexion und Praxis sich verbanden, ohne dass es sich um kirchliches Verkündigung im engeren Sinne handelte. In den Studien, von denen die erste und bahnbrechende vom jüngst verstorbenen Andreas Feige und von Bernhard Dressler
Weitere Studien, die Tiefen-Interviews und demoskopische Methoden kombinierten, galten, ohne Rückgriff auf Milieu- und Habitustheorie, den Religionslehrern, die deshalb so interessant wurden, weil der Religionsunterricht als ein Feld entdeckt wurde, in dem religiöse Reflexion und Praxis sich verbanden, ohne dass es sich um kirchliches Verkündigung im engeren Sinne handelte. In den Studien, von denen die erste und bahnbrechende vom jüngst verstorbenen Andreas Feige und von Bernhard Dressler Wenn Religionen, religiöse Gruppen in modernen Gesellschaften sinnvoll erhalten bleiben sollen, dann steht eigentlich dem Wachstum oder wenigstens dem Erhalt der Kirchen auf gegenwärtigem Niveau nichts entgegen. Deswegen erregte innerkirchlich und öffentlich im Jahr 2019 eine Studie des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge großes Aufsehen, das in einer demographischen Erhebung einen kontinuierlichen Rückgang der Mitglieder beider Kirchen bis in die sechziger Jahre des 21. Jahrhunderts prognostizierte
Wenn Religionen, religiöse Gruppen in modernen Gesellschaften sinnvoll erhalten bleiben sollen, dann steht eigentlich dem Wachstum oder wenigstens dem Erhalt der Kirchen auf gegenwärtigem Niveau nichts entgegen. Deswegen erregte innerkirchlich und öffentlich im Jahr 2019 eine Studie des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge großes Aufsehen, das in einer demographischen Erhebung einen kontinuierlichen Rückgang der Mitglieder beider Kirchen bis in die sechziger Jahre des 21. Jahrhunderts prognostizierte Reckwitz‘ Thesen haben seit ihrem Erscheinen große Aufmerksamkeit erregt, bis in die Feuilletons der überregionalen Tageszeitungen und die verbliebenen Kultursendungen des Fernsehens hinein. Das mag damit zusammenhängen, dass sein großes Werk über Singularisierung
Reckwitz‘ Thesen haben seit ihrem Erscheinen große Aufmerksamkeit erregt, bis in die Feuilletons der überregionalen Tageszeitungen und die verbliebenen Kultursendungen des Fernsehens hinein. Das mag damit zusammenhängen, dass sein großes Werk über Singularisierung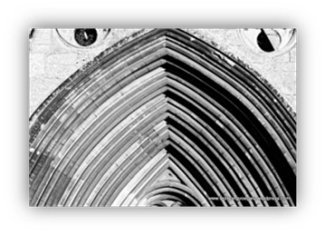 Die Welt ist immer noch Raum der Kooperation, des Konflikts, des Fortschritts, aber in der Spätmoderne wird sie auch immer mehr zu Bühne. Im Bühnenraum eines Gesellschaftstheaters teilen sich Personen in handelnde, sichtbare Darsteller und Zuschauer, die das Geschehen auf der Bühne beobachten. Jedes Individuum in der Gesellschaft ist zugleich Darsteller und Zuschauer. Die Menschen können zwischen diesen Rollen wechseln. Sie stellen sich dar, in der Öffentlichkeit, in sozialen Medien oder im privaten Bereich der Familie. Sie machen sich an den Versuch, im eigenen Leben Regie zu führen.
Die Welt ist immer noch Raum der Kooperation, des Konflikts, des Fortschritts, aber in der Spätmoderne wird sie auch immer mehr zu Bühne. Im Bühnenraum eines Gesellschaftstheaters teilen sich Personen in handelnde, sichtbare Darsteller und Zuschauer, die das Geschehen auf der Bühne beobachten. Jedes Individuum in der Gesellschaft ist zugleich Darsteller und Zuschauer. Die Menschen können zwischen diesen Rollen wechseln. Sie stellen sich dar, in der Öffentlichkeit, in sozialen Medien oder im privaten Bereich der Familie. Sie machen sich an den Versuch, im eigenen Leben Regie zu führen. Reckwitz will Singularisierung weder mystifizieren noch entlarven (12f.). In ihrer Allgemeinheit erscheint sie als Paradox: Die Menschen einer Gesellschaft wollen singulär sein. Aber wenn alle zum Besonderen streben, wird das Besondere wieder allgemein. Und diese Allgemeinheit des Besonderen charakterisiert die singularisierte, spätmoderne Gesellschaft. Damit verbindet sich ein Prozess der Affektaufladung. Die rationalisierte Industriegesellschaft war geknüpft an eine Affektreduktion, während die neue Singularisierung Affekte schafft, in dem sie Aufmerksamkeiten erzeugt, solche, die anziehen und solche, die abstoßen. Reckwitz spricht von einer „Affektgesellschaft“ (17). Nur was berührt und zu begeisterter Zustimmung oder vehementer Ablehnung führt, erscheint dem einzelnen als wichtig. „[D]ie Subjekte lechzen danach, affiziert zu werden und andere affizieren zu können, um selbst als attraktiv und authentisch zu gelten.“ (17) Solche Affizierung bestimmt Arbeit und Freizeit zu gleichen Teilen. Auf beides verwenden die singularisierten Individuen besondere Aufmerksamkeit, denn emotionale Energie ist ein knappes und flüchtiges Gut, ständig bedroht von Versiegen und Austrocknen, von Lethargie und Langeweile.
Reckwitz will Singularisierung weder mystifizieren noch entlarven (12f.). In ihrer Allgemeinheit erscheint sie als Paradox: Die Menschen einer Gesellschaft wollen singulär sein. Aber wenn alle zum Besonderen streben, wird das Besondere wieder allgemein. Und diese Allgemeinheit des Besonderen charakterisiert die singularisierte, spätmoderne Gesellschaft. Damit verbindet sich ein Prozess der Affektaufladung. Die rationalisierte Industriegesellschaft war geknüpft an eine Affektreduktion, während die neue Singularisierung Affekte schafft, in dem sie Aufmerksamkeiten erzeugt, solche, die anziehen und solche, die abstoßen. Reckwitz spricht von einer „Affektgesellschaft“ (17). Nur was berührt und zu begeisterter Zustimmung oder vehementer Ablehnung führt, erscheint dem einzelnen als wichtig. „[D]ie Subjekte lechzen danach, affiziert zu werden und andere affizieren zu können, um selbst als attraktiv und authentisch zu gelten.“ (17) Solche Affizierung bestimmt Arbeit und Freizeit zu gleichen Teilen. Auf beides verwenden die singularisierten Individuen besondere Aufmerksamkeit, denn emotionale Energie ist ein knappes und flüchtiges Gut, ständig bedroht von Versiegen und Austrocknen, von Lethargie und Langeweile. In der ‚klassischen‘, auf Allgemeinheit ausgerichteten Moderne sind Objekte in Massenproduktion verfertigt worden, die Subjekte hatten die Aufgabe, sich in den Rationalisierungsprozess einzupassen und Affekte zu kontrollieren bzw. zurückzustellen. Die Zeit war von der Stechuhr bestimmt, vom Gegensatz zwischen Arbeit, Familie und Freizeit. Wohnräume waren als gesichtslose, containerhafte Schlafstädte konstruiert. Die Moderne kämpfte gegen traditionelle Kollektive (Gilden, Zünfte, Clans), die sich dem Rationalisierungsprozess entgegenstellten. Der Mensch der klassischen Moderne war ein Wesen, „das eine extreme Sensibilität für die sozialen Rollenerwartungen seiner peers entwickelt, denen es mit hoher Anpassungsfähigkeit folgt.“ (44) Die moderne Gesellschaft erforderte Menschen, die funktionieren, darum unterdrückte sie alle Eigenschaften, die bei der Erfüllung der Kooperationsprozesse störten und vom erwartbar Normalen abwichen. Umgekehrt unterdrückten die einzelnen Individuen um der sozialen Akzeptanz willen alles, was aus ihnen selbst an Affekten kam und für Abweichung hätte sorgen können.
In der ‚klassischen‘, auf Allgemeinheit ausgerichteten Moderne sind Objekte in Massenproduktion verfertigt worden, die Subjekte hatten die Aufgabe, sich in den Rationalisierungsprozess einzupassen und Affekte zu kontrollieren bzw. zurückzustellen. Die Zeit war von der Stechuhr bestimmt, vom Gegensatz zwischen Arbeit, Familie und Freizeit. Wohnräume waren als gesichtslose, containerhafte Schlafstädte konstruiert. Die Moderne kämpfte gegen traditionelle Kollektive (Gilden, Zünfte, Clans), die sich dem Rationalisierungsprozess entgegenstellten. Der Mensch der klassischen Moderne war ein Wesen, „das eine extreme Sensibilität für die sozialen Rollenerwartungen seiner peers entwickelt, denen es mit hoher Anpassungsfähigkeit folgt.“ (44) Die moderne Gesellschaft erforderte Menschen, die funktionieren, darum unterdrückte sie alle Eigenschaften, die bei der Erfüllung der Kooperationsprozesse störten und vom erwartbar Normalen abwichen. Umgekehrt unterdrückten die einzelnen Individuen um der sozialen Akzeptanz willen alles, was aus ihnen selbst an Affekten kam und für Abweichung hätte sorgen können. Reckwitz unterscheidet vier Praktiken der Singularisierung, gleichsam vier Momente: Beobachten, Bewerten, Hervorbringen und Aneignen (64). Beobachten ist selbst-evident, es folgt der Frage: Was machen die anderen? Und wie kann sich der einzelne von den anderen unterscheiden? Bewerten bedeutet ein „evaluatives Einsortieren in Dualismen, Rangfolgen, Skalen“ (66). Im Prozess der Singularisierung wird das Besondere wertvoll, während die Bedeutung des Allgemeinen zurücktritt. Singularitäten werden produziert. Das muss aber keineswegs heißen, dass stets etwas Neues, Kreatives entsteht. Es kann auch bedeuten, vorhandene Elemente neu zu arrangieren. Das ist zum Beispiel beim Einrichten einer Wohnung der Fall oder beim Arrangieren einer Kunstausstellung. Kuratieren ist ein Schlüsselbegriff der Singularisierungstheorie. Zum Hervorbringen kommt das Erleben. Es bezeichnet einen „Prozess der Weltaneignung, in dem Gegenstände der Aufmerksamkeit sinnlich wahrgenommen werden“ (70). Dieses subjektive Erleben ist zugleich sozial konstruiert. Schließlich zielt das wahrgenommene, das erlebte und erarbeitete Singuläre auf Performanz. Das Singuläre wird dargestellt und auf einer (öffentlichen) Bühne aufgeführt. Entscheidend beim Prozess der Singularisierung sind die Affekte. Was nicht berührt, bewegt, das Herz zum Schwingen bringt, das erscheint als banal und langweilig: „Ohne Affizierung keine Singularitäten, ohne Singularitäten keine (oder nur eine schwache) Affizierung.“ (73)
Reckwitz unterscheidet vier Praktiken der Singularisierung, gleichsam vier Momente: Beobachten, Bewerten, Hervorbringen und Aneignen (64). Beobachten ist selbst-evident, es folgt der Frage: Was machen die anderen? Und wie kann sich der einzelne von den anderen unterscheiden? Bewerten bedeutet ein „evaluatives Einsortieren in Dualismen, Rangfolgen, Skalen“ (66). Im Prozess der Singularisierung wird das Besondere wertvoll, während die Bedeutung des Allgemeinen zurücktritt. Singularitäten werden produziert. Das muss aber keineswegs heißen, dass stets etwas Neues, Kreatives entsteht. Es kann auch bedeuten, vorhandene Elemente neu zu arrangieren. Das ist zum Beispiel beim Einrichten einer Wohnung der Fall oder beim Arrangieren einer Kunstausstellung. Kuratieren ist ein Schlüsselbegriff der Singularisierungstheorie. Zum Hervorbringen kommt das Erleben. Es bezeichnet einen „Prozess der Weltaneignung, in dem Gegenstände der Aufmerksamkeit sinnlich wahrgenommen werden“ (70). Dieses subjektive Erleben ist zugleich sozial konstruiert. Schließlich zielt das wahrgenommene, das erlebte und erarbeitete Singuläre auf Performanz. Das Singuläre wird dargestellt und auf einer (öffentlichen) Bühne aufgeführt. Entscheidend beim Prozess der Singularisierung sind die Affekte. Was nicht berührt, bewegt, das Herz zum Schwingen bringt, das erscheint als banal und langweilig: „Ohne Affizierung keine Singularitäten, ohne Singularitäten keine (oder nur eine schwache) Affizierung.“ (73) Rationalisierung und Singularisierung zielen zwar in verschiedene Richtungen, aber sie stehen nicht unbedingt gegeneinander. Früher unterschied man gerne die Sinn und Religion stiftende Kulturalisierung der Alten gegen die Rationalisierung der Moderne (und damit der Jugend, der neuen Generationen)
Rationalisierung und Singularisierung zielen zwar in verschiedene Richtungen, aber sie stehen nicht unbedingt gegeneinander. Früher unterschied man gerne die Sinn und Religion stiftende Kulturalisierung der Alten gegen die Rationalisierung der Moderne (und damit der Jugend, der neuen Generationen) Reckwitz zeigt den Singularisierungsprozess an verschiedenen Objekten. Dinge werden zu Unikaten, Kunstwerken, Luxusgütern. Dienstleistungen werden zu emotionaler Arbeit. Schauspieler, Schriftsteller und Musiker werden zu Stars, die viele Fans hinter sich vereinigen. Ereignisse werden zu Events. Aber Einzigartigkeit allein reicht nicht aus als Merkmal von Singularität, es braucht auch noch Originalität und vor allem Authentizität (137ff.). „Etwas gilt (nur dann) in der Welt, wenn es interessant und wertvoll ist, und das heißt: wenn es singulär ist, wenn es affektiv anspricht und authentisch scheint.“ (147) Die früheren Konsumenten werden nun zum Publikum, das entscheidet, bewertet und im Erfolgsfall applaudiert. Um das Authentische entsteht ein Wettbewerb, das Kulturelle wird ökonomisiert. Religionen und Konfessionen buhlen ebenfalls um die Aufmerksamkeit der eigenen Anhänger und der Eintrittswilligen – wenn es sie denn gibt. Kulturelle Wettbewerbe zeichnen sich dadurch aus, dass das Angebot bei weitem die Nachfrage übertrifft. Die Konkurrenz endet in der Regel so, dass nach dem Prinzip verfahren wird: The winner takes it all. Ladenhüter verstauben im Regal.
Reckwitz zeigt den Singularisierungsprozess an verschiedenen Objekten. Dinge werden zu Unikaten, Kunstwerken, Luxusgütern. Dienstleistungen werden zu emotionaler Arbeit. Schauspieler, Schriftsteller und Musiker werden zu Stars, die viele Fans hinter sich vereinigen. Ereignisse werden zu Events. Aber Einzigartigkeit allein reicht nicht aus als Merkmal von Singularität, es braucht auch noch Originalität und vor allem Authentizität (137ff.). „Etwas gilt (nur dann) in der Welt, wenn es interessant und wertvoll ist, und das heißt: wenn es singulär ist, wenn es affektiv anspricht und authentisch scheint.“ (147) Die früheren Konsumenten werden nun zum Publikum, das entscheidet, bewertet und im Erfolgsfall applaudiert. Um das Authentische entsteht ein Wettbewerb, das Kulturelle wird ökonomisiert. Religionen und Konfessionen buhlen ebenfalls um die Aufmerksamkeit der eigenen Anhänger und der Eintrittswilligen – wenn es sie denn gibt. Kulturelle Wettbewerbe zeichnen sich dadurch aus, dass das Angebot bei weitem die Nachfrage übertrifft. Die Konkurrenz endet in der Regel so, dass nach dem Prinzip verfahren wird: The winner takes it all. Ladenhüter verstauben im Regal. Oft schließen sich Menschen zu Teams zusammen, um in zeitlich begrenzten Projekten etwas Neues hervorzubringen (191f.) Nicht zufällig heißen solche Projektteams Ensembles, ein Begriff aus der - performativen - Theaterwelt (195). Projekte versteht Reckwitz als eine heterogene Kollaboration (107). Sie entstehen nicht mehr aus festen Institutionen heraus, sondern Projektgruppen bilden sich aus Netzwerken, lockeren Zusammenhängen, die sich punktuell und vorübergehend zu intensiver Kooperation zusammenschließen (199f.). Der volatile Charakter solcher Zusammenschlüsse zeigt sich schon bei der Ausbildung. Entscheidend ist nicht mehr das bestandene Examen, sondern training on the job, Erfahrung, Vielseitigkeit und Kreativität. Es geht um „Profilbildung und Potentialentfaltung“ (207). Auch hier spielt die Performanz eine entscheidende Rolle. Es kommt nur darauf an, wie die eigene Kreativität und Leistung bei den anderen wirken. „Alle performen vor- und miteinander.“ (209) Das, was „performed“ wird, muss gleichzeitig authentisch wirken. „Charme und Schlagfertigkeit, ansprechendes Äußeres, Zuhörenkönnen und Gastfreundschaft, gewinnende Art, Toleranz und Begeisterungsfähigkeit etc., etc. In der spätmodernen Arbeitswelt werden so Persönlichkeitsmerkmale und Charaktereigenschaften zu professionellen Assets.“ (210) Das lässt sich auch so ausdrücken: Aus der Kultur der „Leistung“ wird eine Kultur des „Erfolgs“, und Erfolg ist von performativen Bedingungen abhängig (211). Jobs werden nicht mehr nach Leistungen verteilt, sondern nach dem akquirierten kulturellen Kapital. Was zählt, sind Auslandsaufenthalte, soziales Engagement und popkulturelle Interessen, „jene raffinierte Mischung aus Selbstbewusstsein und Sichinfragestellen, aus Experimentierfreudigkeit und subtilem Profilierungsinteresse“ (214). Aber diese Performanzökonomie produziert auch höchstens Mittelmaß, wenn die Jury der Castingshow nur Mittelmaß erwartet, oder noch schlimmer: nur Mittelmaß zulässt.
Oft schließen sich Menschen zu Teams zusammen, um in zeitlich begrenzten Projekten etwas Neues hervorzubringen (191f.) Nicht zufällig heißen solche Projektteams Ensembles, ein Begriff aus der - performativen - Theaterwelt (195). Projekte versteht Reckwitz als eine heterogene Kollaboration (107). Sie entstehen nicht mehr aus festen Institutionen heraus, sondern Projektgruppen bilden sich aus Netzwerken, lockeren Zusammenhängen, die sich punktuell und vorübergehend zu intensiver Kooperation zusammenschließen (199f.). Der volatile Charakter solcher Zusammenschlüsse zeigt sich schon bei der Ausbildung. Entscheidend ist nicht mehr das bestandene Examen, sondern training on the job, Erfahrung, Vielseitigkeit und Kreativität. Es geht um „Profilbildung und Potentialentfaltung“ (207). Auch hier spielt die Performanz eine entscheidende Rolle. Es kommt nur darauf an, wie die eigene Kreativität und Leistung bei den anderen wirken. „Alle performen vor- und miteinander.“ (209) Das, was „performed“ wird, muss gleichzeitig authentisch wirken. „Charme und Schlagfertigkeit, ansprechendes Äußeres, Zuhörenkönnen und Gastfreundschaft, gewinnende Art, Toleranz und Begeisterungsfähigkeit etc., etc. In der spätmodernen Arbeitswelt werden so Persönlichkeitsmerkmale und Charaktereigenschaften zu professionellen Assets.“ (210) Das lässt sich auch so ausdrücken: Aus der Kultur der „Leistung“ wird eine Kultur des „Erfolgs“, und Erfolg ist von performativen Bedingungen abhängig (211). Jobs werden nicht mehr nach Leistungen verteilt, sondern nach dem akquirierten kulturellen Kapital. Was zählt, sind Auslandsaufenthalte, soziales Engagement und popkulturelle Interessen, „jene raffinierte Mischung aus Selbstbewusstsein und Sichinfragestellen, aus Experimentierfreudigkeit und subtilem Profilierungsinteresse“ (214). Aber diese Performanzökonomie produziert auch höchstens Mittelmaß, wenn die Jury der Castingshow nur Mittelmaß erwartet, oder noch schlimmer: nur Mittelmaß zulässt. Reckwitz wendet sich der Digitalisierung zu. Die alte Industriegesellschaft hat Produkte hergestellt. Die digitalisierte Technologiegesellschaft produziert Filme, Fotos, Texte, Präsentationen. Sie ist eine „Kulturmaschine“ (227). Digitalisierung richtet die Technik auf Kultur aus. Der alte, proletarische Arbeiter wird zum „(mobilen) Nutzer“ (229). Bilder, Texte, Filme waren in der alten Kultur unabhängig voneinander versäult; jetzt vermischen sie sich und gehen ineinander über. Das Internet ist deshalb so beliebt, weil es Affekten vor Informationen den Vorrang gibt, es ist eine „Affektmaschine“ (234). Das gilt besonders für die visuellen Bereiche. Fotos und Filme transportieren eher Ästhetik und Affekte als Information. Das gilt ebenso für die Musik und für die „gamification“ (236) der Welt.
Reckwitz wendet sich der Digitalisierung zu. Die alte Industriegesellschaft hat Produkte hergestellt. Die digitalisierte Technologiegesellschaft produziert Filme, Fotos, Texte, Präsentationen. Sie ist eine „Kulturmaschine“ (227). Digitalisierung richtet die Technik auf Kultur aus. Der alte, proletarische Arbeiter wird zum „(mobilen) Nutzer“ (229). Bilder, Texte, Filme waren in der alten Kultur unabhängig voneinander versäult; jetzt vermischen sie sich und gehen ineinander über. Das Internet ist deshalb so beliebt, weil es Affekten vor Informationen den Vorrang gibt, es ist eine „Affektmaschine“ (234). Das gilt besonders für die visuellen Bereiche. Fotos und Filme transportieren eher Ästhetik und Affekte als Information. Das gilt ebenso für die Musik und für die „gamification“ (236) der Welt.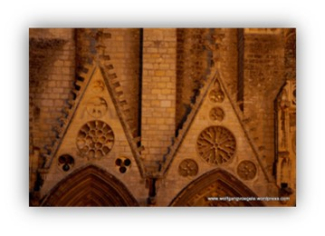 Singularisierung und Digitalisierung verschieben die Milieustruktur der Gesellschaft. Aus dem früheren Mittelstand bildet sich eine neue akademische Mittelklasse, die sich auf das Singularisierungsprojekt einlässt. Diese kann man als „Akademikerklasse“ (274) bezeichnen. Dem tritt eine Verliererklasse gegenüber, die sich durch Globalisierung, Digitalisierung, Singularisierung überfordert und bedroht fühlt. Für sie löst die Digitalisierung Ängste aus. Diese „neue Unterklasse“ (277) wählt häufig Rechtspopulisten, auch wenn das Reckwitz so ausdrücklich nicht sagt. Der Umgang mit Bildung und Kultur ist das Kriterium, um die neue Mittel- und die neue Unterklasse soziologisch zu differenzieren. Der neuen Mittelklasse geht es um Authentizität, Selbstverwirklichung, Kreativität. Dafür entwickelt sie einen eigenen Lebensstil. Das Bürgertum romantisiert sich zu einem individualisierten Geniekult, aber nicht mehr in der Einsamkeit von Atelier oder Schreibstube, sondern im Rahmen von sozial akzeptierter Selbstverwirklichung.
Singularisierung und Digitalisierung verschieben die Milieustruktur der Gesellschaft. Aus dem früheren Mittelstand bildet sich eine neue akademische Mittelklasse, die sich auf das Singularisierungsprojekt einlässt. Diese kann man als „Akademikerklasse“ (274) bezeichnen. Dem tritt eine Verliererklasse gegenüber, die sich durch Globalisierung, Digitalisierung, Singularisierung überfordert und bedroht fühlt. Für sie löst die Digitalisierung Ängste aus. Diese „neue Unterklasse“ (277) wählt häufig Rechtspopulisten, auch wenn das Reckwitz so ausdrücklich nicht sagt. Der Umgang mit Bildung und Kultur ist das Kriterium, um die neue Mittel- und die neue Unterklasse soziologisch zu differenzieren. Der neuen Mittelklasse geht es um Authentizität, Selbstverwirklichung, Kreativität. Dafür entwickelt sie einen eigenen Lebensstil. Das Bürgertum romantisiert sich zu einem individualisierten Geniekult, aber nicht mehr in der Einsamkeit von Atelier oder Schreibstube, sondern im Rahmen von sozial akzeptierter Selbstverwirklichung. Kuratieren ist für Reckwitz eine „Querschnittspraxis“, welche in der Spätmoderne den Konsum als bloßen Verbrauch von Gütern ablöst (297). Kuratieren macht das eigene Leben wertvoll, andererseits aber stellt es auch einen Zwang dar, den Zwang, unbedingt originell und authentisch zu sein (ebd.). Im Grunde vollzieht Reckwitz soziologisch nach, was Autoren wie Wilhelm Schmidt und andere mit der Philosophie der Lebenskunst, der Frage nach Selbstsorge, Routine und Gewohnheit und ihrer Aufhebung philosophisch schon vorweggenommen haben. Ich habe in meinem Buch über Alltagsethik versucht, dieser Diskussion eine theologische Wendung zu geben. Reckwitz geht soziologisch vor und holt diesen Diskurs aus seinen sicherlich vorhandenen normativen Überhöhungen zurück in die Empirie. Diese aber zeigt, dass die meisten Menschen in ihrer Alltagsethik ohne religiöse Dimension auskommen. Die Wertsetzungen des Kuratierens haben Religiöses und Theologisches eindeutig in die Schmuddelecke von Aberglaube, Sektierertum und Fundamentalismus abgedrängt. ‚Man‘ braucht das nicht mehr.
Kuratieren ist für Reckwitz eine „Querschnittspraxis“, welche in der Spätmoderne den Konsum als bloßen Verbrauch von Gütern ablöst (297). Kuratieren macht das eigene Leben wertvoll, andererseits aber stellt es auch einen Zwang dar, den Zwang, unbedingt originell und authentisch zu sein (ebd.). Im Grunde vollzieht Reckwitz soziologisch nach, was Autoren wie Wilhelm Schmidt und andere mit der Philosophie der Lebenskunst, der Frage nach Selbstsorge, Routine und Gewohnheit und ihrer Aufhebung philosophisch schon vorweggenommen haben. Ich habe in meinem Buch über Alltagsethik versucht, dieser Diskussion eine theologische Wendung zu geben. Reckwitz geht soziologisch vor und holt diesen Diskurs aus seinen sicherlich vorhandenen normativen Überhöhungen zurück in die Empirie. Diese aber zeigt, dass die meisten Menschen in ihrer Alltagsethik ohne religiöse Dimension auskommen. Die Wertsetzungen des Kuratierens haben Religiöses und Theologisches eindeutig in die Schmuddelecke von Aberglaube, Sektierertum und Fundamentalismus abgedrängt. ‚Man‘ braucht das nicht mehr.

