
Weltbegebenheiten |
Schach in GeleeBemerkungen zum Verhältnis von öffentlicher Theologie und politischer Ethik der Macht, dargestellt am Beispiel der Serie „House of Cards“ und der Tudor-Romane Hilary MantelsWolfgang Vögele V. Kontingenz und Macht („House of Cards”)
„
1. Die eingestürzte vierte Wand
In diesen, an die Zuschauer gerichteten Bemerkungen Franks spiegelt sich eine bestimmte politische Philosophie irgendwo zwischen Tocqueville, Nietzsche und Machiavelli[31], auf die ich noch komme. Gleichzeitig nutzt Frank diese Auszeiten von der Handlung, um die Zuschauer auf subtile Weise zu degradieren und zu beleidigen. Er macht sie zu Komplizen, zu abhängigen Schülern und zu Touristen bei einer Führung durch die inneren Zentren der Macht in den USA. So will sich Underwood bei den Zuschauern anbiedern und ihnen den vermeintlichen Blick durchs Schlüsselloch bieten. In seinen Aussagen spiegeln sich Herablassung und unausgesprochene Verachtung, aber genauso auch das Wissen um die Abhängigkeit von Wählern. Die Zuschauer werden ins Geschehen und in die moralischen Abgründe mit hineingezogen. Im Grunde will jeder gerne Frank Underwood oder eben der gegenwärtige blondierte Präsident sein: Macht ausüben, ohne sich um Moral, Anstand oder Vernunft kümmern zu müssen. Sehr lange bleibt es einzig Frank Underwood vorbehalten, durch diese vierte Wand zu den Zuschauern zu sprechen. Erst in V,10 spricht auch Claire Underwood die Zuschauer das erste Mal durch die ‚vierte Wand‘ an. Das soll sie als gleichberechtigte Partnerin ihres Mannes ausweisen, aber ihre philosophischen Reflexionen wirken dabei bei weitem nicht so glaubwürdig wie die ihres Ehemannes. Das Reden durch die vierte Wand, das Frank über fünf und Claire über zwei Staffeln praktiziert, stellt sich als genialer Kunstgriff dar. Dabei haben andere Schriftsteller längst vor ‚House of Cards‘ mit solchen Mitteln experimentiert, so in der Theorie der Entfremdung bei Bertolt Brecht, wo Schauspieler neben ihrer Rolle auf die Theatersituation von Darstellung, Bühne und Distanzierung reflektieren, oder bei André Gide, in dessen Romanen der Autor mit seinen Figuren in einen Dialog tritt. In ‚House of Cards‘ wird der Zuschauer zum Komplizen gemacht, er wird von oben herab mit Sentenzen belehrt, er wird gelegentlich auch beschimpft. Der Zuschauer soll nicht nachdenken, er soll staunen und bewundern, weil ihm – allein durch die Gnade des Mächtigen – ein Schlüssel in die Welt der politischen Entscheider eröffnet wird. Diese Vierte-Wand-Szenen sind sozusagen die Publikumsbeschimpfung, die Zuschauer auch noch genießen sollen. Ein Beispiel soll das illustrieren. In V, 12 sagt Frank direkt zu den Zuschauern: „Oh, don’t deny it. You don’t actually need me to stand for anything, you just need me to stand. To be the strong man, the man of action. My God, you are addicted to action and slogans. It doesn’t matter what I say. It doesn’t matter what I do. Just as long as I’m doing something, you’re happy to be along for the ride. And frankly, I don’t blame you. With all the foolishness and indecision in your lives, why not a man like me? I don’t apologize. In the end, I don’t care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The deck is stacked. The rules are rigged. Welcome to the death of the Age or Reason. There is no right or wrong. Not anymore. There’s only being in, and then being out.” Es ist wichtig, dass dieses Zitat nicht in den Erzählzusammenhang, sondern auf eine Meta-Ebene gehört, denn es interpretiert die Geschichte doppelt, aus der Sicht eines der ‚Beteiligten‘ und aus der vorgeblichen Sicht der Zuschauer. Frank Underwood erfreut sich daran, dass er in der Politik ausleben kann, was sich die Zuschauer aus Gründen der Vernunft, der hochgehaltenen Werte und der politischen Ethik nicht trauen. Es geht nicht mehr um vernünftige Entscheidungen, sondern nur noch um Partizipation am politischen Spiel, das sich am Erhalt der Macht orientiert. Das ist im Grunde ein Gegenprogramm zur öffentlichen Theologie. Es ist wegen solcher Zitate gesagt worden, Underwood bewege sich damit in der Nähe von Nietzsche oder Carl Schmitt. Das Zeitalter der Aufklärung erklärt Underwood für beendet, weil die Vernunft ihre eigenen Grenzen erreicht hat. Sie kapituliert vor Kontingenz und Schicksal. Sie reicht nicht so weit, dass ein Politiker auf sie sein Wahlprogramm oder ein Philosoph auf sie seine Theorien bauen kann. Mit dem Ende der moralischen Unterscheidung von Richtig oder Falsch käme dann auch das Ende der Ethik. Im leeren Raum, befreit von Philosophie und Theologie, Glauben, Ethik, Vernunft und Moral zählen nur noch Machterwerb und -erhalt. Aber es wird noch zu fragen sein, ob Underwood die Vernunft als solche für politikunfähig erklärt, oder ob er nur die begrenzte Reichweite der Vernunft eingesehen hat, welche die optimistischen Befürworter von Universalität und Aufklärung stets überspielt haben. Deutlich ist jedoch, dass solche, das story telling der Serie prägenden Elemente, zu ihrer politisch-philosophischen Botschaft beitragen. Für Frank und Claire wie für die Serienmacher ist Politik kein rationales Schachspiel, sondern eine Sache von Spannung und Narration. Dieser narrative und machtorientierte Politikbegriff hebelt einen rationalen Begriff von Politik aus, der am Verfolgen von Zielen und Werten orientiert ist. 2. Frank, der typische Politiker aus Washington
Es zeigt sich schnell: Underwood ist skrupellos und machtbesessen, er lügt, täuscht, manipuliert – und er begeht mindestens zwei Morde. Die Journalistin Zoe Barnes, mit der er eine Affäre hatte, stößt er vor eine einfahrende U-Bahn. Den Kongressabgeordneten Peter Russo vergiftet er in einer Garage mit Autoabgasen. Underwood erscheint als durchtriebener, machtbesessener Politiker, ebenso sehr Charakterschwein wie Krimineller, der sich allerdings jeder Strafverfolgung und journalistischer Recherche geschickt zu entziehen vermag.
Auf einer seiner Reisen als Präsident besucht Frank auch den Friedhof mit dem Grab seines Vaters. Frank geht zum Grab, Fotografen und Öffentlichkeit sind nicht zugelassen (III,1). Zuerst betet er allein am Grab, dann redet er die Zuschauer an und erklärt, er müsse als Präsident gegenüber seinen Wählern menschlich erscheinen. Nur Frank selbst, keine Angehörigen haben an der Beerdigung des Vaters teilgenommen. Am Ende seines Besuchs am Grab schaut er sich um, ob ihn jemand beobachtet, dann pinkelt er an den Grabstein. Damit ist das Verhältnis zu seinem Vater, aber nicht zu seiner Herkunft, eindeutig geklärt. Vergangenheit hat für Frank eine enorme Bedeutung. Er nimmt an einem Re-Enactment der Bürgerkriegsschlacht von Spotsylvania teil (II,5). Dabei wird ihm ein Schauspieler, Eric Rawlings vorgestellt, der Augustus Underwood spielt, einen von Franks Vorfahren. Frank ist sehr beeindruckt, und er lässt sich die Geschichte erzählen, wie dieser Urgroßvater in der Schlacht fiel. Dieser Vorfahr wird auch in Franks Alpträumen auftauchen. In der fünften Staffel stellt sich heraus, dass die Geschichte von Augustus‘ Grab ein fake war, eine alternative Wahrheit (V,5). Der Schauspieler gesteht ihm das, aber Frank ist deswegen nicht betroffen, weil die Geschichte eben gut erfunden war. Er stellt in der Folge den Schauspieler als Personal Trainer ein, der dann aber später, nach homosexuellen Avancen, entlassen wird. I Ein weiteres Symbol aus der Vergangenheit ist der Siegelring aus der Militärakademie, die Frank besucht hat. In der ersten Staffel trägt Frank diesen Ring ständig, und er pflegt damit bei Erfolgserlebnissen oder Verabschiedungen zweimal auf den Tisch zu klopfen. Dieses Tocken erwarten die Zuschauer irgendwann wie ein Leitmotiv. In II,5 steckt Underwood diesen Siegelring in Spotsylvania in die Erde, an der Stelle, wo sich das vermeintliche Grab seines Ahnen Augustus Underwood befindet. Den Ring lässt Underwood irgendwann ein zweites Mal anfertigen. Und in der letzten Staffel findet Claire diesen Ring im vormaligen Ehebett. Sie weiß wie die Zuschauer, dass sie und ihr verstorbener Ehemann schon sehr lange getrennte Zimmer hatten. Der Ring wurde ihr untergeschoben, stellt sich heraus. Trotzdem bleibt der Ring ein Zeichen für den nicht anwesenden Frank, der zu diesem Zeitpunkt längst tot ist. Siegelringe sind in den Vereinigten Staaten ein übliches Geschenk nach dem bestandenen College-Abschluss; genauso aber sind sie alte Zeichen der Macht, als man handgeschriebene Briefe neben der Unterschrift noch mit einem weiteren Zeichen der eigenen Identität versah.
3. Skrupelloser Pragmatismus
Frank Underwoods Pragmatismus ist nicht beizukommen. Zwar hält er diese Haltung vor der Öffentlichkeit verborgen, und er sorgt mit allen Mitteln dafür, dass Journalisten ihm nicht auf die Schliche kommen. Aber nach seiner Überzeugung ist sein skrupelloser Pragmatismus eine politische eine Einstellung, die auf vernünftiger Einsicht beruht und nicht nur von ihm selbst, sondern auch von den Zuschauern, die er durch die vierte Wand ins Vertrauen zieht, geteilt wird.
An Weil die Menschen böse sind, ist Frank ihnen gegenüber misstrauisch. Als Pragmatist interessiert sich Frank nicht besonders für politische Theorie, stattdessen will er mit den Menschen zusammenarbeiten, um politisch etwas zu erreichen. Er ist also zur Kooperation verdammt, und dennoch kann er gegenüber den meisten anderen Menschen sein Misstrauen nicht ablegen. Das gilt vor anderen für die Frau, die er liebt, nämlich Claire. So etwas wie Vertrauen entwickelt er nur gegenüber denjenigen, die keine Macht haben oder die ihm bedingungslos ergeben sind. Das gilt für den Rippchengriller Freddy Haines sowie den Sicherheitsmann Edward Meechum, der sich vor seinen Chef wirft, als ein Attentäter ihn erschießen will, sowie Underwoods Chief of Staff Doug Stamper, der für seinen Chef mordet und in seiner völlig unerklärlichen Nibelungentreue für alle Zuschauer Rätsel aufwirft.[34] Die Berufung auf die Blindheit rückt ein weiteres Element dieses Pragmatismus in den Vordergrund. Zwar kann man versuchen, Leben und Politik zu planen, aber die Vernunft reicht nicht besonders weit. Die Menschen tappen stets im Dunklen, was die Zukunft angeht. Es gehört zu den großen Einsichten Underwoods, dass er nicht den Versuch unternimmt, die Reichweite seiner Vernunft zu überschätzen oder gar zu erweitern. Stattdessen findet er sich mit ihrer Begrenztheit ab. Wenn man nicht mehr planen kann, muss man damit aufhören. In der fünften Staffel gerät Frank in so große Schwierigkeiten, dass er vom Präsidentenamt zurücktritt. Aber damit will er keineswegs die Politik aufgeben. Er zieht sich bewusst in den privaten Sektor zurück, weil er der Meinung ist, von dort aus, aus dem Verborgenen, könne er seine Frau, seine Nachfolgerin im Präsidentenamt, besser manipulieren. Die These von der begrenzten Vernunft weitet Frank Underwood aus zu einer Theorie der Kontingenz des Lebens, die er an einen Begriff anschließt, den er von Donald Duck übernimmt. In IV,4 sagt Underwood: „You see, my feeling is, I think the Founding Fathers, they just got tired. And really, can you blame them? I mean, you can't think of everything. Black swans, Murphy's Law. I mean, at a certain point, you just have to sign off and cross your goddamn fingers and hope for the best. Or adopt ‘flipism’, a pseudo-philosophy of life in which the most important decisions are made by the flipping of a coin. It was first introduced in the Disney comic book Flip Decision - one of my favorites - in which Donald Duck is persuaded by Professor Batty to make all the most important decisions based on the flipping of a coin. ‘Life is but a gamble. Let flipism guide your ramble.’" Bei schwierigen Entscheidungen, so Donald Duck, macht es wenig Sinn, lange abzuwägen. Es ist am Ende besser, eine Münze zu werfen. Die Münze erspart lange Grübeleien, und Frank handelt selbstverständlich lieber entschlossen und schnell anstatt lange abzuwägen und nachzudenken. Und er scheut sich nicht, bei seinem Handeln beträchtliche Risiken einzugehen. Das heißt nicht, dass er Verstand und Kalkül nicht gebrauchen würde. Er weiß um die Begrenztheit von Reflexion, die er darum niemals allzu sehr in die Länge zieht. Der skrupellose Pragmatist lebt misstrauisch in einer Welt böser Menschen (wie ein Lutheraner), und er ist zudem noch ein skeptischer Rationalist, der weiß, wie oft die Kontingenz über die menschliche Vernunft triumphiert. Der Umgang mit Kontingenz, eines der entscheidenden Probleme einer Ethik der Lebensführung, wird bei Underwood politisch gewendet. Er überrumpelt seine Gegner in einer Mischung aus Entschlossenheit und skeptischer Vernunft. Es ist interessant, diese Entscheidungstheorie von Underwood mit einer theologischen Entscheidungstheorie zu vergleichen, wieder dargestellt am Beispiel aus einem Film. In „Die zwei Päpste“ von Fernando Meirelles[35] wird die Begegnung zwischen den beiden Päpsten Ratzinger und Bergoglio in Castelgandolfo und in Rom gezeigt. Bei ihren Gesprächen geht es auch darum, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Beide bekräftigen, dass sie vor schwierigen Entscheidungen im Gebet stets um ein ‚Zeichen Gottes‘ bitten. Diese Zeichen sind keine ‚Wunder‘, sondern ganz harmlose Zufälle, die positive Stimmung oder ein solches Erleben auslösen. Ob solch ein Zeichen wirklich ein ‚Zeichen Gottes‘ ist, davon sind die Päpste überzeugt, der Film lässt das ausdrücklich offen. Aber der Unterschied zwischen der Herrschaft des Zufalls (Flipism) und der Bitte um Gebetszeichen scheint mir nicht allzu groß. Denn das Zeichengeben Gottes und die entsprechende Deutung der beiden Päpste bleibt ebenso kontingent wie die Nicht-Entscheidung Underwoods. Sein ‚ruthless pragmatism‘ setzt sich aber nicht nur vom Christentum ab, sondern auch von plutokratischer Esoterik. In der fünften Staffel (V,8) nimmt Frank an einem merkwürdigen Camp teil, das eine freimaurerartige Geheimgesellschaft reicher Männer abhält. Irgendwo in einem Wald, abgelegen von aller Zivilisation, treffen sich die Superreichen der Vereinigten Staaten zu machistischen und esoterischen Mysterienspielen unter Verwendung einer großen Dosis Pfadfinderromantik. Frank ist von diesem esoterischen Zirkus angewidert und stellt diesem seinen eigenen Pragmatismus gegenüber: „I like dirt, rocks, and facts.“ (V,8) Will sagen: Ich als Präsident bin down to earth, kein Spinner, kein Visionär, kein Zukunftsforscher. Ich bin auch, das gehört zur indirekten Botschaft, kein Angehöriger der Plutokratie. Er weiß, dass ihn die meisten, die ihm bei dieser Debatte zuhören, am liebsten zu ihrem abhängigen Werkzeug machen und als Marionette steuern würden. Aber Frank verfolgt seine eigenen Interessen. Er beobachtet genau und denkt so klar wie möglich nach. Dann erst fängt er an zu handeln. Und dieser letzte Schritt ist ihm der wichtigste. Hat er damit Erfolg? Ja und nein. Er hat Erfolg, weil er es schafft, das amerikanische Präsidentenamt zu erobern. Aber danach werden die Konflikte immer komplizierter. Franks Paranoia nimmt Ausmaße an, die ihm jedes Vertrauen in Mitarbeiter, andere Politiker etc. berauben. Er spürt, dass selbst seine Frau Claire zu seiner unausgesprochenen Rivalin wird. Irgendwann schlägt das Misstrauen über ihm zusammen. Was Underwood entwickelt, ist das Gegenteil einer werte- und prinzipiengeleiteten ethischen Entscheidungstheorie des Politischen. Er ordnet nicht mehr Mittel und Zweck einander zu, verfolgt keine wertgeprägten Ziele mehr. Was ihn ausmacht, sind Schnelligkeit und vor allem Entschlossenheit. Underwood lebt in einer bösen Welt. Die Menschen sind schlecht. Die Vernunft reicht nur ein kurzes Stück weit. Die Verhältnisse sind so kompliziert, dass die Vernunft sie nicht bewältigen kann. Deswegen zieht Frank Underwood für seine politische Ethik den Schluss, dass nur Entschlossenheit um der eigenen Macht willen hilft. Alles andere, Aufklärung, Universalismus, die Werte amerikanischen Demokratie und der founding fathers, verwirft er. Auf dieses Verhältnis von Vernunft, Kontingenz und Anthropologie kommt es mir in diesem Essay vor allem an. Es macht den politisch-ethischen Reiz der Serie aus, trotz aller verwerflichen Taten, die sich Frank Underwood leistet. Es macht die Serie deshalb so faszinierend, weil sie bis in die banalsten Einzelheiten des politischen Alltags und des Privatlebens der Underwoods zeigt, wie sich die Grundprinzipien dieser politischen Ethik auswirken. Bill Shepard, der korrupte Milliardär und Lobbyist seiner eigenen Interessen, tritt erst in der sechsten Staffel auf, als Frank Underwood schon nicht mehr lebt. In seinem vergeblichen Kampf darum, die Präsidentin Underwood zu seinem willfährigen Instrument zu machen, zitiert er in VI,5 Thomas Hobbes: „Hell is truth seen too late.“ Wer in der Politik zu spät versteht und einsieht, kann seine Erkenntnisse nicht mehr für sein Handeln fruchtbar machen. Er wird über der eigenen Erkenntnis der Wahrheit verbittern, weil er sich diese nicht zum rechten Zeitpunkt erarbeiten konnte. Und genau das ist für jemanden, der handeln will, die Hölle – nämlich eine verpasste Gelegenheit. Dieses Zitat, obwohl es eine andere Person erst sagt, als Frank schon nicht mehr lebt, passt sehr genau zu dem, was Frank zu Lebzeiten als politische Ethik gedacht hat. Es wäre nicht völlig gerecht, die Reflexion über politische Ethik allein auf Frank Underwood zu konzentrieren. Denn er ist nicht die einzige Hauptperson. Durch die Staffeln hindurch verschiebt sich der Fokus von Frank, der allein im Mittelpunkt steht, über eine politische Rivalität zwischen Frank und Claire bis zur Fokussierung auf Claire, die Präsidentin in der letzten und sechsten Staffel. In dieser letzten Staffel führt sie den skrupellosen Pragmatismus ihres Mannes weiter. In VI,6 sagt sie die entscheidenden Worte ihrer politischen Theorie, die perfekt an diejenige von Frank anschließen: „It’s important to be organized and ruthless.“ (VI,6) Vernunft und Niedertracht, Berechnung und Bosheit kommen bei Claire feministisch zusammen. Das Adjektiv „ruthless“ kannten die Zuschauer ja schon von Frank Underwoods „ruthless pragmatism“. Es ist schade, die Präsidentin Claire ihre Reflexionen über ihren feministischen Pragmatismus nicht fortführt. Die sechste Staffel ist überhaupt problematisch, weil sie durch die nicht völlig glaubwürdige Schwangerschaft Claires und durch weitere Aktionen das politische Handeln der Präsidentin symbolisch so überfrachtet[36], dass es für den Zuschauer unglaubwürdig wirkt. 4. Claire, die typische Politikerin aus WashingtonFrank Underwood ist mit Claire verheiratet, die aus einem sehr reichen texanischen Elternhaus kommt, eine ehrgeizige Frau, die am Anfang (I,1ff.) eher wie ein Heimchen wirkt, das nebenbei eine NGO leitet und seine Affären auslebt. In der Folge erst entdeckt sie nach und nach ihre politische Ader, bis sie schließlich zur ebenbürtigen Konkurrentin ihres Mannes wird. Sie ist schlank, zierlich und schön, und sie hat sich meistens in der Gewalt. Je mehr politischen Ehrgeiz sie entwickelt, desto mehr zeigt sich, dass sie dafür auch Grenzen überschreiten würde. Das sich entwickelnde Konkurrenzverhältnis zu ihrem Ehemann bringt sie so weit, dass sie für die Politik, d.h. für die Macht auch ihre Ehe opfern würde. Umgekehrt hält sie an ihrer oft kaputten, von Krisen gebeutelten Ehe solange fest, wie sie ihr politisch nützlich bleibt. Sie nimmt sich Beraterinnen, und sie nimmt sich Liebhaber.
Zu Claires Überraschung schließt der intellektuelle Tom Yates, ihr Berater, Redenschreiber und späterer Liebhaber, sofort Freundschaft mit der Mutter. Er unterstützt Claire dabei, der sterbenden und von Schmerzen gequälten Frau zu einem assistierten Suizid zu verhelfen, um sie von ihrem Leiden zu erlösen. Tom Yates hat sich zu diesem Zeitpunkt zu Claires engem Vertrauten, zum Berater, Psychologen und Gesprächspartner entwickelt. Mit dem assistierten Suizid, der vor der Öffentlichkeit verborgen werden muss, wird Yates auch zum Mitwisser, der dem Ehepaar gefährlich werden kann.[38] Erst in der letzten Staffel, nachdem Claire selbst Präsidentin geworden ist, thematisiert die Serie in mehreren Szenen ihre Kindheit über die Rolle der Mutter hinaus. In mehreren Rückblenden wird erzählt, wie sie als kleines Mädchen einem Jungen, der ihr weißes Mädchenkleid angehoben hat, bei einer weiteren seiner voyeuristischen Unternehmungen einen Besenstiel durch ein kleines Loch im Scheunentor ins Auge rammt. Claire soll als skrupellos, hart und als eiskalte Rächerin dargestellt werden. Diese Racheaktion erscheint auch als der Beginn der späteren Konflikte mit ihrer Mutter, die dann zu dem beschriebenen zerrütteten Verhältnis führen. Die Ehe zwischen Claire und Frank bleibt kinderlos. Claire war mindestens zweimal schwanger und hat beide Male abgetrieben. Einmal beruhte die Schwangerschaft auf einer Vergewaltigung durch einen Studenten der Militärakademie, an der auch Frank studiert hat. Frank und sie müssen einen erheblichen Aufwand treiben, um zu verhindern, dass über die Abtreibungen etwas bekannt wird. Als es nicht mehr anders möglich ist, bekennt sich Claire in Staffel II in einem Fernsehinterview zu Vergewaltigung und Abtreibung. Am Anfang ihrer politischen Karriere muss Claire zweifelhafte, ambivalente Erfahrungen machen. Sie ist noch UN-Botschafterin, als sie in Moskau über die Freilassung eines nach einer Demonstration inhaftierten schwulen Aktivisten, eines US-Bürgers verhandelt. Sie spricht mit ihm unter vier Augen in der Gefängniszelle. Der Aktivist will die Bedingungen für die Freilassung nicht akzeptieren, nämlich ein positives Statement über seine Behandlung im Gefängnis und über den Präsidenten Petrov. Das Gespräch stockt. Der Aktivist will nachdenken, Claire, überarbeitet und müde, legt sich zum Ausruhen in der Zelle auf eine Pritsche. Als sie nach zwanzig Minuten aufwacht, hat sich der amerikanische Gefangene mit Hilfe von Claires Schal erhängt (III,6). Das ist eine der Szenen, die Claire prägen, aber trotzdem übertrieben und unglaubwürdig wirken. Im Grunde ist Claire in der Serie diejenige Person, die eine viel größere Entwicklung als Frank durchmacht. Diese Entwicklung zeigt sich als eine Strecke von der Frau als Anhängsel eines bekannten Politikers, die sich höchstens ehrenamtlich engagiert und ansonsten ihre Affären pflegt, zur politischen Unterstützerin ihres Mannes und von dort zur Übernahme eigener politischer Ämter, zuerst der amerikanischen UN-Botschafterin, dann der Vizepräsidentin und schließlich in der letzten Staffel, der alleinigen Präsidentin, welche – und das ist in diesem Fall sehr wichtig – die Ratschläge ihres Mannes nicht mehr anhören muss, weil er nicht mehr lebt. Das mag einem Zuschauer merkwürdig erscheinen, aber es ist deshalb wichtig, weil noch der tote Frank in der letzten Staffel Claires politisches Leben und Handeln bestimmt. Claires politische und psychologische Siege über den toten Frank haben also einen ausgesprochen ambivalenten Charakter. Nachdem sich Claire und Frank in den Staffeln davor öfter darüber unterhalten haben, dass sie keine Kinder bekommen wollen, um sich ganz auf die Politik konzentrieren zu können, überrascht es umso mehr, dass Claire als weit über vierzigjährige Frau dann doch plötzlich schwanger ist. Claire nutzt diese Schwangerschaft für ihre politischen Pläne aus. Am Anfang von VI,7 zeigt sie sich mit ostentativ schwangerem Bauch in der Öffentlichkeit und hält als Präsidentin eine Rede bei einer Frauenkonferenz. Dabei sagt sie: „My purpose is to elevate America, fight for America, and if it ever came to it, die for America. I will be father, mother, leader and friend.” Der erste Satz dieses Zitats gehört in die übliche Rhetorik des amerikanischen Patriotismus, der zweite Satz formuliert Claires Ansprüche auf das, was man einen maternalistischen Messianismus nennen könnte. Wenn irgendetwas, so stehen diese Worte für den Anspruch, das überkommene Patriarchat der weißen, alten Männer abzulösen. Was sie hier artikuliert, ist kein „ruthless pragmatism“ mehr, wie sie ihn von ihrem Mann in jahrzehntelanger Ehe und politischer Kooperation gelernt hat. Mit dieser Rede macht sie sich eindeutig zur messianischen, das Wählervolk behütenden Mutterfigur. Sie zeigt ihre blonden Haare, ihr strahlendes Lächeln, ihren schwangeren Bauch. Sie ist Erlöserfigur, im Grunde pansexuell, Vater und Mutter zugleich – und was sie nicht sagt -, auch Tochter und Sohn. Den feministischen Anteil an diesem Messianismus treibt Claire noch weiter, indem sie in der sechsten Staffel mit einigen ebenso kitschigen wie unglaubwürdigen Wendungen aufwartet. So präsentiert sie in VI,5 ein Kabinett, das nur aus Frauen besteht, nachdem sie die alten Mitglieder des Gremiums alle entlassen hat. Denn diese hatten den vergeblichen Versuch unternommen, sie für psychisch krank zu erklären und damit als Präsidentin absetzen zu lassen. Die ersten fünf auf der einen und die sechste Staffel auf der anderen Seite fallen hier deutlich auseinander. In den ersten fünf Staffeln dominiert der Aspekt der Rivalität zwischen Claire und ihrem Ehemann, in der – aus Gründen von Kevin Spaceys #metoo-Skandal verkürzten – letzten Staffel treibt Claire unbehindert von ihrem toten Ehemann den Eigenkult um ihre Person auf Höhen, der den von ihrem Ehemann propagierten skrupellosen Pragmatismus zu überbieten sucht, das Politische ins Religiöse überhöht – und darum scheitern muss. Genauso überschreitet er in dieser Überhöhung auf eine, die eigene Person den auf Egalität ausgerichteten klassischen Feminismus. Je weiter die Schwangerschaft Claires voranschreitet, desto schöner und unnahbarer wird die Präsidentin. Die Kehrseite der Medaille besteht darin, dass sie eine ausgeprägte Paranoia entwickelt: Sie traut niemandem mehr, auch nicht ihren Mitarbeiterinnen. Sie fühlt sich verfolgt, und sie hat ihre engsten Zuarbeiter im Weißen Haus unter Verdacht, Informationen über sie weiterzugeben. Es kommt zu mehreren Morden, darunter an dem Journalisten Tom Hammerschmidt und an der Ministerin und Beraterin Jane Davis. Plötzlich taucht nun auch der Siegelring[39] aus den ersten Staffeln wieder auf und trägt zu Claires Verfolgungswahn bei. In VI,1 liegt er plötzlich auf Claires Doppelbett, obwohl Frank nicht mehr am Leben ist und ihn dort nicht platzieren kann. Es stellt sich heraus, dass Claires Verfolgungswahn in diesem Fall berechtigt war. Die reiche Unternehmerfamilie Shepard hat dafür gesorgt, dass der Ring aus Franks Haus in seinem Heimatort Gaffney, South Carolina gestohlen wurde. Die Vorstellung der Shepards war, dass sie Claire aus der Ferne für ihre eigenen Zwecke politisch fernsteuern. Als Claire sich weigerte und Widerstand leistete, setzte die Familie alles daran, Claire aus dem Weißen Haus zu vertrieben. Franks Siegelring erwies sich dabei als Mittel zum Zweck. In der sechsten Staffel mit dem übersteigerten feministischen Messianismus Claires sind eine Reihe von Fragen angelegt, die aber nicht mehr erzählt werden, weil Netflix schon vor der Ausstrahlung der sechsten Staffel angekündigt hatte, die Serie damit zu beenden. Dreht man die Perspektive um und betrachtet das Ende der Serie von seiner Vorgeschichte her, so erscheint es als der Schlusspunkt der dauerhaften Beziehung zwischen Frank und Claire, die durch alle sechs Staffeln hindurchreicht. Diese Beziehung hat psychologische und politische Aspekte, die in ihrer Fülle hier gar nicht ausgeleuchtet werden können. Wiederum erscheint es als virtuos, wie die Drehbuchautoren Psychologie und Politik miteinander vermischen. In V,13 fällt der entscheidende Satz, der feststellt, dass sich Claire und Frank auf Augenhöhe befinde. Claire sagt zu Frank: „We’re the same now, you and I.“ Damit ist der politische Vorsprung, den Frank stets besaß, aufgeholt. Beide nehmen dasselbe Amt ein, das des Präsidenten der Vereinigten Staaten. In ihrer Ehe hat sich Claire stets zurückgesetzt gefühlt. Frank erwartete stets, dass sie ihr eigenes ehrenamtliches und politisches Engagement ausschließlich an seinen Interessen ausrichtete. Und Claire entsprach lange Zeit dieser Erwartung, weil sie wusste, dass Franks politische Erfolge auch ihre eigenen politischen Handlungsmöglichkeiten vergrößerten. Aber psychologisch war sie von dieser – pragmatischen – Wahrheit stets gekränkt. Die sechste Staffel zeigt die Folgen dieser Kränkung: Mit dem Ende der fünften Staffel ist die Gleichstellung erreicht, danach nutzt sie die verbleibende Zeit, als Frank plötzlich gestorben ist, zur Etablierung ihres politischen Weiblichkeitsideals. Und nun, da sie Frank nicht mehr benötigt, geht Claire so weit, dass sie Franks Ansehen schaden will, um ihr eigenes politisches Handeln zu sichern und zu legitimieren. Dabei allerdings schreckt sie vor juristischem Unsinn nicht zurück: Sie denkt über eine posthume Anklage gegen Frank nach („posthumous indictment“ VI,8). Worin aber sollte die Strafe für einen Toten bestehen? 5. Vom Kruzifix zum Mandala
Nach der Beerdigung eines im Nahen Osten getöteten Soldaten spricht Frank abends in einer Kirche mit dem Pfarrer, der die Beerdigung gehalten hat. Er bittet ihn danach, für einen Moment allein sein zu können. Der Pfarrer verlässt die Kirche, Frank tritt vor den Altar und blickt auf das Kreuz und den Gekreuzigten. Dann spricht er allerdings kein Gebet: „Love. That's what you're selling. Well, I don't buy it.” (III,4) Im nächsten Moment spuckt er auf den Gekreuzigten. Nach einer Sekunde Stille kracht das Kreuz in aller Filmtheatralik zu Boden. Das Obszöne und Blasphemische der Friedhofsszene wiederholt sich hier. Es ist allerdings zu bezweifeln, ob das heruntergestürzte Kreuz als ein Zeichen Gottes zu verstehen ist. Eher steht es für die Doppelbödigkeit allen Geschehens, öffentlich wie privat. Die Beerdigung des gefallenen Soldaten war ein konventionelles Moment amerikanischer Zivilreligion. Er wurde in den Ansprachen der Trauerfeier für das Opfer gepriesen, das er dem Vaterland gebracht hatte. Die Zuschauer aber wissen wie Frank selbst auch, dass der Soldat das unschuldige Opfer von politischen Intrigen und militärischen Machenschaften war, die vor allen anderen der Präsident Underwood zu verantworten hatte.
Nimmt man die religiösen Aussagen der Serie ernst, dann kann eine christliche Theologie, welcher konfessionellen Orientierung auch immer, diese politische Ethik nicht mehr als Komplement begleiten. Erstaunlicherweise finden sich in der dritten Staffel eine Reihe von allerdings für sich selbst stehenden Hinweise auf eine andere religiöse Tradition. Mehrfach werden buddhistische, vermutlich tibetische Mönche gezeigt. Sie sind damit beschäftigt, in einer Treppenhalle des Weißen Hauses ein Mandala aus Sand und anderen Stoffen zu erstellen. 6. Getrennte SchlafzimmerBeide Underwoods haben ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Sexualität und Erotik, deren Beschreibung gleich mit der ersten Staffel einsetzt und dann in der letzten Staffel mit der Apotheose der schwangeren Claire als mater dolorosa endet. Harmlos bleibt zunächst, dass das Ehepaar in getrennten Schlafzimmern nächtigt. Beide lassen sich gleich in der ersten Staffel auf außereheliche Affären ein, Frank auf die junge Journalistin Zoe Barnes, Claire auf den Fotografen Adam Galloway. Zoe Barnes wird, wie erwähnt, von Frank ermordet, und Claire trennt sich am Ende der ersten Staffel von dem New Yorker Fotografen. In den späteren Staffeln werden bei Frank keine weiteren Affären bekannt, während Claire die Beziehung zu ihrem Redenschreiber und Berater Tom Yates[40] immer mehr vertieft, bis dieser schließlich regelmäßig im Weißen Haus, in Claires Schlafzimmer übernachtet und am Morgen danach mit ihr und Frank zusammen in der Küche frühstückt. In der ersten Staffel findet sich in drei Episoden (I,1.2.6) eine sehr merkwürdige Referenz auf Franks ersten Personenschützer Steve Jones. Er ist in der einleitenden Szene dabei, als der von Frank getötete Hund bei einem Unfall verletzt wird. Wenig später stellt sich heraus, dass Steve unter Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet. In einem Krankenhaus liegt er im Sterben, und dort besucht ihn Claire zweimal, um ihn zu trösten und ihm Blumensträuße zu überreichen. Bei ihrem zweiten Besuch macht der sterbende Personenschützer Claire ein doppeltes Geständnis. Er habe ihren Mann Frank stets gehasst und sei die ganze Zeit in sie, Claire verliebt gewesen. Er habe sich nach ihr immer sehr gesehnt. Claire reagiert darauf sehr merkwürdig. Zuerst blickt sie ihn eiskalt an. Dann greift sie unter die Bettdecke und stimuliert ihn. Ist es das, was du dir gewünscht hast, fragt sie ihn. Der Sterbende wirkt ganz entsetzt und bittet sie, damit aufzuhören. Claire spricht dann darüber, wie sie ihren Mann kennengelernt hat: „You know what Francis said to me when he proposed? I remember his exact words. He said, ‚Claire, if all you want is happiness, say no. I’m not gonna give you a couple of kids and count the days until retirement. I promise you freedom from that. I promise you’ll never be bored.‘ You know, he was the only man – and there were a lot of others who proposed – but he was the only one who understood me. He didn’t put me on some pedestal. He knew that didn’t want to be adored or coddled. So he took my hand und put a ring on it. Because he knew I’d say yes.“ (I,6) Claire sagt das in dem Wissen, dass sie und der Mann zu dieser Zeit beide eine Affäre haben. In der Szene wird klar: Trotz dieses verstörenden „Übergriffs“ auf den sterbenden Sicherheitsmann geht es Claire zu keiner Zeit um Zuneigung oder Erotik. Ich bin überzeugt, sie ärgert sich am meisten selbst darüber, dass der langjährig treue Fahrer ihren Mann hasst. Diese Szene macht deutlich, dass in der Ehe von Claire und Francis Politik und Macht über Liebe und Erotik triumphieren. Mit dem Mord an seiner Geliebten Zoe Barnes ist für Frank Underwood das Affärenthema eigentlich beendet. Trotzdem finden sich durch die Staffeln hindurch an mehreren Stellen Hinweise auf eine homosexuelle Orientierung Frank Underwoods. In der Öffentlichkeit ist das mehrfach mit der Homosexualität des Frank-Darstellers Kevin Spacey und den #metoo-Vorwürfen in Zusammenhang gebracht worden. Diese homosexuellen Moment lebt Frank mit mehreren anderen Personen aus: Für ihn ist Sexualität untrennbar mit Macht verschwistert, es gibt die angedeuteten sadomasochistischen Szenen mit Claire (III,13), aber das ist für ihn nicht so wichtig wie der Erhalt der Macht. Gerade nach den Me-Too-Beschuldigungen gegen den Hauptdarsteller Kevin Spacey ist die Frage nach Underwoods sexueller Orientierung von Bedeutung. An mehreren Stellen scheinen in der Serie homosexuelle Momente auf: mit dem Security Mann Meechum, in einer traumhaften Sequenz zu dritt mit Claire (II,11), mit dem erwähnten Schauspieler/Personal Trainer, dessen Kuss versuch der Präsident allerdings sofort zurückweist (V,6). Underwood trifft sich auch mit seinem alten Schulfreund Tim Corbet aus der Militärakademie Sentinel. Bei einem Alumni-Treffen (I,8) versichern sich beide ihrer alten, zu Studentenzeiten begründeten Freundschaft und implizieren, dass diese damals auch durchaus hätte ‚weiter‘ gehen können. Aber die Erzählung geht hier über Andeutungen nicht hinaus. Tim Corbet taucht in der Folge noch zweimal auf: Er berichtet von den Nachforschungen, die Tom Yates bei ihm angestellt hat (III,10), und Frank erfährt in V,2 von seinem Verschwinden während eines Rafting Ausfluges, was auch ein kaschierter Selbstmord gewesen sein könnte. Die Andeutungen auf die Bisexualität von Frank verstärken den ambivalenten Charakter, den er bei den Zuschauern wecken soll. Ansonsten sind Erotik und Sexualität kein eigenständiges Thema in der Serie, alles, auch der privateste Lebensbereich ist durchsetzt von Macht, Politik und einem Element von Gewalt. Das ist der wichtigere Aspekt: Machterhalt und Politik wird alles andere untergeordnet.[41] 7. Wahlkampf und heimliche ZigarettenDer Gegensatz zwischen Öffentlichkeit und Privatheit durchzieht alle sechs Staffeln von ‚House of Cards‘. Claire und Frank haben vollständig verinnerlicht, was sie nach außen – vor ihren potentiellen Wählern – zeigen dürfen: Wahlkampf, repräsentative Termine, Showveranstaltungen - und was sie besser im Privaten belassen: Affären, Straftaten, Erpressung, die wahren Absichten, die sie politisch verfolgen. Für beide sind die bereits erwähnten Zigaretten das wichtigste Symbol der Privatheit. Wenn beide rauchen, dürfen das noch nicht einmal die Sicherheitsleute sehen. Frank nutzt diese Privatheit des Rauchens auch für die Politik, man denke an die Feuertreppe des Weißen Haus, wo er beim Rauchen mit dem Kreml-Chef Petrov verhandelt. Aber in diesem Fall ist die (vorgebliche) Privatheit als Mittel der Politik schon wieder instrumentalisiert worden. Späteren Besuchern wird Frank den schwarzen Fleck zeigen, der dort entstanden ist, wo Petrov seine Zigarette ausgedrückt hat. Das bereits beschriebene Stilmittel des Redens durch die vierte Wand[42] trägt zusätzlich dazu bei, diesen Gegensatz zwischen Öffentlichkeit und Privatheit zu markieren. Mitte der fünften Staffel setzt hier allerdings eine Veränderung ein. Das politische Setting im Weißen Haus wandelt sich zum Überwachungsstaat: Alle Kameras, auch an den Computern werden so geschaltet, dass Frank und Claire ihre Mitarbeiter ebenso wie ihre Gegner ständig beobachten können. Das Ausspionieren der Privatsphäre wird für die beiden Underwoods zum probaten Machtmittel, das sie gegen ihre eigenen Mitarbeiter anwenden, um sich einen Vorsprung an Machtwissen zu beschaffen. In der sechsten Staffel wird deutlich, dass die Gegenseite sich solcher Überwachungsmethoden ebenfalls bedient: Die Oligarchenfamilie Shepard setzt eine App einsetzen, mit deren Hilfe Handys abgehört und Browser gesteuert werden können. 8. Der getreue Diener
Deswegen steht eine Person, Doug Stamper, beiden Underwoods, aber insbesondere Frank am nächsten. Diese Beziehung wird nur daran scheitern – wie erwähnt ermordet Claire ihn in der Schlussszene der gesamten Serie -, dass es diesem nicht gelingt, seine unerschütterliche Loyalität gegenüber Frank nach dessen Tod auf Claire zu übertragen. In dieser komplexen Rolle wird der glatzköpfige und glatte Doug Stamper, Frank Underwoods Stabschef, eindeutig zur dritten Hauptfigur der Serie. Er ist trockener Alkoholiker, der zu Rückfällen neigt, und ein lakonischer Schweiger, der für seinen Chef jede Drecksarbeit erledigen würde. Zwei Morde gehen auf das Konto von Underwood, den dritten, an der Prostituierten Rachel, begeht Stamper. Der hat Rachel benutzt, um den Abgeordneten Peter Russo für seinen Chef gefügig zu machen, danach bringt er sie in einem kleinen Zimmer unter, bis sie Stamper auf der Flucht vor ihm schwer verletzt. Während er sich von den Verletzungen erholt, nimmt er Kontakt mit seinem Bruder auf, der ihn in der Folge mehrfach besucht, einmal zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Bei einem gemeinsamen Videoabend schauen sich die Brüder den Film „Contagion“ von Steven Soderbergh[43] an, der es nach der Corona-Krise zu einiger Berühmtheit brachte, weil er die Folgen einer Pandemie lange vor Corona realistisch darstellte. Insgesamt bleibt Doug Stamper ein Rätsel. Die Abgebrühtheit, mit der er für seinen Chef die Drecksarbeit erledigt, wird nur durch gelegentliche alkoholische Rückfälle konterkariert. Niemand kann richtig erklären, wieso er so nibelungentreu an seinem Chef festhält. Stamper braucht Monate, um wieder auf die Beine zu kommen. Weitere Zeit benötigt er, bis er die Untergetauchte entdeckt und gestellt hat. Er spürt die Prostituierte Rachel Posner in New Mexico auf, wo sie unter falschem Namen in einem Baumarkt jobbt. Vorher war es rührend zu sehen, wie der Stabschef sich von ihr im Auto Charles Dickens vorlesen ließ. Darüber sofort mehr. In New Mexicos Wüste kennt Stamper dann keine Gnade. Er muss sie umbringen, weil ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gelangen soll. Aber Stamper bestraft sie auch dafür, dass sie ihn nicht lieben will. Als er das Grab in der Wüste schon ausgehoben hat, zögert er und lässt sie frei, aber dann dreht er mit dem Auto nochmals um, tötet sie doch noch und verscharrt sie (III,13). Stamper hat sich von Rachel Posner aus einem Roman von Charles Dickens[44] vorlesen lassen: „The Tale of Two Cities“ (II,10). Am Ende, in der letzten Staffel, taucht dieser Roman wieder auf. Dickens erzählt die Geschichte einer Frau aus der Französischen Revolution. Mit den beiden Städten sind Paris und London gemeint. Charles Darnay wird von den Revolutionären zum Tod verurteilt. Sein Anwalt Sidney Carton ist in dessen Frau verliebt und opfert sich für seinen Mandanten. Er lässt sich an seiner Stelle guillotinieren. Wieso interessiert sich Stamper gerade für dieses Buch? Man hat vermutet, dass es sich um eine Reverenz an Charles Dickens handelt, weil ‚House of Cards‘ als Serie über mehrere Staffeln hinweg einen Dickens’schen Erzählansatz verfolge. Genauso aber könnte Stamper im Selbstopfer des Anwalts Darnay eine Parallele zu sich selbst sehen. Stamper könnte von den bei Dickens verhandelten Loyalitätskonflikten fasziniert sein, die in einem Selbstopfer münden. Im Übrigen ahnt Stamper offensichtlich, daß er seinen letzten Besuch im Oval Office, bei seiner zuletzt in eine Gegnerin verwandelten Präsidentin Claire Underwood nicht überleben wird. Dieses Ende, bei dem Stamper dann erstochen im Schoß von Claire liegt, habe ich bereits beschrieben. Stamper bleibt durch die Staffeln hindurch eine rätselhafte Figur. Das zeigt auch die merkwürdige Episode in der Folge von Franks Nierentransplantation nach dem Attentat. Frank Underwood benötigt dringend eine neue Niere. Stamper, der erst vor kurzem seinen Posten als Stabschef wiedererlangt hat, sorgt dafür, daß der Präsident auf den ersten Platz der Transplantationsliste vorrückt. Ein fünfzigjähriger Familienvater stirbt in der Folge. Er stand eigentlich vor Underwood auf der Liste. In diesem Fall scheinen Doug Stamper wirklich Gewissensbisse zu plagen. Er spendet später eine große Summe für die Stiftung, die seine Witwe zu Ehren ihres toten Mannes aufgebaut hat. Mit dieser Witwe beginnt er in der Folge eine Beziehung, er schläft mit ihr, aber der Sex erscheint als nicht besonders befriedigend. Eines Nachts gesteht er der Witwe im Auto, dass er die Transplantationsliste zugunsten von Frank manipuliert hat. Die Frau schreit ihn an, dass sie das sehr wohl gewusst habe: „I knew that. I didn’t fuck you because I loved you. I fucked you because I hated you.” (V,11) Danach knallt sie die Tür des Autos zu und verschwindet. Damit ist diese Episode zu Ende, das Drehbuch verfolgt ihre Geschichte nicht weiter. Das scheint mir eines der loose ends zu sein, über die sich bei den letzten beiden Staffeln viele Zuschauer beschwert haben. Doug Stamper, ewig auf der Suche nach seinem verlorenen Vater, trägt in der sechsten Staffel plötzlich einen Vollbart, den er aber schnell wieder abrasiert. Zwischen ihm und Claire entwickelt sich nach Franks Tod ein Diadochenkampf, den Doug nicht gewinnen kann. Claire schreckt nun nicht davor zurück, auch ihren verstorbenen Mann zu verraten: „He played us all.“ (VI, 7) Bevor Doug Stamper im Oval Office von der schwangeren Claire ermordet wird, kommt es zwischen beiden zu einer Auseinandersetzung, bei der sich Stamper – ausgerechnet er! - als der verlogene Mörder von Frank entlarvt. Er wollte diesen, der als Präsident zurückgetreten war und die Geschehnisse aus der Privatwirtschaft heraus steuern wollte, daran hindern, sein politisches Vermächtnis zu verraten. In der Schlussszene[45] vereinen sich die beiden Menschen, die am meisten von Frank abhängig waren. Nur die schwangere Claire überlebt. Aber es bleibt die Frage, ob sie aus dem Schatten ihres toten und abwesenden Ehemanns wird heraustreten können. Claire stilisiert sich als feministische Ikone und gleichzeitig als Begründerin einer Dynastie. Sie reißt alles an sich, ist mater dolorosa und Himmelskönigin, Jeanne d’Arc, Elisabeth I., Elisabeth II. und Simone de Beauvoir. Der Schluss von House of Cards ähnelt in seinem Pathos dem Schluss des zweiten Teils von Goethes „Faust II“: „Das ewig Weibliche zieht uns hinan.“ Stamper bleibt auch in dieser letzten, großen Szene der Serie, was er ist: ein loyaler Zuträger, der aber nicht an das (politikphilosophische) Format von Claire und Frank heranreicht. Im Grunde ist mit diesem Mord auch seine Nibelungentreue, also gerade das, wofür ihn Frank und Claire, als sie ihn noch nicht als Gegner betrachtete, geschätzt haben, gescheitert. Gleichzeitig zeigt sich in dieser Schlussszene so etwas wie ein Gegensatz zwischen der weiterhin lebendigen Männerwelt des ‚ruthless pragmatism‘ und dem überbordenden Feminismus von Claire. 9. Literatur und PsychoanalyseIn Staffel III wird der Schriftsteller Tom Yates eingeführt, ein jüngerer Mann mit rotblonden Haaren, stets nach bewusst schlampiger Intellektuellenart gekleidet, die so unabsichtlich wirken soll: Cordhosen, Rollkragenpullover, dunkles Jackett, abgegriffene Aktentasche. Den ersten Kontakt stellt Frank her: Yates soll in seinem Auftrag ein Buch schreiben, das die Promotion des Beschäftigungsprogramms „America Works“ vorantreibt. Diese Aufgabe verschafft ihm Zugang zum Präsidentenpaar, wobei Claire ihn zunächst gar nicht, dann nur sehr zögerlich an sich heranlässt. Yates ist ein Intellektueller mit einer Vergangenheit. Er wird Claire, nachdem sich das Verhältnis zu ihr verbessert hat, anvertrauen, dass er seinen ersten Bestseller gar nicht selbst geschrieben, sondern ein fragmentarisches Manuskript seines verstorbenen Freundes bearbeitet und fertiggestellt hat. Yates beobachtet sehr genau, genauer als es den Underwoods manchmal lieb ist. Der entstehende Roman über das Politikerehepaar wird verworfen, da er zu viele private Details enthält; zur Kompensation wird Yates zum Redenschreiber der frisch gekürten Vizepräsidentin Claire Underwood befördert. Sie führen in der Folge Gespräche in großem gegenseitigen Vertrauen – und beginnen eine Affäre. Frank erfährt davon – oder er hat das längst geahnt. Die drei führen nun wirklich eine menage à trois, inklusive gemeinsamem Frühstück. Yates gehört eigentlich zu den wenigen sympathischen Figuren der Serie, weil er intellektuell, verständnisvoll und gleichzeitig distanziert ist. Er beobachtet sehr genau und zieht aus diesen Beobachtungen die richtigen Schlüsse. Deswegen müssen sich Claire und Frank entlarvt fühlen. Als Redenschreiber des Präsidentenehepaares fühlt sich Yates unterfordert. Er ist in den Augen der Underwoods so etwas wie der Kriegsberichterstatter des Intrigensumpfes. Er soll über alle Ränke Bescheid wissen, aber gleichzeitig das Präsidentenpaar im Glorienschein öffentlichen Ansehens darstellen. Diese Dreierbeziehung zwischen dem Ehepaar und seinem Redenschreiber ist darum von vornherein darauf angelegt zu scheitern. Dazu trägt bei, dass er mit einer jungen Praktikantin schläft, die Touristen durch das Weiße Haus führt. Claire lebt in der fünften Staffel mit Tom Yates zusammen. Diese Beziehung verheimlichen beide nicht gegenüber Frank, sehr wohl jedoch gegenüber der Öffentlichkeit. In V,10 gesteht Claire ihrem Liebhaber, dass ihr Ehemann Zoe Barnes und Peter Russo umgebracht hat. Das tut sie, obwohl sie weiß, dass Yates alles, was er in den Gesprächen mit den Underwoods erfährt, für seine Bücher ausschlachtet. Irgendwann wird er darum für Claire zu gefährlich. Ohne dass er von ihren Plänen etwas ahnt, trifft er sie ein letztes Mal. Beide schlafen miteinander. In den Whisky, den er danach trinkt, hat Claire ein tödliches Gift gemischt. Er stirbt davon, führt aber ein obskures Weiterleben als Leiche (V,12). Bei der Szene, wo beide noch einen Whisky trinken, sind sich die Zuschauer einen kleinen Moment lang nicht sicher, ob sie wirklich die Dreistigkeit besitzt, ihn nach dieser langen Zeit der Beziehung zu ermorden. Der Zuschauer bemerkt es erst, als Claire nach dem Mord die giftigen Tropfen wieder in die Hand nimmt. Tom Yates ist mit dem Pflanzenpräparat Gelsemium vergiftet worden. In Extrakten dient es als Analgetikum, in hoher Dosis wirkt es tödlich. Unter anderem hat der Erfinder der Detektivgestalt Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, damit experimentiert[46]. Diese Tropfen hat sie von der ganz undurchsichtigen Politikerin Jane Davis erhalten. Bevor er stirbt, sagt Yates zu Claire: „ I know everything, but isn’t that what you want.” Und das zeigt doppeldeutige Rolle, die Yates im Grunde gegenüber beiden Underwoods einnimmt. Zwar ist er Claires Liebhaber, aber Frank nimmt ihn deswegen noch lange nicht als Rivalen ernst. Sehr viel mehr fürchten ihn beide, weil sie Angst haben, dass er sie – als Psychologe, als Schriftsteller – durchschaut. Auf der einen Seite wollen das beide wissen, was er über sie herausbekommen hat, auf der anderen Seite fürchten sie, dass Tom Yates mit seinem Wissen an die Öffentlichkeit gehen könnte. 10. Nebenfiguren
1. Edward Meechum arbeitet als Underwoods ständiger Personenschützer. Und nach einem banalen Konflikt wandelt sich Meechum zu einem Sicherheitsmann, so wie Frank es schätzt: schweigsam, loyal, nicht aus der Ruhe zu bringen, diskret. Meechum kommt einmal in Underwoods Arbeitszimmer, als dieser sich auf dem Laptop einen Porno anschaut (II,11). Er reagiert mit vollständiger Diskretion und lässt sich nichts anmerken. Underwood erzählt davon seiner Frau und reagiert mit Ironie, im Nachhinein. In einer anderen Szene (II,12) hat sich der Sicherheitsbeamte, der sich nun auch um die Auftritte von Claire kümmert, die Hand geschnitten. Die Szene spielt im Garten des Underwood’schen Hauses. Claire holt einen Verband und desinfiziert die Wunde. Frank kommt dazu, und plötzlich verwandelt sich die Szene in eine Art menage à trois mit Traumcharakter. Der Zuschauer wird im Unklaren gelassen, ob es sich um Wirklichkeit oder eine Traumsequenz handelt. Er soll allerdings den Eindruck bekommen, zwischen den dreien, dem Ehepaar und seinem Sicherheitsmann, bestehe so etwas wie eine erotische Beziehung. Meechum, der ewig treue Sicherheitsmann, der früher ein treuer Legionär Cäsars gewesen wäre, kommt bei einem Attentat ums Leben (IV,4). Er hat sich vor den Körper des Präsidenten geworfen. Vorher noch ist er mit diesem durch die Gänge des Weißen Hauses gelaufen. Bei einem Ölbild bleiben sie stehen, der Präsident nimmt es ab und zeichnet an die Wandstelle, wo es hängt, die Umrisse von Meechums Hand nach. Nach der Beerdigung Meechums schaut der Präsident, der seinen Sicherheitsmann sehr vermisst, an dieser Stelle nach. Aber die Nachzeichnung der Hand ist übertüncht worden. Underwood vermisst seinen Sicherheitsmann, ihm gefällt diese ‚knechtartige‘, schweigende, beinahe unterwürfige Grundhaltung Meechums. In der Beziehung zwischen beiden existiert ein homosexueller Subtext. An Meechum ist kritisiert worden, dass er wie Doug Stamper, bei dem diese Kritik berechtigt erscheint, psychologisch nicht auserzählt worden ist. Aber bei Meechum erscheint diese Kritik nicht richtig am Platz. Selbstverständlich ist er eine Figur, die als Personenschützer für die eigentlichen politischen Intrigen, in denen Frank und Claire sich engagieren, nur geringe Bedeutung hat. Auf der anderen Seite wird er gerade durch die dauernde Begleitung des Paares zu einer beständigen Gegenwart für die beiden, und genau das zeigt, dass das Ehepaar und sein Personenschützer sich aneinander gewöhnt haben. Außerdem schätzt Frank Meechums Diskretion und Loyalität. Aus dieser Grundbeziehung entwickelt sich noch etwas anderes, ein weiterer psychologischer Horizont, was die erotische Szene in II,12 andeutet, was aber in der Folge nicht weiter entfaltet wird. 2. Wenn er am Morgen seine Ruhe haben will, lässt sich Frank in Washington zu Fred’s BBQ Joint fahren, einer Imbissbude in einem heruntergekommenen Viertel, die auf spare ribs spezialisiert ist. Freddie Hayes, der hünenhafte Schwarze mit der Schürze stellt dann einen Teller mit Rippchen auf den Tisch, und Frank verzehrt die Rippchen alleine. Eigentlich ist das ungesund, am frühen Morgen für den Magen schwer erträglich. Aber es gilt auch als bodenständig, es erinnert Frank an seine Herkunft aus den Südstaaten und an seine Eltern. Freddie ist – wie Meechum - schweigsam und völlig loyal, er darf dann das Catering machen, als Präsident Walker mit seiner Frau bei den Underwoods zu Besuch zum Abendessen kommt (II,7). Nach einem Zeitungsartikel über die Besuche des Vizepräsidenten in seinem Imbiss gibt Fred der Versuchung nach, seinen Markennamen an ein Franchise Unternehmen zu verkaufen. Nach weiteren Zeitungsberichten über seinen entfremdeten Sohn, einen Drogendealer wird dieser Vertrag schnell wieder aufgelöst (II,9). Als Underwood schon selbst als Präsident amtiert, erhält Fred, der seinen Laden und sein Geld verloren hat, eine Anstellung als Gärtner im Weißen Haus. Bei ihrer letzten Begegnung (IV,10) wehrt sich Fred endlich gegen die patriarchalische und gönnerhafte, auch rassistische Bevormundung. Frank bietet ihm einen besseren Job an und gerät in Streit mit Freddie, der sich bevormundet und gedemütigt fühlt. Er nennt den Präsidenten zweimal einen „motherfucker“. Der Präsident und sein Gärtner trennen sich im Streit. Danach ist von Fred nichts mehr zu sehen. Frank dagegen gefällt sich in seinem Mäzenatentum, das stets die Differenz zwischen Macht und Ohnmacht, Geber und Empfänger betont. 3. Zu den Begleiterinnen, die Frank und Claire Underwood seit der ersten Staffel unterstützen, gehört die Außenministerin Catherine Durant. Sie entwickelt mit Claire, die als UN-Beauftragte außenpolitisches Profil gewinnen will, eine weibliche Rivalität, fast einen Zickenkrieg, der sich steigert, als Claire ihr bei der Convention der demokratischen Partei das Amt der Vizepräsidentin streitig macht. Catherine Durant weiß viel zu viel, sie muss immer wieder zurückstecken, bis sie sich schließlich nur noch selbst retten will und deshalb für Underwood zur Gefahr wird. Frank stößt sie daraufhin mit Absicht eine Treppe im Weißen Haus hinunter (V,10). Sie stirbt nicht nach dieser Attacke, aber sie leidet unter den medizinischen Folgen, besonders unter Migräneanfällen. Was Durant von den meisten anderen Politikern der Serie unterscheidet, die mit den Underwoods in Konflikt geraten, ist die Nachhaltigkeit, mit der es ihr gelingt, an ihrem Amt als Außenministerin festzuhalten. Zwar scheitert sie bei dem Versuch, als Vizepräsidentin nominiert zu werden, aber das kostet sie nicht ihren Posten. Erst in der letzten Staffel findet Durant ein einigermaßen merkwürdiges Ende (VI,2). Zuerst sieht es so aus, als sei sie von Sicherheitsbeamten entführt worden. Dann wird sie für tot erklärt. Die Leiche wird angeblich sofort verbrannt. Fast eine ganze Folge der sechsten Staffel ist den Gesprächen und Intrigen während und nach der Trauerfeier gewidmet (VI,3). Dann stellt sich heraus, dass sie noch lebt und heimlich nach Dubai oder Saudi-Arabien geflohen ist. Sie will vor Gericht und vor einem Senatskomitee eine Aussage machen. Durant hält sich stets im Hintergrund, sie bleibt trotz der Konflikte mit Claire eine loyale politische Freundin, erhält aber in den Folgen bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit wie der Stabschef Doug Stamper. Durants Schicksal am Ende der letzten Staffel bleibt phantastisch, übertrieben und unglaubwürdig. 11. Pathos weiblicher Apokalyptik?Was gerade über die Glaubwürdigkeit des Schicksals der Außenministerin gesagt wurde, gilt im Grunde genommen für die gesamte sechste Staffel, und im Besonderen für den Showdown.
In der sechsten Staffel spielt Kevin Spacey wegen seines #Me-Too-Skandals nicht mehr mit. Netflix sorgte dafür, dass die bereits mit ihm gedrehten Szenen aus den Folgen herausgeschnitten wurden. Die sechste Staffel umfasst als einzige nur acht anstatt der sonst üblichen dreizehn Folgen. Sie bietet eine Reihe von Überraschungen und negativen Entwicklungen, die die Serie leider sehr unglaubwürdig machen. Claire ist nun Präsidentin. „My turn“, sagt sie am Ende der fünften Staffel (V,13). Außerdem ist sie schwanger. Diese Schwangerschaft, vor allem in ihrem Alter, bleibt ein Rätsel, zumal Claire und Frank jahrelang nicht mehr miteinander geschlafen haben.
Der endgültige Showdown findet dann – wie nicht anders zu erwarten – im Oval Office statt. Doug Stamper, der ehemalige Stabschef von Frank Underwood und nach seinem Tod sein letzter Parteigänger, trifft auf Claire. Sie streiten sich um Franks Testament. Claire erklärt, nicht Stamper, sondern ihr noch ungeborenes Kind würde den Besitz von Frank Underwood erben. Das letzte Testament sei nicht gültig. Und das Kind, ein Mädchen, würde den Namen Frances von Francis erhalten. An dem noch ungeborenen Kind wirkt alles symbolisch überladen. Geschlecht und Name haben beide eine besondere Bedeutung. Claire wirkt wie eine Maria, die durch ihre Schwangerschaft dafür sorgt, dass eine weibliche Messiasfigur geboren wird. Dieser Eindruck des Messianisch-Religiösen verstärkt sich noch durch folgende Szene. Denn am Ende des Gesprächs tötet Claire Doug Stamper mit einem Brieföffner. Selbst dieser Brieföffner hat eine lange vorbereitete symbolische Bedeutung. Denn es handelt sich um denjenigen Brieföffner, den sich Doug Stamper vom Präsidenten beim Abschied aus dem Oval Office als Souvenir erbeten hatte. Und Claire wird nach dem Mord wie eine Pietà inszeniert. Wie der vom Kreuz abgenommene Jesus liegt der tote Doug Stamper im Schoß von Claire, ein weiteres starkes, wenn auch übertrieben wirkendes Bild für eine maternalistischen Messianismus. Die alten Männer Stamper und Underwood sind nun endgültig vergangen. Und Claire spricht dann die Schlussworte, die die Serie abrunden und auf den Anfang verweisen. In der ersten Szene der ersten Folge tötet Frank einen jaulenden Hund, der bei einem Autounfall verletzt wurde. Am Anfang (I,1), über den jaulenden Hund gebeugt, sagte Frank: „There are two types of pain. The sort of pain that makes you strong, or useless pain … the sort of pain that’s only suffering. I have no use for useless thing (begins strangling the dog). Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing? (the dog’s neck snaps) There. No more pain.” Bei Frank zeigt sich hier, bevor der Begriff fällt, jener „ruthless pragmatism“, der sein politisches Handeln auszeichnet, sich am Anfang aber eben auch auf den alltäglichen Umgang mit Tieren auswirkt. Unnötiges Leiden soll verhindert werden. Jemand muss die Drecksarbeit tun. Langes Grübeln verlängert nur das Leiden. Die Wiederaufnahme wird durch eine weitere Tierszene vorbereitet, die ebenfalls in die sechste Staffel gehört: In VI,1 hört die neue Präsidentin Claire hinter den Wänden des Oval Office merkwürdige Geräusche. Sie fängt einen Singvogel, der sich offensichtlich verirrt hat. Durch ein Fenster lässt sie ihn wieder frei. Sie tötet den Vogel nicht, anders als der brutale Frank am Anfang mit dem Hund umgegangen ist. Dabei sollte man aber den befreiten Singvogel nicht als Symbol von Freiheit und Demokratie bewerten. Denn Claire, so hat sich gezeigt, hatte ja keine Skrupel, ihren Gegner Doug Stamper zu ermorden. In der letzten Folge der Serie nimmt sie die Worte Franks vom Anfang auf. Sie schaut auf den toten Doug Stamper in ihrem Schoß und haucht in die Kamera: „There. No more pain.“ (VI,8) Auch Doug Stamper sollte nicht unnötig leiden. Claire ist zugleich Madonna und Mörderin. Die alte Elite sinkt tot zu Boden, während die neue Elite bereits an die Macht gekommen ist und ihre Nachfolge regelt. Und diesem Fall heißt das: Die Frauen lösen die Männer ab, aber eben nicht in einem feministisch-egalitären Sinn, sondern in dem Sinn, dass – siehe Claires Schwangerschaft – diese eine weibliche Dynastie begründet. So ist dann auch für „House of Cards“ durch die Ablösung der weißen, alten Männer die amerikanische Demokratie an ihr Ende gekommen. Claire ist nicht nur Madonna, sondern auch Königin, nicht Himmelskönigin wie Maria, sondern politische Königin. So sehr die Drehbuchautoren dafür zu bewundern sind, dass sie in den letzten Folgen alle offenen Fäden zusammenbringen und zu einem Knoten schnüren, so wirkt diese Ballung von Symbolen am Ende der Serie überfrachtet und unglaubwürdig. Franks männlicher Pragmatismus ist abgelöst worden durch einen neuen matriarchalen Idealismus. Vielleicht liegt in diesem überfrachteten feministischen Symbolismus ein Moment der Ironie, denn noch die unbedarfteste Zuschauerin wird erkennen, dass das idealisierte Matriarchat Claire Underwoods, so sehr es von Frauen herbeigesehnt werden mag, neue gravierende Probleme mit sich bringen wird. 12. Politik als Kontingenzbewältigung
Anmerkungen[23] House of Cards, Netflix, 2013ff. Die Serie wird im Folgenden zitiert, indem ich die Staffel mit lateinischen, die [24] Es ist viel darüber reflektiert worden, dass die Serie nicht im Kontext seriellen, zeitgebundenen Fernsehens, sondern bei einem Streamingdienst wie Netflix ausgestrahlt wurde. Vgl. dazu Elena Pilipets, Rainer Winter, House of Cards – House of Power: Politicial Narratives and the Cult of Serial Sociopaths in Narrative Politics in American Quality Dramas in the Digital Age, in: Betty Kaklamanidou, Margaret J.Tally (Hg.), Politics and Politicians in Contemporary US Television. Washington as Fiction, Routledge Advances in Television Studies 8, Milton Park 2017, 91-104. [25] Ein Porträt des Hauptdrehbuchautors Beau Willimon findet sich bei Adam Sternbergh, The Post-Hope Politics of ‚House of Cards‘, New York Times Magazine 31.1.2014, https://www.nytimes.com/2014/02/02/magazine/the-post-hope-politics-of-house-of-cards.html. [26] Das gilt zum Beispiel für die beiden Staffeln der französischen Serie „Marseille“: Marseille, Netflix, 2016 (Staffel 1), 2018 (Staffel 2). [27] Man muß das positive Urteil über die Serie, die Darstellung der Figuren und die Nähe zu aktueller Politik nicht unbedingt teilen. Vgl. zum Beispiel Nicklas Bascheck, Die teuerste Seifenopfer der Welt, Die Zeit 15.4.2015, https://www.zeit.de/kultur/film/2015-04/house-of-cards-underwood-kritik/komplettansicht. Bascheck kommt zu dem Ergebnis: „In ihren zahlreichen schwachen Momenten ist House of Cards die Hochglanzvariante einer Stammtischdiskussion.“ Und am Ende dieser Kritik heißt es: „Deshalb ist es in diesem Fall ausnahmsweise einfach mal wahr, wenn man sagt: House of Cards ist, was der Durchschnitt will. Und das ist offensichtlich die Bestätigung eigener Klischees.“ Nach meinem Urteil wird die Serie damit allerdings systematisch unterschätzt. [28] Underwood heißt Francis, wird aber von allen, außer von seiner Frau Claire, meist Frank genannt. Ich verwende in diesem Essay beide Vornamen. [29] Die Amtsführung des gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten hat die Spekulationen über die Nähe der Serie zur Realität noch verstärkt. Vgl. Sacha Batthyany, Selbst ‚House of Cards‘ hat gegen die Realität keine Chance, SZ 3.6.2017, https://www.sueddeutsche.de/medien/us-serie-selbst-house-of-cards-hat-gegen-die-realitaet-keine-chance-1.3532039. [30] Dazu Oliver Kohns, Inszenierte Demokratie. Was House of Cards uns über Politik erzählt, Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur in Luxemburg, Nr. 365 (2016), 51-53, http://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/28385/1/365_KOHNS.pdf. [31] Hier wird ausdrücklich ein anderer Weg verfolgt als derjenige, Underwood als einen durch und durch korrupten Machiavellisten zu interpretieren, der beim Publikum nichts anderes als Abscheu und Empörung auslöst. Auf dieser Linie argumentieren zum Beispiel Florian Breitweg, Jakob Hager, Vanessa Molter, Cornelius Witt, House of Cards. The American Machiavelli, in: Niko Switek (Hg.): Politik in Fernsehserien – Analysen und Fallstudien zu House of Cards, Borgen & Co., Bielefeld 2018, 243–269, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14361/9783839442005-011. [32] Dazu s.u. in diesem Teil Abschnitt 4 und 9. [33] Zum Verhältnis von politischer und journalistischer Ethik vgl. Marjolaine Boutet, The Politics of Time in House of Cards, in: Birgit Dawes et al. (Hg.), Transgressive Television. Politics and Crime in 21st century American TV Series, Heidelberg 2015, 83-102. [34] Vgl. zu Meechum, Haines und Stamper unten Abschnitte 8 und 10. [35] Fernando Meirelles, Die zwei Päpste, Netflix, 2019. [36] Vgl. dazu unten Abschnitt 11. [37] S.o. Abschnitt 2. [38] Zu Tom Yates s.u. Abschnitt 9. [39] S.o. Abschnitt 2. [40] Zu Tom Yates s.u. Abschnitt 9. [41] Vgl. zum Verhältnis von Frank und Claire auch: Andreas Gardt, Macht in House of Cards, in: Urania Milevski et al. (Hg.), Gender und Genre. Populäre Serialität zwischen kritischer Rezeption und geschlechtertheoretischer Reflexion, Würzburg 2018, 179-196. [42] S.o. Abschnitt 1. [43] Steven Soderbergh, Contagion, a.a.O., Anm. 5. [44] Charles Dickens, A Tale of Two Cities, London 2003 (1859). [45] S.o. Abschnitt 4. [46] N.N., Art. Gelsemium, Wikipedia, o. O. o.Z., https://de.wikipedia.org/wiki/Gelsemium. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/127/wv061.htm |
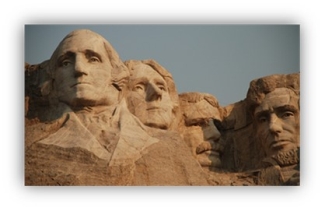 Die Politik der öffentlichen Theologie stellte sich als ein vernunftgeleiteter argumentativer Diskurs dar, in dem die Kirchen wertebegründete Zielvorstellungen (Menschenrechte, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung) einbringen, biblische Begründungen mit aktuellen politischen Vorhaben verknüpfen und ganz bewusst die Sprache der Argumentation, nicht der Agitation pflegen. Es ergibt sich ein Bild zielgeleiteter, methodischer Argumentation, die Glauben und Vernunft auf einer politischen Ebene zusammenbringt, die bewusst eine Sprache spricht, die über die Voraussetzungen des christlichen Glaubens hinausreicht, weil die angestrebten Entscheidungen und Ziele auf einen allgemeinen Konsens ausgerichtet sind. Eigentlich wäre dem methodisch nicht zu widersprechen, aber die folgenden Überlegungen zur Serie „House of Cards“ zeigen ein Bild von politischem Handeln, das diesem vernunftgeleiteten, konsensorientierten Modell von Politik widerspricht: Politik stellt sich als machtgeleitet, persönlich und willkürlich heraus. Unter solchen Ausgangsbedingungen werden die Stimme der Vernunft und des Glaubens nicht mehr richtig gehört, wenn sie nicht unterlaufen werden oder sogar untergehen.
Die Politik der öffentlichen Theologie stellte sich als ein vernunftgeleiteter argumentativer Diskurs dar, in dem die Kirchen wertebegründete Zielvorstellungen (Menschenrechte, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung) einbringen, biblische Begründungen mit aktuellen politischen Vorhaben verknüpfen und ganz bewusst die Sprache der Argumentation, nicht der Agitation pflegen. Es ergibt sich ein Bild zielgeleiteter, methodischer Argumentation, die Glauben und Vernunft auf einer politischen Ebene zusammenbringt, die bewusst eine Sprache spricht, die über die Voraussetzungen des christlichen Glaubens hinausreicht, weil die angestrebten Entscheidungen und Ziele auf einen allgemeinen Konsens ausgerichtet sind. Eigentlich wäre dem methodisch nicht zu widersprechen, aber die folgenden Überlegungen zur Serie „House of Cards“ zeigen ein Bild von politischem Handeln, das diesem vernunftgeleiteten, konsensorientierten Modell von Politik widerspricht: Politik stellt sich als machtgeleitet, persönlich und willkürlich heraus. Unter solchen Ausgangsbedingungen werden die Stimme der Vernunft und des Glaubens nicht mehr richtig gehört, wenn sie nicht unterlaufen werden oder sogar untergehen. House of Cards“
House of Cards“ „House of Cards“ konnte deshalb überzeugen, weil es am alten Begriff von Politik anknüpfte und trotzdem alles neu machte. Das löste, zumindest nach den ersten Staffeln, allgemeine Bewunderung aus: Was hat man nicht alles über diese amerikanische Serie gehört, über neues serielles Erzählen, professionelle Machart, geschickte Schnitte und großartige Schauspieler?
„House of Cards“ konnte deshalb überzeugen, weil es am alten Begriff von Politik anknüpfte und trotzdem alles neu machte. Das löste, zumindest nach den ersten Staffeln, allgemeine Bewunderung aus: Was hat man nicht alles über diese amerikanische Serie gehört, über neues serielles Erzählen, professionelle Machart, geschickte Schnitte und großartige Schauspieler? Die Beziehung zwischen Frank Underwood und seiner Frau Claire erinnert an die Beziehung zwischen Bill und Hilary Clinton. Bill Clinton wurde trotz der Lewinsky-Affäre als Präsident wiedergewählt, und sie unterlag als Senatorin bei der Präsidentschaftswahl 2015 denkbar knapp einem republikanischen Kandidaten. Mehrere der Schauspieler von „House of Cards“ kolportierten das anonyme Zitat eines Mitarbeiters aus der Obama-Administration, wonach 99 Prozent der Serieninhalte ganz realistisch dargestellt seien, und das, obwohl Underwood schon am Ende der ersten Staffel einen Kongressabgeordneten und eine junge Journalistin ermordet hat. Und das bleibt weder der einzige Mord noch die einzige Straftat.
Die Beziehung zwischen Frank Underwood und seiner Frau Claire erinnert an die Beziehung zwischen Bill und Hilary Clinton. Bill Clinton wurde trotz der Lewinsky-Affäre als Präsident wiedergewählt, und sie unterlag als Senatorin bei der Präsidentschaftswahl 2015 denkbar knapp einem republikanischen Kandidaten. Mehrere der Schauspieler von „House of Cards“ kolportierten das anonyme Zitat eines Mitarbeiters aus der Obama-Administration, wonach 99 Prozent der Serieninhalte ganz realistisch dargestellt seien, und das, obwohl Underwood schon am Ende der ersten Staffel einen Kongressabgeordneten und eine junge Journalistin ermordet hat. Und das bleibt weder der einzige Mord noch die einzige Straftat. In der Serie bleibt Underwoods Frau Claire am Anfang im Hintergrund, sie leitet eine ökologische NGO und mischt in der eigentlichen Politik gar nicht mit. Das ändert sich erst mit der vierten Staffel. Vorher waren die Underwoods ein Politikerehepaar, das nebeneinander her lebte. Beide pflegten außereheliche Affären, und jeder wusste von den Seitensprüngen des anderen. Ab der vierten Staffel werden sie darüber hinaus zu politischen Rivalen. Sie sind nun das first couple, das Präsidentenehepaar. Francis hält seine Frau für seine wichtigste Unterstützerin beim Wahlkampf um die Wiederwahl ins Präsidentenamt. Und er erwartet, dass sie sich in sein Team einreiht. Claire dagegen sieht sich als eigenständige Politikerin, die nach einem eigenen politischen Amt strebt, um – ausgerechnet als First Lady – nach Unabhängigkeit von ihrem präsidialen Ehemann zu streben. Ab der vierten Staffel dominiert zwischen Claire und Frank die Politik, und diese überlagert Beziehung, Biographie, Sport und Seitensprünge.
In der Serie bleibt Underwoods Frau Claire am Anfang im Hintergrund, sie leitet eine ökologische NGO und mischt in der eigentlichen Politik gar nicht mit. Das ändert sich erst mit der vierten Staffel. Vorher waren die Underwoods ein Politikerehepaar, das nebeneinander her lebte. Beide pflegten außereheliche Affären, und jeder wusste von den Seitensprüngen des anderen. Ab der vierten Staffel werden sie darüber hinaus zu politischen Rivalen. Sie sind nun das first couple, das Präsidentenehepaar. Francis hält seine Frau für seine wichtigste Unterstützerin beim Wahlkampf um die Wiederwahl ins Präsidentenamt. Und er erwartet, dass sie sich in sein Team einreiht. Claire dagegen sieht sich als eigenständige Politikerin, die nach einem eigenen politischen Amt strebt, um – ausgerechnet als First Lady – nach Unabhängigkeit von ihrem präsidialen Ehemann zu streben. Ab der vierten Staffel dominiert zwischen Claire und Frank die Politik, und diese überlagert Beziehung, Biographie, Sport und Seitensprünge. Meine Analyse konzentriert sich auf die in der Serie vermittelte politische Ethik, der Inhalt wird nicht vollständig wiedergegeben, er ist auch schnell erzählt: Ein amerikanisches Politikerehepaar strebt mit allen Mitteln nach dem Präsidentenamt. Die Frau löst irgendwann den Mann als Präsidenten ab. Beide versuchen – wieder mit allen Mitteln –, sich im Amt zu halten. Wichtig erscheint zunächst die gewählte Methode filmischen Erzählens (1.). Darauf folgen Bemerkungen zu Frank Underwoods Biographie (2.) und der politischen Philosophie (3.), die er als Präsident entwickelt. Biographie und Philosophie unterscheiden sich von derjenigen seiner Ehefrau Claire (4.). Die Spannung in der Beziehung zwischen beiden macht den grundlegenden Reiz der Serie aus. Besonders Frank zeigt ein bestimmtes Verhältnis zur Religion (5.), und beide haben ihre eigene Auffassung von Erotik (6.) sowie vom Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit (7.). Ein Präsidentenehepaar ist nicht ohne ein Umfeld von Mitarbeitern zu denken. Die wichtigsten sind Franks Stabschef Doug Stamper (8.) für Frank und der Schriftsteller Tom Yates (9.) für Claire. Weitere Mitarbeiter und Kontaktpersonen stehen demgegenüber stärker im Hintergrund (10.). Darauf folgen Bemerkungen über die finale sechste Staffel, die sich von den anderen Staffeln unterscheidet (11.) und einige Schlussbemerkungen, die sich mit der Rezeption der Serie auseinandersetzen (12.).
Meine Analyse konzentriert sich auf die in der Serie vermittelte politische Ethik, der Inhalt wird nicht vollständig wiedergegeben, er ist auch schnell erzählt: Ein amerikanisches Politikerehepaar strebt mit allen Mitteln nach dem Präsidentenamt. Die Frau löst irgendwann den Mann als Präsidenten ab. Beide versuchen – wieder mit allen Mitteln –, sich im Amt zu halten. Wichtig erscheint zunächst die gewählte Methode filmischen Erzählens (1.). Darauf folgen Bemerkungen zu Frank Underwoods Biographie (2.) und der politischen Philosophie (3.), die er als Präsident entwickelt. Biographie und Philosophie unterscheiden sich von derjenigen seiner Ehefrau Claire (4.). Die Spannung in der Beziehung zwischen beiden macht den grundlegenden Reiz der Serie aus. Besonders Frank zeigt ein bestimmtes Verhältnis zur Religion (5.), und beide haben ihre eigene Auffassung von Erotik (6.) sowie vom Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit (7.). Ein Präsidentenehepaar ist nicht ohne ein Umfeld von Mitarbeitern zu denken. Die wichtigsten sind Franks Stabschef Doug Stamper (8.) für Frank und der Schriftsteller Tom Yates (9.) für Claire. Weitere Mitarbeiter und Kontaktpersonen stehen demgegenüber stärker im Hintergrund (10.). Darauf folgen Bemerkungen über die finale sechste Staffel, die sich von den anderen Staffeln unterscheidet (11.) und einige Schlussbemerkungen, die sich mit der Rezeption der Serie auseinandersetzen (12.). Es macht den Reiz der Serie aus, dass Underwood sich nicht auf die Rolle des korrupten Politikers festlegen lässt. Wenn er bei seinen vielen Intrigen und Gschaftlhubereien für niemanden länger Zeit hat, dann doch stets für die Zuschauer, für die er gerne die im Theater-Fachjargon so genannte ‚vierte Wand‘ (neben der Breite, Höhe und Tiefe der Bühne oder der Szene) durchbricht, um die Zuschauer der Serie direkt anzureden und mit philosophischen Weisheiten, seiner wahren Meinung über Gesprächspartner und spöttischen Bemerkungen zu unterhalten. Deswegen ist zu Recht von ‚House of Cards‘ als einem backstage drama
Es macht den Reiz der Serie aus, dass Underwood sich nicht auf die Rolle des korrupten Politikers festlegen lässt. Wenn er bei seinen vielen Intrigen und Gschaftlhubereien für niemanden länger Zeit hat, dann doch stets für die Zuschauer, für die er gerne die im Theater-Fachjargon so genannte ‚vierte Wand‘ (neben der Breite, Höhe und Tiefe der Bühne oder der Szene) durchbricht, um die Zuschauer der Serie direkt anzureden und mit philosophischen Weisheiten, seiner wahren Meinung über Gesprächspartner und spöttischen Bemerkungen zu unterhalten. Deswegen ist zu Recht von ‚House of Cards‘ als einem backstage drama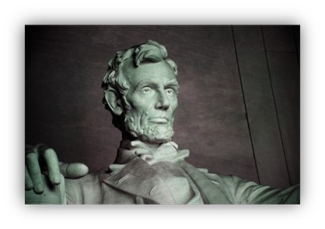 Am Anfang der Serie ist Francis Underwood Kongressabgeordneter und Majority Whip (= Fraktionsvorsitzender), mit besten Aussichten, unter dem neuen Präsidenten Walker das Amt des Secretary of State zu erhalten. Aber ein anderer Politiker wird aus undurchsichtigen Gründen bevorzugt. Als Reaktion darauf beschließt Frank, ab jetzt nicht mehr die Interessen der Partei, sondern eigene Interessen zu verfolgen und nur noch an der Vergrößerung der eigenen Macht zu arbeiten. Er nennt das mehrfach einen „ruthless pragmatism“, ein Schlüsselbegriff seiner politischen Philosophie, auf den ich noch komme.
Am Anfang der Serie ist Francis Underwood Kongressabgeordneter und Majority Whip (= Fraktionsvorsitzender), mit besten Aussichten, unter dem neuen Präsidenten Walker das Amt des Secretary of State zu erhalten. Aber ein anderer Politiker wird aus undurchsichtigen Gründen bevorzugt. Als Reaktion darauf beschließt Frank, ab jetzt nicht mehr die Interessen der Partei, sondern eigene Interessen zu verfolgen und nur noch an der Vergrößerung der eigenen Macht zu arbeiten. Er nennt das mehrfach einen „ruthless pragmatism“, ein Schlüsselbegriff seiner politischen Philosophie, auf den ich noch komme.
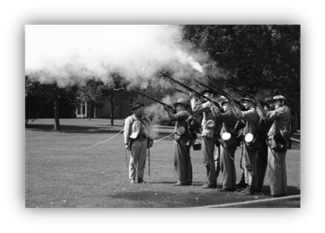 n der Folge dieses Schlachtenbesuchs stellt sich Frank einen Tisch mit einer Modelllandschaft in sein Arbeitszimmer. Er bemalt Zinnsoldaten und positioniert sie in dem entstehenden Schlachtenpanorama. Damit kann er sich stundenlang beschäftigen. Irgendwann gerät das Panorama in Vergessenheit, aber es ist dann nicht nur in Franks Privathaus zu sehen, es wird dann auch im Weißen Haus aufgestellt. Am Modell bleibt wichtig: Es ist ein Symbol dafür, dass Frank beabsichtigt, sich die Wirklichkeit nach seinen Wünschen zu modellieren. Mit Menschen, mit Politikern, Freunden, Untergebenen geht er um wie mit Zinnsoldaten, die er skrupel- und rücksichtslos hierhin und dorthin schiebt.
n der Folge dieses Schlachtenbesuchs stellt sich Frank einen Tisch mit einer Modelllandschaft in sein Arbeitszimmer. Er bemalt Zinnsoldaten und positioniert sie in dem entstehenden Schlachtenpanorama. Damit kann er sich stundenlang beschäftigen. Irgendwann gerät das Panorama in Vergessenheit, aber es ist dann nicht nur in Franks Privathaus zu sehen, es wird dann auch im Weißen Haus aufgestellt. Am Modell bleibt wichtig: Es ist ein Symbol dafür, dass Frank beabsichtigt, sich die Wirklichkeit nach seinen Wünschen zu modellieren. Mit Menschen, mit Politikern, Freunden, Untergebenen geht er um wie mit Zinnsoldaten, die er skrupel- und rücksichtslos hierhin und dorthin schiebt. Franks Leben geht in seinem politischen Handeln auf. Wenn er sich ins Private zurückzieht, dann spielt er Videospiele, er raucht, gelegentlich zusammen mit seiner Frau Zigaretten, die er überall in der Wohnung an heimlichen Verstecken lagert. Die Szenen gemeinsamen Rauchens mit dem russischen Staatschef Petrov werden so vorbereitet. Underwood treibt Sport, auf Aufforderung Claires, die ihm ein teures Rudergerät in den Keller stellen lässt. Das anstrengende Politikerleben benötigt Ausgleich und Kompensation. Zuerst weigert sich Frank, das Gerät zu benutzen, will bei seinen Ego-Shootern an der Video-Konsole bleiben. Dann aber trainiert er verbissen. Zusammen mit Claire geht er auch spät in der Nacht joggen. In III,13 taucht das Rudergerät wieder auf. Claire und Frank dürfen nun nicht mehr joggen, weil die Sicherheitsleute Bedenken haben. Francis bellt Claire die 500-Meter-Ruderzeit zu, die sie schlagen muss. Irgendwann joggt Claire dann wieder, und Francis steigt auf einen Fahrrad-Hometrainer um.
Franks Leben geht in seinem politischen Handeln auf. Wenn er sich ins Private zurückzieht, dann spielt er Videospiele, er raucht, gelegentlich zusammen mit seiner Frau Zigaretten, die er überall in der Wohnung an heimlichen Verstecken lagert. Die Szenen gemeinsamen Rauchens mit dem russischen Staatschef Petrov werden so vorbereitet. Underwood treibt Sport, auf Aufforderung Claires, die ihm ein teures Rudergerät in den Keller stellen lässt. Das anstrengende Politikerleben benötigt Ausgleich und Kompensation. Zuerst weigert sich Frank, das Gerät zu benutzen, will bei seinen Ego-Shootern an der Video-Konsole bleiben. Dann aber trainiert er verbissen. Zusammen mit Claire geht er auch spät in der Nacht joggen. In III,13 taucht das Rudergerät wieder auf. Claire und Frank dürfen nun nicht mehr joggen, weil die Sicherheitsleute Bedenken haben. Francis bellt Claire die 500-Meter-Ruderzeit zu, die sie schlagen muss. Irgendwann joggt Claire dann wieder, und Francis steigt auf einen Fahrrad-Hometrainer um.
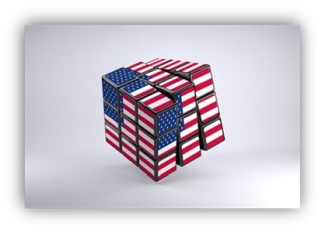 Es hieße, Frank Underwood zu unterschätzen, wenn man seine Art, Politik zu treiben, für unreflektiert hielte. Selbstverständlich denkt Frank über seine eigene Politik nach, und er weiß auch genau, was er unternimmt. An mehreren Stellen nennt Underwood seine Politik einen „ruthless pragmatism“ (III,11 u.ö.). Pragmatismus verweist auf die amerikanische Tradition einer Philosophie im Gefolge von John Dewey und anderen, Orientierung an Handeln und Alltag, nicht an Begriffen, Theorien und Abstraktion, am täglichen Leben und seinen Routinen, an der Demokratie und ihren praktischen Institutionen. „Ruthless“ bezieht sich im Gegensatz zum durchaus werteorientierten Pragmatismus darauf, dass Underwoods Handeln sich ausschließlich an seiner eigenen Karriere orientiert. Dafür würde er zur Not auch seine eigene Frau Claire opfern, obwohl ihn mit ihr eine Partnerschaft verbindet, in der die beiden gegenseitig diejenigen sind, die einander in politischer Hinsicht (nur in dieser!) völlig verstehen.
Es hieße, Frank Underwood zu unterschätzen, wenn man seine Art, Politik zu treiben, für unreflektiert hielte. Selbstverständlich denkt Frank über seine eigene Politik nach, und er weiß auch genau, was er unternimmt. An mehreren Stellen nennt Underwood seine Politik einen „ruthless pragmatism“ (III,11 u.ö.). Pragmatismus verweist auf die amerikanische Tradition einer Philosophie im Gefolge von John Dewey und anderen, Orientierung an Handeln und Alltag, nicht an Begriffen, Theorien und Abstraktion, am täglichen Leben und seinen Routinen, an der Demokratie und ihren praktischen Institutionen. „Ruthless“ bezieht sich im Gegensatz zum durchaus werteorientierten Pragmatismus darauf, dass Underwoods Handeln sich ausschließlich an seiner eigenen Karriere orientiert. Dafür würde er zur Not auch seine eigene Frau Claire opfern, obwohl ihn mit ihr eine Partnerschaft verbindet, in der die beiden gegenseitig diejenigen sind, die einander in politischer Hinsicht (nur in dieser!) völlig verstehen.
 Der skrupellose Pragmatismus Underwoods spielt sich im Verborgenen, nicht in der Öffentlichkeit ab. Sehr viel Kraft verwendet Underwood darauf, in der Öffentlichkeit als glänzender Saubermann dazustehen. Noch mehr Kraft verwendet er darauf, alles, was ihm schaden könnte, zu verbergen. Er ist nicht einfach ein korrupter Politiker, er ist ein korrupter Politiker mit einem glänzenden Marketingkonzept. Deswegen tauchen in einem Nebenstrang, der sich durch sämtliche Staffeln zieht, eine Reihe von Journalisten auf, die alle den Machenschaften Underwoods hinterherschnüffeln
Der skrupellose Pragmatismus Underwoods spielt sich im Verborgenen, nicht in der Öffentlichkeit ab. Sehr viel Kraft verwendet Underwood darauf, in der Öffentlichkeit als glänzender Saubermann dazustehen. Noch mehr Kraft verwendet er darauf, alles, was ihm schaden könnte, zu verbergen. Er ist nicht einfach ein korrupter Politiker, er ist ein korrupter Politiker mit einem glänzenden Marketingkonzept. Deswegen tauchen in einem Nebenstrang, der sich durch sämtliche Staffeln zieht, eine Reihe von Journalisten auf, die alle den Machenschaften Underwoods hinterherschnüffeln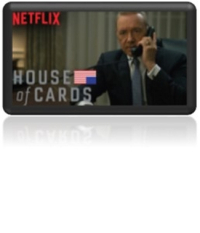
 einer anderen Stelle beruft sich Underwood dafür auf den vierten Akt von Shakespeares „King Lear“. In V, 11 sagt Frank: „History has a way of looking better than it was. Or perhaps Shakespeare was right: we’re all just madmen leading the blind.” Das stammt aus dem vierten Akt von „King Lear“ und erinnert im Übrigen an das Wort Jesu in Lk 6,39: „[Jesus] sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?“ Ob nun Shakespeare oder doch die Bibel: Die Menschen können aus eigener Kraft kein gutes Leben führen. Wenn es so ist, dann kann man sich entweder trotzdem an diesem guten Leben oder an einer politischen Ethik versuchen, aber man wird dabei scheitern. Oder man akzeptiert die eigene Bosheit und die Bosheit anderer. Diesen zweiten Weg geht Underwood, und er belegt mit dem Shakespeare Zitat ein weiteres Mal die Tendenz zu einem nihilistischen Pragmatismus, der auf der Bosheit des Menschen beruht.
einer anderen Stelle beruft sich Underwood dafür auf den vierten Akt von Shakespeares „King Lear“. In V, 11 sagt Frank: „History has a way of looking better than it was. Or perhaps Shakespeare was right: we’re all just madmen leading the blind.” Das stammt aus dem vierten Akt von „King Lear“ und erinnert im Übrigen an das Wort Jesu in Lk 6,39: „[Jesus] sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?“ Ob nun Shakespeare oder doch die Bibel: Die Menschen können aus eigener Kraft kein gutes Leben führen. Wenn es so ist, dann kann man sich entweder trotzdem an diesem guten Leben oder an einer politischen Ethik versuchen, aber man wird dabei scheitern. Oder man akzeptiert die eigene Bosheit und die Bosheit anderer. Diesen zweiten Weg geht Underwood, und er belegt mit dem Shakespeare Zitat ein weiteres Mal die Tendenz zu einem nihilistischen Pragmatismus, der auf der Bosheit des Menschen beruht. Sie kämpft mit ihrer krebskranken, verbitterten Mutter, die zurückgezogen in einem Herrenhaus in Texas lebt und die eigene Tochter sowie den verhassten Schwiegersohn jahrzehntelang nicht gesehen hat. Das Verhältnis Claires zu ihrer Mutter ist genauso zerrüttet wie dasjenige von Frank zu seinem toten Vater.
Sie kämpft mit ihrer krebskranken, verbitterten Mutter, die zurückgezogen in einem Herrenhaus in Texas lebt und die eigene Tochter sowie den verhassten Schwiegersohn jahrzehntelang nicht gesehen hat. Das Verhältnis Claires zu ihrer Mutter ist genauso zerrüttet wie dasjenige von Frank zu seinem toten Vater.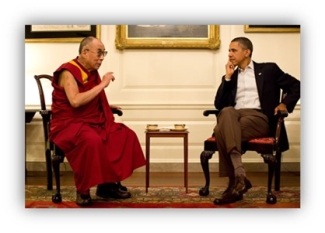 Der von Frank entwickelt skrupellose Pragmatismus neigt nicht zu religiösen Ausschweifungen. Franks politische Philosophie steht gegen eine aufgeklärte Idealisierung der Vernunft, und sie verhält sich agnostisch gegenüber aller Religion, was sich im pietätlosen Verhalten Franks auf dem Friedhof am Grab seines Vaters andeutete.
Der von Frank entwickelt skrupellose Pragmatismus neigt nicht zu religiösen Ausschweifungen. Franks politische Philosophie steht gegen eine aufgeklärte Idealisierung der Vernunft, und sie verhält sich agnostisch gegenüber aller Religion, was sich im pietätlosen Verhalten Franks auf dem Friedhof am Grab seines Vaters andeutete. Selbst in diesem Fall ist es allerdings so, dass Franks Haltung gegenüber der Religion nicht einfach auf einen plumpen Agnostizismus und die politische Erfüllung öffentlich erwarteter zivilreligiöser Pflichten reduziert werden kann. In I,3 hält Frank selbst solch eine zivilreligiöse Ansprache bei der Beerdigung eines jungen Mädchens, die sich in den üblichen homiletischen Bahnen von Trauer und Tragik bewegt: „And while God may not give us any answers, He has given us the capacity for love. Our job is to love Him without questioning His plan. So I pray to you, dear Lord, I pray to you to help strengthen our love for you.” Das ist aber nur eine Aussage, die für die Öffentlichkeit bzw. in diesem Fall für die Trauergemeinde gedacht ist. Wichtiger erscheint eine private Aussage Franks aus einem Gespräch mit dem Industriellen Raymond Tusk: „I said to my professor: ‚Why mourn the death of presidents, or any one of that matter? The dead can’t hear us.’ And he asked me if I believed in heaven. I said ‘No’. And then he asked me if I had no faith in God? I said: ‘You have it wrong; it’s God who has no faith in us.’” (I,12) Diese Anekdote geht über einen bloßen Agnostizismus hinaus. Frank muss diese Pointe wichtig sein, denn sonst hätte er sie nicht aus seinem Studium behalten. Danach ist das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen korrumpiert. Die Menschen können Gott nicht verstehen, und Gott hat den Glauben an die Menschen verloren. Es könnte Gott geben, aber er ist an den Menschen verzweifelt und kümmert sich nicht mehr um sie. Das entspricht der bereits entwickelt These von der konstitutiven anthropologischen Bosheit des Menschen.
Selbst in diesem Fall ist es allerdings so, dass Franks Haltung gegenüber der Religion nicht einfach auf einen plumpen Agnostizismus und die politische Erfüllung öffentlich erwarteter zivilreligiöser Pflichten reduziert werden kann. In I,3 hält Frank selbst solch eine zivilreligiöse Ansprache bei der Beerdigung eines jungen Mädchens, die sich in den üblichen homiletischen Bahnen von Trauer und Tragik bewegt: „And while God may not give us any answers, He has given us the capacity for love. Our job is to love Him without questioning His plan. So I pray to you, dear Lord, I pray to you to help strengthen our love for you.” Das ist aber nur eine Aussage, die für die Öffentlichkeit bzw. in diesem Fall für die Trauergemeinde gedacht ist. Wichtiger erscheint eine private Aussage Franks aus einem Gespräch mit dem Industriellen Raymond Tusk: „I said to my professor: ‚Why mourn the death of presidents, or any one of that matter? The dead can’t hear us.’ And he asked me if I believed in heaven. I said ‘No’. And then he asked me if I had no faith in God? I said: ‘You have it wrong; it’s God who has no faith in us.’” (I,12) Diese Anekdote geht über einen bloßen Agnostizismus hinaus. Frank muss diese Pointe wichtig sein, denn sonst hätte er sie nicht aus seinem Studium behalten. Danach ist das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen korrumpiert. Die Menschen können Gott nicht verstehen, und Gott hat den Glauben an die Menschen verloren. Es könnte Gott geben, aber er ist an den Menschen verzweifelt und kümmert sich nicht mehr um sie. Das entspricht der bereits entwickelt These von der konstitutiven anthropologischen Bosheit des Menschen.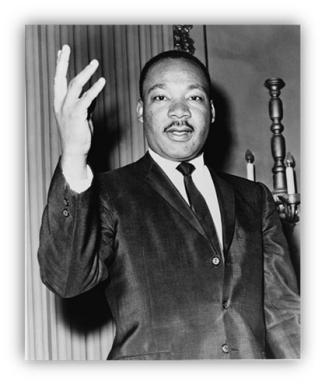 Neben Frank äußert sich auch Claire über ihre religiösen Vorstellungen, ausgerechnet aus dem Anlass der Beerdigung des toten Frank. In VI,3 reden Claire und die undurchsichtig zwielichtige Staatssekretärin Jane Davis über Franks Beerdigung und über trauernde Witwen, denn Jane Davis hat ebenfalls ihren Mann verloren. „Jane Davis: You say that, but I detect pain in your eyes, Madame President. ‘As a deer longs for streams of water...’” Das ist der Anfang von Psalm 42, und als christlich erzogenes Südstaaten-Mädchen hat Claire diesen Psalm selbstverständlich auswendig gelernt. Sie kann also ergänzen: „Claire Underwood: "...so I long for you, God." Darauf fragt Jane Davis: “Do you miss him?” Und alle Zuschauer denken selbstverständlich, dass diese Frage auf den toten Frank gemünzt ist. Aber Claire antwortet: „Claire Underwood: ‘God? Always.’” Hier formuliert das Drehbuch in wunderbarer Doppeldeutigkeit. Claire fehlt der Partner, der für sie Rivale, Orientierung, Kooperator war. Claire fehlen aber auch die moralischen Vorgaben, die Spiritualität, um sich wenigstens an einigen übrig gebliebenen Werten festhalten zu können. Insofern besitzt diese kurze Gesprächspassage eine gewisse Verwandtschaft mit Franks Collegeerzählung vom Gott, der nicht an die Menschen glaubt.
Neben Frank äußert sich auch Claire über ihre religiösen Vorstellungen, ausgerechnet aus dem Anlass der Beerdigung des toten Frank. In VI,3 reden Claire und die undurchsichtig zwielichtige Staatssekretärin Jane Davis über Franks Beerdigung und über trauernde Witwen, denn Jane Davis hat ebenfalls ihren Mann verloren. „Jane Davis: You say that, but I detect pain in your eyes, Madame President. ‘As a deer longs for streams of water...’” Das ist der Anfang von Psalm 42, und als christlich erzogenes Südstaaten-Mädchen hat Claire diesen Psalm selbstverständlich auswendig gelernt. Sie kann also ergänzen: „Claire Underwood: "...so I long for you, God." Darauf fragt Jane Davis: “Do you miss him?” Und alle Zuschauer denken selbstverständlich, dass diese Frage auf den toten Frank gemünzt ist. Aber Claire antwortet: „Claire Underwood: ‘God? Always.’” Hier formuliert das Drehbuch in wunderbarer Doppeldeutigkeit. Claire fehlt der Partner, der für sie Rivale, Orientierung, Kooperator war. Claire fehlen aber auch die moralischen Vorgaben, die Spiritualität, um sich wenigstens an einigen übrig gebliebenen Werten festhalten zu können. Insofern besitzt diese kurze Gesprächspassage eine gewisse Verwandtschaft mit Franks Collegeerzählung vom Gott, der nicht an die Menschen glaubt.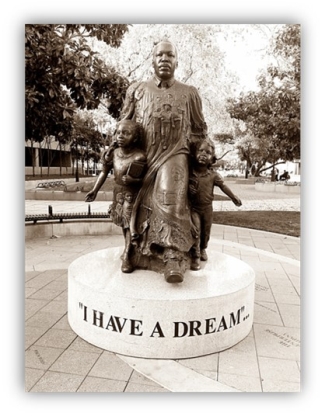 Bei Frank allerdings fehlt eine positive Formulierung dessen, was an die Stelle des abwesenden, vom Menschen befremdeten Gottes tritt. Bei Claire ist das der Fall. Sie sagt in der letzten Staffel: „Everything happens exactly as it should.” (VI,4) Der Fatalismus, der aus diesem Satz spricht, ist das exakte Komplement der Vorherrschaft der Kontingenz, die Frank und Claire an anderer Stelle in den Vordergrund rücken. „Flipism“, Kontingenz und Fatalismus bilden die nicht-religiöse Religion, der dieses politische Ehepaar anhängt. Sie entsteht aus der Enttäuschung über einen (christlichen) Gott, der nicht in die Geschichte eingreift und genauso aus der Einsicht, dass einzelne Menschen, besonders einzelne Politiker auf den Ablauf der Dinge viel weniger Einfluss haben als sie sich in der Regel selbst zugestehen.
Bei Frank allerdings fehlt eine positive Formulierung dessen, was an die Stelle des abwesenden, vom Menschen befremdeten Gottes tritt. Bei Claire ist das der Fall. Sie sagt in der letzten Staffel: „Everything happens exactly as it should.” (VI,4) Der Fatalismus, der aus diesem Satz spricht, ist das exakte Komplement der Vorherrschaft der Kontingenz, die Frank und Claire an anderer Stelle in den Vordergrund rücken. „Flipism“, Kontingenz und Fatalismus bilden die nicht-religiöse Religion, der dieses politische Ehepaar anhängt. Sie entsteht aus der Enttäuschung über einen (christlichen) Gott, der nicht in die Geschichte eingreift und genauso aus der Einsicht, dass einzelne Menschen, besonders einzelne Politiker auf den Ablauf der Dinge viel weniger Einfluss haben als sie sich in der Regel selbst zugestehen. Von kleinen Reiben schaben sie farbige Pulver direkt auf eine quadratische Tischfläche. Claire und Frank laufen mehrfach daran vorbei und wundern sich darüber. Später schenkt Claire – nicht zufällig sie - Frank ein Foto des fertigen Mandalas, denn der Präsident hatte es im fertigen Zustand nicht gesehen. Das Mandala haben die Mönche, wie es Brauch ist, kurz nach der Fertigstellung zerstört, das heißt aufgewischt und das Pulver in einem Krug gesammelt. Mit diesem Krug gingen sie zu einem Bach in einem Wald und verstreuten das Pulver im Wasser. Im Mandala wird ein regelmäßiges, farbiges und kompliziertes Muster in langer Arbeit gebildet und wieder zerstört, ein Symbol für die vorübergehende Ordnung des Kosmos (der Politik? der Demokratie?), für Vergänglichkeit, aber auch für das Kartenhaus, das der Serie den Titel gab und am Ende wieder in sich zusammen fällt. Das Bild von der sorgfältig präparierten Ordnung des Mandala, das geplant wieder zerstört wird, passt sehr gut zur Theorie von Flipism und Pragmatismus, welche den Versuch macht, politisches Handeln unter den Bedingungen einer chaotischen Welt zu begründen.
Von kleinen Reiben schaben sie farbige Pulver direkt auf eine quadratische Tischfläche. Claire und Frank laufen mehrfach daran vorbei und wundern sich darüber. Später schenkt Claire – nicht zufällig sie - Frank ein Foto des fertigen Mandalas, denn der Präsident hatte es im fertigen Zustand nicht gesehen. Das Mandala haben die Mönche, wie es Brauch ist, kurz nach der Fertigstellung zerstört, das heißt aufgewischt und das Pulver in einem Krug gesammelt. Mit diesem Krug gingen sie zu einem Bach in einem Wald und verstreuten das Pulver im Wasser. Im Mandala wird ein regelmäßiges, farbiges und kompliziertes Muster in langer Arbeit gebildet und wieder zerstört, ein Symbol für die vorübergehende Ordnung des Kosmos (der Politik? der Demokratie?), für Vergänglichkeit, aber auch für das Kartenhaus, das der Serie den Titel gab und am Ende wieder in sich zusammen fällt. Das Bild von der sorgfältig präparierten Ordnung des Mandala, das geplant wieder zerstört wird, passt sehr gut zur Theorie von Flipism und Pragmatismus, welche den Versuch macht, politisches Handeln unter den Bedingungen einer chaotischen Welt zu begründen. ‚House of Cards‘ kreist um das doppelte Zentralgestirn der beiden Underwoods. Daneben tauchen eine Reihe von Satellitenpersonen auf, die manchmal sehr dunkel und undurchsichtig bleiben wie die Ministerin Jane Davis, manchmal nur eine Staffel bestimmen wie die Journalistin Zoe Barnes oder der Abgeordnete Peter Russo. Dazu kommen andere Personen, die über die Staffeln hinweg immer wieder erscheinen. Dazu zählen der Kreml-Chef Petrov, der Journalist Tom Hammerschmidt oder der Lobbyist Remy Danton. Ihrer aller Beitrag hier zu analysieren, würde den Rahmen dieses Essays sprengen: Dadurch würde aber das weit verzweigte Netzwerk der beiden Underwoods sichtbar, das für ihre Art, Politik zu betreiben ganz entscheidend ist. Als zweites würde deutlich, dass Vertrauen und Misstrauen gegenüber den eigenen Mitarbeitern für die beiden Underwoods die zentrale Ambivalenz ist, mit der sie anderen Menschen gegenübertreten.
‚House of Cards‘ kreist um das doppelte Zentralgestirn der beiden Underwoods. Daneben tauchen eine Reihe von Satellitenpersonen auf, die manchmal sehr dunkel und undurchsichtig bleiben wie die Ministerin Jane Davis, manchmal nur eine Staffel bestimmen wie die Journalistin Zoe Barnes oder der Abgeordnete Peter Russo. Dazu kommen andere Personen, die über die Staffeln hinweg immer wieder erscheinen. Dazu zählen der Kreml-Chef Petrov, der Journalist Tom Hammerschmidt oder der Lobbyist Remy Danton. Ihrer aller Beitrag hier zu analysieren, würde den Rahmen dieses Essays sprengen: Dadurch würde aber das weit verzweigte Netzwerk der beiden Underwoods sichtbar, das für ihre Art, Politik zu betreiben ganz entscheidend ist. Als zweites würde deutlich, dass Vertrauen und Misstrauen gegenüber den eigenen Mitarbeitern für die beiden Underwoods die zentrale Ambivalenz ist, mit der sie anderen Menschen gegenübertreten.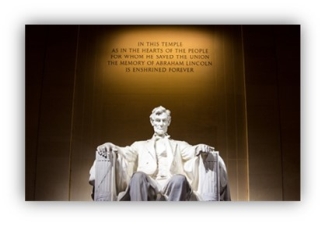 Neben Doug Stamper und Tom Yates wären noch eine Reihe weiterer Mitarbeiter des politischen Paares Underwood vorzustellen, genauso eine Reihe der Politiker, Abgeordnete, Parteikollegen, Minister, mit denen sich die Underwoods heftige Auseinandersetzungen liefern. Aber dieser Überblick soll konsequent so angelegt bleiben, dass er von den Nebenfiguren diejenigen heraushebt, die symbolisch hoch besetzt sind und bei denen die entscheidende Frage nach Loyalität, Vertrauen und Misstrauen gestellt werden kann. Dazu gehören der Sicherheitsbeamte Ed Meechum, der Rippchengriller Freddie Hayes und die Außenministerin Catherine Durant.
Neben Doug Stamper und Tom Yates wären noch eine Reihe weiterer Mitarbeiter des politischen Paares Underwood vorzustellen, genauso eine Reihe der Politiker, Abgeordnete, Parteikollegen, Minister, mit denen sich die Underwoods heftige Auseinandersetzungen liefern. Aber dieser Überblick soll konsequent so angelegt bleiben, dass er von den Nebenfiguren diejenigen heraushebt, die symbolisch hoch besetzt sind und bei denen die entscheidende Frage nach Loyalität, Vertrauen und Misstrauen gestellt werden kann. Dazu gehören der Sicherheitsbeamte Ed Meechum, der Rippchengriller Freddie Hayes und die Außenministerin Catherine Durant.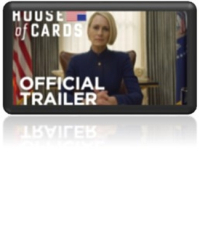 Langsam erkennt Frank in der fünften Staffel, dass er den ehelich-politischen Zweikampf mit Claire verloren hat. Er erklärt sich bereit zurückzutreten. Aber er stellt die Bedingung, dass er sofort nach seinem Rücktritt begnadigt wird. Dabei aber zögert Claire. In einer ersten Reaktion brennt Frank vor Wut eine Zigarette an der amerikanischen Flagge im Oval Office. Einer der Sterne, die für die Bundesstaaten stehen, ist nun in der Mitte angekokelt (V,13). Claire wird das in einer späteren Folge entdecken und sich sehr darüber wundern.
Langsam erkennt Frank in der fünften Staffel, dass er den ehelich-politischen Zweikampf mit Claire verloren hat. Er erklärt sich bereit zurückzutreten. Aber er stellt die Bedingung, dass er sofort nach seinem Rücktritt begnadigt wird. Dabei aber zögert Claire. In einer ersten Reaktion brennt Frank vor Wut eine Zigarette an der amerikanischen Flagge im Oval Office. Einer der Sterne, die für die Bundesstaaten stehen, ist nun in der Mitte angekokelt (V,13). Claire wird das in einer späteren Folge entdecken und sich sehr darüber wundern. Frank hat vor seinem Tod ein neues Testament geschrieben, in dem er sein ganzes Erbe Doug Stamper vermacht (VI, 3-5), was für die sechste Staffel eine dauernde Rivalität zwischen Claire und Doug hervorbringt und am Ende zu einer Schlussszene führt, in der Doug erstochen im Schoß der Präsidentin liegt.
Frank hat vor seinem Tod ein neues Testament geschrieben, in dem er sein ganzes Erbe Doug Stamper vermacht (VI, 3-5), was für die sechste Staffel eine dauernde Rivalität zwischen Claire und Doug hervorbringt und am Ende zu einer Schlussszene führt, in der Doug erstochen im Schoß der Präsidentin liegt. Als Serie hat „House of Cards“ unter den Zuschauern, aber auch in den wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Serie beschäftigt haben, viel Bewunderung hervorgerufen. Dabei wurde die neue Art des Erzählens in den Vordergrund gerückt. Gleichwohl kam zur Bewunderung auch eine Menge Kritik. Soweit ich sehe, sind die theologischen und die politischen Aspekte der Serie bisher kaum beachtet worden. In meiner Perspektive rückt die Kontingenz des Politischen als entscheidendes Thema in den Mittelpunkt. Mit seinem skrupellosen Pragmatismus entwickelt Frank Underwood einen neuen Politikstil, der als Kritik des politischen Moralismus, der Rechthaberei und des Schwarz-Weiß-Denkens verstanden werden kann, genauso als Kritik einer positionell missverstandenen öffentlichen Theologie. Bei den Underwoods wird Unberechenbarkeit zum entscheidenden Moment der Politik, und dieses kann mit einem Pragmatismus besser bewältigt werden als mit einem prinzipiellen Moralismus. Es geht nun nicht darum, die Unmoral um der eigenen Machterhaltung willen (die Morde an Zoe Barnes, Peter Russo und Rachel Posner) als legitimes Mittel der Politik zu verstehen. Die Serie lebt in dieser Hinsicht von einer erheblichen Übertreibung. Es geht eher um einen Begriff von Politik der das Abwägen von Alternativen, die allesamt auch Nachteile nach sich ziehen, in das politische Kalkül einzubeziehen. Am Ende dieses Essay soll dann nochmals gefragt werden, ob diese Reflexionen Möglichkeiten bereitstellen, moralisierende und positionalistische Engführungen der öffentlichen Theologie zu überwinden oder wenigstens zu erweitern.
Als Serie hat „House of Cards“ unter den Zuschauern, aber auch in den wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Serie beschäftigt haben, viel Bewunderung hervorgerufen. Dabei wurde die neue Art des Erzählens in den Vordergrund gerückt. Gleichwohl kam zur Bewunderung auch eine Menge Kritik. Soweit ich sehe, sind die theologischen und die politischen Aspekte der Serie bisher kaum beachtet worden. In meiner Perspektive rückt die Kontingenz des Politischen als entscheidendes Thema in den Mittelpunkt. Mit seinem skrupellosen Pragmatismus entwickelt Frank Underwood einen neuen Politikstil, der als Kritik des politischen Moralismus, der Rechthaberei und des Schwarz-Weiß-Denkens verstanden werden kann, genauso als Kritik einer positionell missverstandenen öffentlichen Theologie. Bei den Underwoods wird Unberechenbarkeit zum entscheidenden Moment der Politik, und dieses kann mit einem Pragmatismus besser bewältigt werden als mit einem prinzipiellen Moralismus. Es geht nun nicht darum, die Unmoral um der eigenen Machterhaltung willen (die Morde an Zoe Barnes, Peter Russo und Rachel Posner) als legitimes Mittel der Politik zu verstehen. Die Serie lebt in dieser Hinsicht von einer erheblichen Übertreibung. Es geht eher um einen Begriff von Politik der das Abwägen von Alternativen, die allesamt auch Nachteile nach sich ziehen, in das politische Kalkül einzubeziehen. Am Ende dieses Essay soll dann nochmals gefragt werden, ob diese Reflexionen Möglichkeiten bereitstellen, moralisierende und positionalistische Engführungen der öffentlichen Theologie zu überwinden oder wenigstens zu erweitern. Doch zuvor soll neben dem Ehepaar Underwood noch eine weitere Figur in den Vergleich einbezogen werden. Im Vergleich zwischen der Kunstfigur Frank Underwood, und dem Lordsiegelbewahrer Thomas Cromwell, aus dem Hilary Mantel wieder eine Kunstfigur gemacht hat, ergeben sich trotz der Differenz zwischen 16. und 21. Jahrhundert eine frappierende Menge von Gemeinsamkeiten. Auch Cromwell verfolgt einen durch Kontingenz bestimmten Begriff von Politik, in dem sich Ergebnisse nur durch Pragmatismus und den Verzicht auf moralische und theologische Rechthaberei erzielen lassen. Cromwell muss dafür einen hohen Preis bezahlen. Es macht seine politische Größe aus, dass er das vorher kommen sah.
Doch zuvor soll neben dem Ehepaar Underwood noch eine weitere Figur in den Vergleich einbezogen werden. Im Vergleich zwischen der Kunstfigur Frank Underwood, und dem Lordsiegelbewahrer Thomas Cromwell, aus dem Hilary Mantel wieder eine Kunstfigur gemacht hat, ergeben sich trotz der Differenz zwischen 16. und 21. Jahrhundert eine frappierende Menge von Gemeinsamkeiten. Auch Cromwell verfolgt einen durch Kontingenz bestimmten Begriff von Politik, in dem sich Ergebnisse nur durch Pragmatismus und den Verzicht auf moralische und theologische Rechthaberei erzielen lassen. Cromwell muss dafür einen hohen Preis bezahlen. Es macht seine politische Größe aus, dass er das vorher kommen sah.