
Kult(ur)ort Padua
|
Der Kongress springt in die LimmatBeobachtungen zum XVII. Kongress der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie vom 5.9-8.9.2021 in ZürichWolfgang Vögele
Ohne Ironie: Zürich ist eine gelungene Mischung aus glücklicher Lage an See und Fluss, aus reformierter Geschichte, protzig zur Schau gestellter ökonomischer Überlegenheit und einer Überfülle von Kultur, die Historie, Moderne und helvetischen Lokalkolorit miteinander ins Gespräch bringt. Wer Texte lesen und deuten will, muss den Kontext wahrnehmen. Wer Kongresse veranstaltet, muss Vorträge, Podien und Pausengespräche in einen urbanen Kontext vermitteln. Und in Zürich war das mit Leichtigkeit möglich: das Großmünster und Bullingers Pfarrhaus, die Raddampfer auf dem Zürichsee, die Limousinen auf der Uferstraße, das Haus der Kunst und das Museum Rietberg, die Souvenirläden mit Schweizer Uhren, Schweizer Taschenmessern und drei- bis viereckigen Tafeln Schweizer Schokolade, die manchmal als Dessert nach allzu abstrakten Vorträgen nötig waren. Eine glückliche Mischung aus Konzentration und Ablenkung. Um zur Theologie zurückzukommen: Der Kongress war in diesem Jahr durch Pandemie und Bahnstreik zeitweise gefährdet, aber diese Schwierigkeiten im Vorfeld bewältigte die Organisation unter der Leitung des Zürcher Alttestamentlers Konrad Schmid außerordentlich gut. Die Tagung fand präsentisch statt, und es war außerordentlich angenehm, sich nicht nur als Kachel oder Briefmarke gegenüber zu sitzen. Wer am Eingang Test oder Impfausweis vorzeigen konnte, erhielt ein farbiges Armbändchen wie in der Disco und konnte sich innerhalb der Tagungskirche ohne Maske bewegen. Wer nur digital teilnehmen wollte, konnte einen Livestream nutzen. Auch sonst waren – eher ungewohnt - eine Reihe von Änderungen zu spüren: Die alten Ordinarien, welche die letzten Kongresse dominiert hatten, waren nicht mehr zu sehen – oder nur noch als gut gelaunte Emeriti in hellem Sommeranzug und Panama. Schon bei den Grußworten am Sonntag wusste der Präsident der Zürcher Kirche rhetorisch geschickt das in käfigartigen Schwimmbädern erlaubte Schwimmen in der Limmat zu nutzen; er verband es humorvoll mit hilfreichen Reflexionen zur beratenden Rolle der Theologie in der Kirche. Beim Kongressthema der Heiligen Schriften kam leider auf den ersten Blick soviel Neues nicht zum Vorschein. Die altbekannten Positionen der Schleiermacher, Troeltsch, Barth und Ebeling spiegelten sich in den Vorträgen ihrer späten Epigonen. Die Theologie ist noch nicht viel weiter gekommen, als den aufgeklärten Gegensatz zwischen Kritik und Erbauung zu konstatieren – und danach zu ignorieren. Aber vielleicht täuschte das auch. Die Frömmeren, oft solche mit kirchlichen Nebenämtern, nehmen die Bibel als Heilige Schrift ernst. Die kritischeren Exegeten verstehen sie als zu kontextualisierende, religionsgeschichtliche Literatur. Die Jüngeren reden von Materialität der Text, von Grammatologie, Symbolen und Monumenten. Aber auch das, obwohl es gelegentlich noch nicht richtig durchdacht wirkte, war neu für diese Art von Kongressen. Es gehört zu den hervorragenden Verdiensten der (theologischen) Kongressorganisation, dass man sich vorsichtig der jüngeren Generation öffnete, als Rednern wie als Teilnehmern. Denn positiv zu bewerten war die große Zahl junger Menschen im Publikum. Studierende, Docs und Post-Docs ließen gar nicht erst den Eindruck entstehen, hier beschäftige sich eine minoritäre Versammlung überalterter akademischer Mandarine mit einem Spezialthema, das eigentlich vor vierzig Jahren aktuell war. Nicht zu unterschätzen war auch das wunderbare Wetter, das am Ende eines verregneten Sommers die Zürcher Bürgerinnen und Bürger und nicht weniger die Teilnehmer erfreute und gnädig stimmte, denn es gab ihnen Gelegenheit, das orientierende Gespräch in den Kongresspausen auch auf Vorplätzen, Bänken und Straßencafés, beim Spaziergang am Limmatufer und an der Seepromenade zu pflegen.
Ich stellte am Tag vor dem Kongress ein Foto des Fraumünsters auf meinen Instagram-Kanal, in der Hoffnung, es würde bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf ein wenig Resonanz stoßen. Aber so weit ist es dann doch noch nicht: Auf dem bilderlastigen, aber jugendlichen Instagram ist die wissenschaftliche Theologie noch nicht angekommen. Alle Universitätstheologen – Fundamentalisten und Evangelikale waren ja nicht anwesend – waren sich in Zürich einig über ein kritisches Modell von Exegese und Hermeneutik, das historische Kontextualisierung mit aktueller Gegenwartsbedeutung von Texten verband. Man stimmte grosso modo in folgendem überein: In der Theologie geht Wissenschaftlichkeit vor Klerikalismus. Kritischer Exegese ist der Vorzug zu geben vor erbaulicher Frömmigkeit oder vorauslaufender klerikaler Loyalität. Die Unterschiede lagen sämtlich in den Nuancen. Eigentlich ist es wie in der Medizin: Wer heilt, hat Recht. Die einen favorisieren einen postmodernen Methodenpluralismus nach dem Motto: Wer plausibel deutet, soll das machen; die anderen schränken diesen Pluralismus ein auf eine kleine Zahl zugelassener theologischer Verfahren. Und in Analogie zur Schulmedizin gibt es eine orthodoxe Schultheologie, die die Texte nur mit dem Goldstandard approbierter theologischer Methoden an-deutet, selbstverständlich mit universitärer Chefarztbehandlung. Die jüngeren Leute, besonders wenn sie noch studieren oder promovieren, denken da nicht mehr so streng wie die etablierten Alten und öffnen sich einer komplementären Theologie, so wie die komplementäre Medizin die Schulmedizin ergänzt und eben inzwischen auch Platz an den Universitäten findet. Im Folgenden will ich einige nicht-repräsentative Gedanken aus einer Auswahl von Referaten und Sektionsvorträgen herausgreifen. Nachdem man am Sonntagabend die Grußworte überstanden hatte, hielt der systematische Theologe Jörg Lauster den Eröffnungsvortrag über das „Uneingelöste Versprechen der historischen Kritik heiliger Schriften“. Dem Münchener Ordinarius traute man die ausgreifende Richtlinienkompetenz für das Kongressthema zu. Er entwickelte – wie zu erwarten – eine große und brillante Verteidigung historischer Kritik, die sich mit Friedrich Nietzsche auseinandersetzte, der den Menschen als erkennendes Tier verstand, das die Relativität seiner Erkenntnisse nicht richtig zu begreifen vermag. Für Nietzsche war darum Kritikfähigkeit eine Sekundärtugend und Wahrheit – als anthropologische Konstante - eine Illusion. Demgegenüber betonte Lauster die konstruktive Seite der Kritik sowie ihre Fähigkeit, das selbstgeschärfte Instrumentarium auf die eigene wissenschaftliche Tätigkeit anzuwenden. Nur mit Hilfe von Kritik könne die Wissenschaft (theologische wie philologische) zu einem besseren und angemesseneren Verständnis von Texten (heiligen wie unheiligen) kommen. Die Theologie muss vor diesem Hintergrund gegen die ökonomische Funktionalisierung der Universität und gegen ihre klerikale Funktionalisierung durch Dogmatik verteidigt werden. Das Schriftprinzip beförderte Lauster deswegen am Ende seines Vortrags in die Klamottenkiste verstaubter Konfessionskrieger. So sehr diese Interpretation sympathisch erscheinen mag, bleibt bei Lauster doch die Frage offen, inwiefern Tätigkeit der Kritik nicht durch eine Hermeneutik ergänzt werden muss, welche den Texten eine Alltagsorientierung in Hinsicht auf Glaubensgewissheiten und religiöse Überzeugungen entnimmt. Denn diese Wertentscheidungen gewinnen ihre Plausibilität in einem Dreieck aus Texttreue, persönlichen Überzeugungen und der in Gemeinden und Kirchen als Bekenntnissen für normativ erklärten Texte. Lauster stoppte nach fünfzig Minuten beim Lob der Kritik, aber da blieben noch viele Fragen offen, die aber an den folgenden Tagen wenigstens im Ansatz beantwortet wurden. Albrecht Beutel, Münster, konnte am folgenden Tag zeigen, dass der Gegensatz zwischen Kritik und Erbauung schon die Theologen der Aufklärung in erbitterte Kontroversen führte. Wichtiger noch aber schien mir am Montag der Beitrag der Religionspädagogin Martina Kumlehn aus Rostock, die für die Religionspädagogik (und die praktische Theologie) von einer Art konvergierendem Dualismus zwischen (historischer) Kritik und (aktueller) Religionslegitimation sprach. Religion als Schulfach müsse sich angesichts der westlich-europäischen Religionskrisen erst einmal neu beweisen. Kumlehn verstand die praktische Theologie als Teil eines „spätmodernen Krisenmanagements“ der Religion. Krisenmanagement benötige insbesondere der Protestantismus, der seine Gestalt – mindestens in der Religionspädagogik - in einem methodischen Pluralismus finde, der von der Narrativität, Performanz, Phänomenologie bis zur Rezeptionsästhetik reiche. Das erfordere eine „mehrperspektivisch-kritische“ Auseinandersetzung mit den Themen Schrift, Kritik und Hermeneutik. Es gehe darum, „Sinn für den Sinn von Religion“ (so in einem Zitat von Michael Domsgen) zu wecken. Deutlich wurde, dass Kumlehns Sympathien eher bei den narrativen Zugängen der Hermeneutik lagen. Sie sprach von einer narrativen Identität, die einen Brückenkopf darstellen könne zwischen neuzeitlicher Subjektivität und biblischen Texten. Mir wurde trotzdem an dem Beitrag deutlich, dass der von Kumlehn zur Sprache gebrachte Methodenpluralismus der Hermeneutik keine befriedigende Lösung der Gegenwartsbedeutung von Religion darstellt. Das überfordert den Religionsunterricht, dessen Lehrpersonen unter einer unübersehbaren Vielfalt von methodischen Zugängen ersticken, und das würde nach meiner Überzeugung die Religionen als solche überfordern. Um nochmals die Analogie zur Medizin zu bemühen: Wer zu viele Therapiemöglichkeiten zur Verfügung hat, der kann am Ende keine vernünftige Entscheidung für eine angemessene Therapie (in der Religion für Orientierungs-, Überzeugungs- und Handlungsoptionen) treffen. Und wer zu lange über die Therapie diskutiert, der wird am Ende wortreich – und krank – sterben. In der Sektion für Systematische Theologie wusste mit einem brillanten Vortrag der Theologe Johannes Zachhuber (Oxford) zu überzeugen. Er entwickelte eine systematische Konstellation zwischen historischer Kritik und Hermeneutik, zwischen Text und Geschichte, die er als ein grundsätzliches Problem christlicher Theologie durch die Zeiten hindurch entfaltete. Theologie, nicht nur protestantische, müsse sich stets dazu verhalten, wie sie Texte in ihrem historischen Kontext auslege und wie sie sie in der Gegenwart zur Sprache bringe. Zachhuber wollte dabei nicht zwischen historischer und religiöser Auslegung unterscheiden. Er postulierte so etwas wie einen konzeptuellen Fluchtpunkt, den er eher in der unteilbaren Geschichte als in einem gemeinsamen Kanon von Texten sah. Mit den Stichworten Texte, Kritik, Hermeneutik ist das Koordinatensystem eröffnet, in dem Theologie jeweils ihren Ort suchen muss. Dabei verschieben sich historisch stets die Gewichtungen, aber das Koordinatensystem wird nicht verlassen, es bleibt stets gleich. Eher unwillig versuchte Folkart Wittekind, Essen, dieses Koordinatensystem zu kritisieren, indem er die Theologie auf die hermeneutische Beschreibung religiösen Sinns reduzierte, er sprach von einer „freie[n] Bereichshermeneutik religiöser Sprache“. In der Diskussion gebrauchte er die Formulierung, die Theologie sei eine Literaturwissenschaft religiöser Texte. Damit aber, so meine Kritik, verschwindet die Gegenwart religiösen Handelns vollständig, nämlich in der Kritik und Kontextualisierung historischer Texte. Das wäre ja wie eine Germanistik, die vollständig in einer historischen Textwissenschaft ohne Gegenwarts- und vor allem Lesebezug aufginge. Ich konzediere, dass mir hier manches an Wittekinds Gedankengang verloren gegangen sein könnte, da er im Vortrag, der offensichtlich von vornherein zu lang war, mehrfach Kürzungen vornahm, die den Zuhörern nicht richtig plausibel werden konnten. Im dritten Vortrag dieser Sektion suchte Gregor Etzelmüller (Osnabrück) den Schulterschluss zwischen Exegese und Dogmatik, die für ihn beide von der barthianisch formulierten Voraussetzung ausgehen sollten, dass Gott ist. Von dieser Voraussetzung her konnte er sagen: Alles angemessene, gegenwärtige theologische Reden kann nur von der Schrift her kommen. Insofern kann sie, die gegenwärtige Theologie auch noch von der Auferstehung reden, aber nicht mehr als universale, quasi-historische Tatsache, sondern nur noch im Medium einer nachmetaphysischen Theologie als Glaubensaussage. Auf diesem Boden sei eine realistische Theologie zu entwickeln, die argumentiere etsi deus daretur. Etzelmüller musste sich die Rückfrage gefallen lassen, ob der von ihm als Kronzeuge angerufene Karl Barth das Verhältnis von Dogmatik und Exegese stets methodisch so korrekt angewandt hat, wie das sein Interpret in seinen Zürcher Ausführungen entwickelte. Es mag der von den Veranstalter geforderten Kürze seines Vortrags geschuldet sein, dass Etzelmüller nicht mehr auf die Dogmatik als eine Kritik gegenwärtiger religiöser Äußerungen einging, denn nur so wird nach meiner Überzeugung die Aufgabe der Dogmatik vollständig beschrieben. Die (religiöse) Gegenwart lässt sich nicht mit dem Rekurs auf Barths bekanntes Verdikt der Religion als Unglaube abtun. Aber nur so, in einer Kritik der (religiösen) Gegenwart und in einer Kritik der Texte kommt die Dogmatik zu ihrem intellektuell-explikativen Ziel. Der Dienstagmorgen eröffnete mit drei Plenumsvorträgen eine interreligiöse und interkonfessionelle Perspektive. Die interreligiöse Theologin Claudia Jahnel, Bochum, zeigte die Materialität der Bibel am Beispiel eines Exemplars der King James Bibel, das in Papua-Neuguinea im Parlament ausgestellt wird und dort als Symbol für die von der Regierung geförderte kulturelle und politische Unabhängigkeit von Australien fungieren soll. Auf der einen Seite verblüffte das, auf der anderen Seite werden ja auch irgendwann Regierung, Parlamentarier und Bürger von Papua-Neuguinea die Bibel aufschlagen und dann die Texte entdecken, die vielleicht in eine völlig andere Richtung weisen als die genannte Indienstnahme für politische Zwecke. Jahnels Vortrag blieb schuldig, die möglichen Verbindungen zwischen im Westen praktizierter historischer Textkritik und südostasiatischer politischer Symbolisierung zu beleuchten. Sehr vorsichtig näherte sich der orthodoxe Exeget Pedray Dragutinovic, Belgrad, seiner Aufgabe, denn die Texte der Bibel spielten und spielen in der orthodoxen Kirche bei weitem nicht die Rolle wie im reformatorischen Protestantismus. Er konnte zeigen, wie skeptisch darum die kirchliche Hierarchie lange Zeit der als aufklärerisch und westlich verurteilten Textkritik begegnete. Über Texte und Wörter gab es im Übrigen auch in einer Ausstellung aus Anlass des hundertjährigen Geburtstags des Pfarrers und Dichters Kurt Marti[1] Erstaunliches zu sehen und zu lernen. Im Strauhof, keine hundert Meter von der Tagungskirche St. Peter entfernt, war eine kleine Schau zu sehen, die im Erdgeschoß die Manuskripte von Martis „Wortwarenladen“ zeigte. Man nahm staunend wahr, wie Marti, der reformierte Berner Pfarrer, in einer Mischung aus Bürokratie und Poesie Listen führte, in denen er für Begriffe wie Himmel, Natur, Kirche, Politik Lektürefunde zusammentrug: Er sammelte in Tabellen Metaphern, Bilder und gelungene Formulierungen, die im Kontext der Ausstellung zum ersten Mal publiziert wurden[2]. Es ist nicht klar, ob Marti selbst je an eine Publikation gedacht hat. Die drei Räume im Obergeschoß, die den Themen Erotik, Tod und Politik, im Ausstellungsjargon: Eros, Endlichkeit und Engagement, konnten zwar durch einige Ton- und Bilddokumente punkten, brachten aber gegenüber Martis eigenen Veröffentlichungen (Leichenreden etc.) nichts wesentlich Neues. Martis unerschrocken bürokratische, nachhaltige Suche nach gelungenen Formulierungen weckt im Nachdenken auch bereichernde Ausweitungen auf das Kongressthema, das ja auf Kritik, historische Einordnung und Aktualisierung bezogen war. Eine Integration/Kooperation der Ausstellung mit dem Kongress hätte die wissenschaftlichen Zugänge zu sprachlicher und historischer Kritik noch um eine wesentliche poetische Dimension bereichert – genauso wie im Übrigen die weltkulturellen Exponate des oberhalb des Sees gelegenen Rietbergmuseums einen Beitrag zu kritischer, interkultureller Theologie hätten leisten können.
Christiane Tietz schließlich nahm sich in ihrem Schlussvortrag zum einen nochmals die Perspektiven vor, die ihre Vorreferenten aufgetan hatten, zum anderen orientierte sie sich an der mittlerweile leider oft belächelten Hermeneutik Hans-Georg Gadamers, der betonte, dass der historisch kontextualisierte Text noch nicht richtig verstanden ist. Es bedürfe darüber hinaus der Frage nach seiner Wahrheit, die im gelungenen Fall in einer „Horizontverschmelzung“ zwischen Vergangenheit und Gegenwart münde. Wissenschaftlich-methodisch lässt sich das für Gadamer allerdings nicht mehr darstellen, dazu bedarf es einer Hermeneutik, die als Kunst begriffen wird. Nur als Artist, als Künstler kann der verstehende und lesende Mensch zum „Fänger des Balles“ (Rilke) werden. Menschen der Gegenwart, so Tietz, leben stets aus einer Vergangenheit von Texten heraus. Der Hermeneutik als Aufgabe des Verstehens kann deshalb sowieso niemand entkommen. Am Anfang ihres Vortrags kündigte Tietz an, deswegen Hermeneutik als kirchenbezogene Wissenschaft herauszupräparieren. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich diesen Teil nicht mehr hören konnte, denn ich musste meinen Zug nach Deutschland erreichen. Aber wie auch immer Christiane Tietz diesen Teil entfaltet hat – er wird im Kongressband nachzulesen sein -, sie brachte eigentlich als erste der Vortragenden, die ich in den drei Tagen hörte, das Stichwort der Ekklesiologie in den Tagungsraum. Und damit würde sich wieder die Anfangsfrage Lausters stellen: historische Kritik als voraussetzungslose freie wissenschaftliche Tätigkeit oder Kritik in Bindung an eine aktualisierende, hermeneutische Interpretationsgemeinschaft wie die evangelischen Kirchen? Die theologischen Alternativen (liberal – positiv, Troeltsch – Barth, dialektische – lutherische Theologie, postmodern - traditionell) des 19. und 20. sind auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht ausgeräumt, aber sie nehmen jetzt eine andere, neue Gestalt an. Wenn man mit den Kirchen hermeneutisch argumentieren will, so ist gewiss nicht an den Bevormundungsklerikalismus zu denken, der innerhalb der Kirchen leider immer noch nicht völlig ausgelöscht ist.[3] Kurzum: Das verjüngende Bad in der Limmat erwies sich für die Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie als ein belebender Jungbrunnen, was ja wissenschaftlichen Vereinigungen – im Gegensatz zu Dozenten und Studierenden – durchaus möglich ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Verjüngungsprozess fortsetzt, wenn der Kongress in drei Jahren das nächste Mal tagt. Positiv stimmt ein, dass die Wissenschaftliche Gesellschaft den Wechsel zwischen Alexanderplatz (säkularisiert), Strudlhofstiege (ultramontan) und Bahnhofstraße (reformiert) aufgegeben und den nächsten Kongress im Jahr 2024 an „der Vaterlandsstädte Ländlichschönste“ (Hölderlin) vergeben hat. Es ist zu hoffen, dass das vielfach besungene Neckarwasser[4], die bereits von Martin Heidegger ins existentiale Geviert eingeordnete Alte Brücke sowie das Weinfass des Hofzwerges Perkeo wie bei den Sehenswürdigkeiten an der Limmat ausgenutzt wird, um mit Hilfe des Heidelberger genius loci die Theologie weiter zu verjüngen und argumentativ zu schärfen. Anmerkungen[1] Dazu schon Wolfgang Vögele, Zoom-Blick auf den Dichter-Pfarrer. Über Kurt Marti und eine Tagung der Theologischen Fakultät Bern zu seinem 100. Geburtstag, tà katoptrizómena, H.2, Nr. 130, 2021, https://www.theomag.de/130/wv067.htm. [2] Kurt Marti, Wortwarenladen, Zürich 2021. [3] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Kirchenkritik. Beiträge zu Kirchentheorie, praktischer und ökumenischer Theologie, KirchenZukunft konkret 12, Münster u.a. 2019. [4] Historisch-autobiographische Andeutungen dazu in Wolfgang Vögele, Onkel Ernst und die portugiesischen Revolutionäre. Warum und in welchem Umfeld ich in den achtziger Jahren Theologie studierte, tà katoptrizómena, H. 129, Februar 2021, https://theomag.de/129/wv063.htm. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/133/wv072.htm |
 Die Kongresse der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie finden in der Regel alle drei Jahre statt, wechselnd zwischen Berlin, Wien und Zürich. Berlin gab sich stets mondän gelangweilt und säkularisiert, im erzkatholischen Wien wurde die Diaspora evangelischer Theologen gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Beim gerade zu Ende gegangenen XVII. Kongress der Gesellschaft (5.9.-8.9.2021) zeigte sich, dass in Zürich das Thema des Kongresses, „Heilige Schriften in der Kritik“, und die theologisch-historische Kultur des Tagungsortes auf schönste Weise miteinander harmonierten: In der Altstadt sind die Spuren Ulrich Zwinglis und Heinrich Bullingers überall zu sehen. Der wegen der Epidemie um ein Jahr verschobene Kongress konnte wegen Terminüberschneidungen nicht an der Universität stattfinden, sondern musste für sein Plenum auf die Altstadtkirchen Frauenmünster und St. Peter mit dem großen Ziffernblatt der Turmuhr ausweichen. Zwischen See und Limmat, zwischen Altstadtgassen, Bahnhofstraße und Straßenbahnlinien, zwischen Mengen von Radfahrern, Touristen und Bankangestellten war es schwierig, sich zu verlaufen. In der Kantonsmetropole reichen die Kirchtürme, um sich zu orientieren. Auf der Bahnhofstraße und in den Gassen drumherum waren zu Dutzenden hochglanzlackierte Benziner-Limousinen aus Untertürkheim, Zuffenhausen und Maranello röhrend zu hören, alle auf der Suche nach teuren Parkplätzen. Der Bürger des großen Kantons nimmt irritiert-amüsiert zur Kenntnis, dass die Parkgebühren offensichtlich in Relation zum Kaufpreis der teuersten herumfahrenden Limousinen bestimmt werden.
Die Kongresse der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie finden in der Regel alle drei Jahre statt, wechselnd zwischen Berlin, Wien und Zürich. Berlin gab sich stets mondän gelangweilt und säkularisiert, im erzkatholischen Wien wurde die Diaspora evangelischer Theologen gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Beim gerade zu Ende gegangenen XVII. Kongress der Gesellschaft (5.9.-8.9.2021) zeigte sich, dass in Zürich das Thema des Kongresses, „Heilige Schriften in der Kritik“, und die theologisch-historische Kultur des Tagungsortes auf schönste Weise miteinander harmonierten: In der Altstadt sind die Spuren Ulrich Zwinglis und Heinrich Bullingers überall zu sehen. Der wegen der Epidemie um ein Jahr verschobene Kongress konnte wegen Terminüberschneidungen nicht an der Universität stattfinden, sondern musste für sein Plenum auf die Altstadtkirchen Frauenmünster und St. Peter mit dem großen Ziffernblatt der Turmuhr ausweichen. Zwischen See und Limmat, zwischen Altstadtgassen, Bahnhofstraße und Straßenbahnlinien, zwischen Mengen von Radfahrern, Touristen und Bankangestellten war es schwierig, sich zu verlaufen. In der Kantonsmetropole reichen die Kirchtürme, um sich zu orientieren. Auf der Bahnhofstraße und in den Gassen drumherum waren zu Dutzenden hochglanzlackierte Benziner-Limousinen aus Untertürkheim, Zuffenhausen und Maranello röhrend zu hören, alle auf der Suche nach teuren Parkplätzen. Der Bürger des großen Kantons nimmt irritiert-amüsiert zur Kenntnis, dass die Parkgebühren offensichtlich in Relation zum Kaufpreis der teuersten herumfahrenden Limousinen bestimmt werden.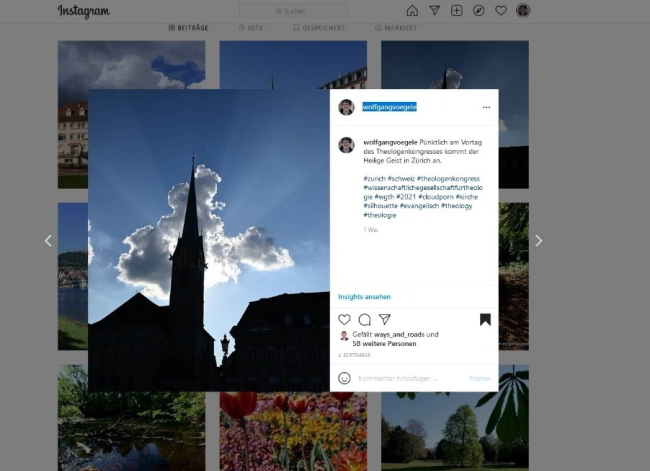
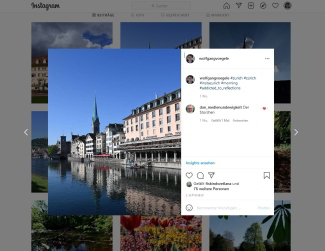 Der Schlussvormittag am Mittwoch verblüffte am Anfang dadurch, dass die diensthabende Moderatorin die beiden zuerst referierenden Exegeten als „Textbeamte“ charakterisierte. Ich konnte das nicht für einen sachdienlichen Hinweis halten. Manuel Vogel, Jena, gelang es, ebenso witzig wie geschickt, Gegenwarts- und Vergangenheitsbezüge historischer Kritik sowie auch ihre unleugbar emotionale Dimension auf den Punkt zu bringen. Er sprach, unausgesprochen gegen die berüchtigte „Hermeneutik des Verdachts“ gerichtet, von einer „Hermeneutik des guten Willens“, die aufruht auf exegetischer Irrtumsfähigkeit und Fehlbarkeit und sich darum stets der Konkurrenz rivalisierender Auslegungen stellt, zum Beispiel was die Zweiquellentheorie angehe. Kritik braucht ein relativierendes Moment, und Vogel zeigte am eigenen Beispiel, wie Ironie und Humor nicht zu den unwirksamsten Medikamenten gehören, solche Selbstrelativierung herbeizuführen, selbst wenn es um so Banales wie den Kauf eines Küchenbüffets geht. Christian Schüle, Leipzig, plädierte danach sehr überzeugend für ein Neben- und Ineinander von Hermeneutik und Kritik, das in Erfahrung, Erwartung und Erinnerung auf die drei Zeitdimensionen von Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit bezogen ist.
Der Schlussvormittag am Mittwoch verblüffte am Anfang dadurch, dass die diensthabende Moderatorin die beiden zuerst referierenden Exegeten als „Textbeamte“ charakterisierte. Ich konnte das nicht für einen sachdienlichen Hinweis halten. Manuel Vogel, Jena, gelang es, ebenso witzig wie geschickt, Gegenwarts- und Vergangenheitsbezüge historischer Kritik sowie auch ihre unleugbar emotionale Dimension auf den Punkt zu bringen. Er sprach, unausgesprochen gegen die berüchtigte „Hermeneutik des Verdachts“ gerichtet, von einer „Hermeneutik des guten Willens“, die aufruht auf exegetischer Irrtumsfähigkeit und Fehlbarkeit und sich darum stets der Konkurrenz rivalisierender Auslegungen stellt, zum Beispiel was die Zweiquellentheorie angehe. Kritik braucht ein relativierendes Moment, und Vogel zeigte am eigenen Beispiel, wie Ironie und Humor nicht zu den unwirksamsten Medikamenten gehören, solche Selbstrelativierung herbeizuführen, selbst wenn es um so Banales wie den Kauf eines Küchenbüffets geht. Christian Schüle, Leipzig, plädierte danach sehr überzeugend für ein Neben- und Ineinander von Hermeneutik und Kritik, das in Erfahrung, Erwartung und Erinnerung auf die drei Zeitdimensionen von Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit bezogen ist.