
Eine Neubewertung des reformatorischen BilderstreitsZur Bildethik von Jérôme CottinAndreas Mertin |
||||
Das Wort Gottes im Bild
In einem dreifachen Durchgang nähert sich Cottin dem Thema und kommt schließlich zu einem höchst interessanten, aber auch problematischen Schluss für die Gegenwart. Teil A: "Das Bild im kulturellen und gesellschaftlichen Leben"Im ersten Teil geht es um "Das Bild im kulturellen und gesellschaftlichen Leben" (S. 29-86) und zwar in semiologischer, philosophischer und soziologischer Perspektive. Überprüft und geklärt werden soll, was ein Bild eigentlich ist, ohne vorschnell bei theologischen Bestimmungsversuchen einzusetzen. Dazu greift Cottin vor allem auf die französische medienkritische Bilddiskussion aus den 80er Jahren zurück, die inzwischen allerdings selbst schon wieder ein Stück Theoriegeschichte geworden ist.[6] Im Abschnitt "Von der Imitation zur Bedeutung" (S. 31-41) geht es um eine semiologische Bestimmung des Bildes. Stichworte dieser Überlegungen sind Analogie, Totalität und Polysemie. Danach ist das Bild eine "bedeutungstragende Form ... Es wird erst eigentlich dadurch zum Bild, dass ein Wort es als solches benennt und bezeichnet ... Es gibt keine bildliche Darstellung ohne sprachliche Bedeutung." (S. 41) Diese Voraus-Setzung hat natürlich Folgen für die gesamte weitere Argumentation. Sie sieht sich aber zugleich gravierender Infragestellungen aus dem Bereich der Bild- und Kunsthermeneutik ausgesetzt.[7] Im Abschnitt "Vom Objekt zur Technik" (S. 42-56) geht es um die Materialität des Bildes. Man kann "das Bild im Sinne einer Entwicklung mit drei Etappen beschreiben: Die Stofflichkeit liegt der Gestaltung zugrunde, die ihrerseits die Bedeutung hervorbringt." (S. 47) Mit der Erfindung der Fotografie ändert sich Grundlegendes. Sie führt zu einer Art "technischer Objektivität", enthält ein "Referenzobjekt im Bild" und führt die vielfache "Reproduzierbarkeit" ein. "Die Fotografie stellt nicht nur eine bemerkenswerte technische Erfindung dar, sondern durch sie ist es auch zur Entstehung einer ganz neuen Art von Bild gekommen. Durch die Fotografie hat sich ... nicht nur unser Verhältnis zum Bild gewandelt, sondern zugleich auch unser Verhältnis zu uns selbst und zur Welt." (S. 51) Im Abschnitt "Vom Bild zur Ideologie" (S. 57-70) geht Cottin - hier insbesondere Baudrillard und Virilio folgend - der Veränderung des Bildes vom Objekt-Bild zum Bild als Ideologie nach. Demnach "basiert das, was wir heute gemeinhin 'Bild' nennen, nicht auf einer historischen, sondern auf einer ideologischen Struktur. Das Bild ist nicht mehr nur plastische - anfassbare und gestaltete - Wirklichkeit ... sondern ein abstraktes Konzept." (S. 57f.) Während Bilder früher dem Gebrauch dienten, sind sie heute ein Zeichen, das man konsumiert, wodurch das Objekt zerstört wird.[8] Letztlich gilt: "Das Bild wird zur wirklichen Welt, die es zu imitieren gilt ... Das Bild gibt nicht mehr das Leben wieder, sondern das Leben gibt das Bild wieder." (S. 66). Die Folgen dieses Prozesses lassen sich mit den Stichworten Entwirklichung, das Spektakuläre und Ästhetisierung beschreiben. Cottin fasst die Implikationen dieser Entwicklung so zusammen: "Man meint, die Wirklichkeit intensiver zu erleben; tatsächlich aber lebt man in einer Welt der Bilder, die nichts weiter als eine imaginäre Welt ist. Man meint, man lebe in einer Welt des Visuellen, dabei lebt man in einer virtuellen Welt." (S. 70) Es fragt sich jedoch, ob damit in der Folge der marxistisch inspirierten Soziologen und Philosophen die Mediatisierung der Welt nicht pessimistischer beschrieben wird, als sie sich tatsächlich darstellt.[9] Gegen die Apokalyptiker wäre daran festzuhalten, dass die Mediatisierung der Welt und der Bildkonsum auch anders - das heißt wesentlichen positiver gelesen und gedeutet werden kann und muss.[10] Im abschließenden Abschnitt "Vom Imaginären zum Wirklichen" (S. 71-84) geht es nun noch einmal um eine theologische Bewertung. Dazu wirft Cottin einen Blick auf einen theologischen Ikonoklasten (Jacques Ellul) und einen theologischen Ikonodulen (Pierre Babin), gegenüber denen er dann einen dritten Weg jenseits idealistischer Ablehnung und realistisch-pragmatischer Anpassung gehen will: "Es gilt den existentiellen Sinn hinter dem visuellen Zeichen zu entdecken. Darum ist es notwendig, in der Flut der Bilder zu unterscheiden zwischen denen, die nur verweisen, und denen, die einen Sinn tragen. Den Zuviel Bildern ist nicht die Bilderlosigkeit entgegenzusetzen, sondern ein Weniger an Bildern; dem Sichtbaren ist nicht das Unsichtbare entgegenzusetzen, sondern ein anderes Sichtbares. Man könnte hier von einer Bilderaskese sprechen. Nach Bildern fragen muß daher heute heißen, kritisch urteilen zu lernen, um unterscheiden zu können zwischen Bildern, die mit der gelebten Wirklichkeit zu tun haben, und solchen Bildern, die uns in eine nur bezeichnete Wirklichkeit, d.h. in eine imaginäre Wirklichkeit hineinziehen." (S. 81) Teil B: "Das Bild im Kontext trinitarischer Theologie"Im Teil B geht es um "Das Bild im Kontext trinitarischer Theologie" (S. 87-216). Es ist der umfangreichste Teil der Untersuchung, der die biblisch-theologischen Grundlagen untersuchen und darstellen soll. Dabei folgt Cottin dem klassischen dogmatischen Aufbau der Glaubensartikel. Im ersten Abschnitt "Gott: Das Idol zwischen Idee und Objekt" (S. 89-119) geht es vor allem um das Bilderverbot, das in seiner Genese und seiner theologischen Bedeutung nachgezeichnet wird. "Die theologische Bedeutung dieses ersten Teils des Dekalogs besteht darin, dass hier die Gottheit Jahwe allen Versuchen des Menschen, sich das Göttliche durch Humanisierung anzueignen, entzogen wird." (S. 96). Nach Cottin hat das Bilderverbot zwar eine ethische, keineswegs aber eine ästhetische Bedeutung (S. 97).[11] Hier wäre indes meines Erachtens weniger nach dem faktischen Gehalt des Bilderverbots (also was es zu seiner Zeit bedeutete) als nach seiner Gedächtnisspur[12] (also wie es im Laufe der Geschichte verstanden wurde) zu fragen, die nun allerdings (bis in die Kunst und Philosophie des 20. Jahrhunderts hinein) in eine ganz andere Richtung weist.[13] Im Blick auf die "rituale Achse" geht es dann um das Verständnis des Bildes, also darum, ob das Bild verboten ist oder nur jene Geisteshaltung, die es als Kultbild deutet. Cottin sieht Letzteres als zutreffend an.[14] Im zweiten Abschnitt "Der Mensch: Das Bild als relationales Konzept" (S. 120-139) geht es um die Imago-Dei-Lehre und ihre Bedeutung für die Bilderfrage. An dieser Stelle braucht seine Darstellung der biblisch-theologischen Grundlagen nicht paraphrasiert zu werden. Es reicht den praktischen Konsequenzen nachzugehen. Nach Cottin gibt es keine unmittelbare Verbindung von Gottesebenbildlichkeit und gestaltetem Bild (S. 132). Dadurch werden vor allem platonische Missverständnisse abgewiesen, die nach dem Muster von Urbild und Abbild arbeiten - in der frühen Bilder-Theologie ein beliebtes Modell. Zugleich wird so auch eine Ikonentheologie vermieden. Indirekt sieht Cottin allerdings eine Verbindung von Gottesebenbildlichkeit und Bild, insofern das Bild ganz auf die Seite des Menschen verwiesen wird. "Das Bild hat also eine Existenz, aber eine entsakralisierte ... Darum ist es streng genommen nicht möglich, eine Bildtheologie zu formulieren. Dagegen lässt sich aber eine Bildethik entwerfen." (S. 135) Es gehe letztlich um eine Theologie der Wirklichkeit, die das Bild mit einbeziehen müsse. Dabei gilt es aber auch, theologisch die Grenzen des Bildes zu benennen. Diese bestimmt Cottin so: "Das Bild von der Gottesebenbildlichkeit her zu verstehen, heißt eine theologische Entscheidung zu treffen, und zwar für das, was wirklich ist, gegen das Imaginäre, für die Geschichte gegen Wunsch- und Trugbilder, für die Körperlichkeit gegen den Idealismus, für die Macht des Konkreten gegen die Bedeutungslosigkeit der Abstraktion." (S. 137)[15] Die zweite Grenze des Bildes ist nach Cottin, dass Bilder theologisch keine Spur, sondern allenfalls Zeichen sein können. "Bilder von Gott sind erlaubt, wenn sie als Zeichen gedacht sind und nicht als Spuren." (S. 138) Nun ist das aber, entgegen der impliziten Unterstellung durch die Art der Formulierung Cottins, ja kein Problem der Produktion, sondern eines der Rezeption, also eine rezeptionsästhetische Frage. Es geht darum, ob Bilder von Gott als Zeichen oder als Spuren wahrgenommen werden. Das ist aber eben nicht mehr zu steuern. Insofern sind alle Bilder von Gott erlaubt und verboten zugleich.[16] Der dritte Abschnitt "Christus: Das Kerygma als alleiniger Mittler" (S. 140-166) geht den Veränderungen nach, die für die Bilderfrage durch Christus entstehen.[17] Dabei geht es zunächst um die Bedeutung, die der paulinischen Formulierung von Christus als Bild Gottes zukommt. "Wo ist ... die Sichtbarkeit der Inkarnation zu verorten? Natürlich im Sakrament, wobei allerdings präzisiert werden muß, wo im Sakrament, wenn man der 'objektivistischen' Gefahr entgehen will, die darin besteht, den Stoff selbst - Brot, Wein, Wasser - zum sichtbaren Ort der Inkarnation zu machen. Die Sichtbarkeit Gottes unter den Menschen findet sich nicht in den Elementen des Sakraments, sondern in der Begegnung zwischen Gott und den um diese Elemente versammelten Menschen. Die Verbindung von Gottes Unsichtbarkeit und seiner Gegenwart in der Welt ist nicht ästhetischer sondern theologischer Natur, insofern als der Glaube nicht eine Größe der Schöpfung sondern der Beziehung ist."(S. 157) In der praktischen Auswertung der christologischen Überlegungen und in Auseinandersetzung mit der Position Karl Barths skizziert Cottin drei elementare Modelle kirchlichen-theologischen Umgangs mit dem Bild:  Wichtig ist ihm dabei, dass der Umgang mit dem Bild in protestantischer Perspektive nicht von Grundannahmen des orthodoxen Modells ausgehen darf, was Cottin Barth vorhält. Dieser bleibe in seiner Kritik immer noch dem orthodoxen Modell verhaftet und sei nicht in der Lage, einen spezifisch protestantischen Zugang wahrzunehmen. Über Barth hinauszugehen sei daher dahingehend, "dass sich Bild möglicherweise auf das Kerygma gründet" bzw. sich von ihm herleitet (S. 162). An dieser Stelle geht Cottin unter Bezug auf entsprechende Überlegungen Horst Schwebels[18] der Möglichkeit nach, ästhetische Erfahrung als religiöse Erfahrung zu verstehen.[19] Gegenüber Schwebels Modell, das von einem Gegenüber von Bild und Kerygma ausgeht (eine "Ellipse mit zwei Brennpunkten"), bevorzugt Cottin das Modell der konzentrischen Kreise: "Das Kerygma breitet sich im Lauf der Geschichte in unendlich vielen konzentrischen Kreisen aus, die verschiedenen Sprachschichten entsprechen, zu denen das Bild ebenso gehört wie das Wort." (S. 165) Der Weg von Christus zum Bild stellt sich daher folgendermaßen dar: Christus -> Kerygma -> Interpretation -> Bild. Das entlastet das Bild zwar einerseits von religiösen Aufladungen, lässt aber andererseits die Frage der Wahrung seiner (künstlerischen) Autonomie verschärft aufbrechen. Der vierte Abschnitt "Die Bedeutung: Eine vom Geist erleuchtete Hermeneutik" (S. 167-182) nähert sich nun dem Kern der Argumentation und bereitet zugleich den nachfolgenden Abschnitt zum Heiligen Geist vor.[20] Cottin folgt hier in seinen Ausführungen im Wesentlichen den Überlegungen Paul Ricoeurs. Der Sache nach geht es um das theologische Verhältnis von Bedeutung und Zeichen und nicht zuletzt um das Verstehen dessen, was Gottes Wort heißt. Der sich eng anschließende fünfte Abschnitt "Der Geist: Das Wort, das offen ist zum Sichtbaren" (S. 183-213) geht nun dem Zusammenhang der Lehre vom Geist mit der Frage nach dem Bild nach. Dazu erörtert Cottin das biblische Zeugnis und dessen theologische Deutung durch Calvin, Barth und Tillich. In der praktischen Auswertung geht es Cottin darum, "die Linien von Calvins Pneumatologie weiter auszuziehen" um "unsere negative Bildbewertung neu "zu bedenken" (S. 203). Wenn man "die Verknüpfung von Bildpraxis und Theologie des Geistes beschreibt, dann muss man folgende Ausrichtung beachten: nicht: Bild -> Geist, sondern Geist -> Bild. Es gibt also keine Spiritualität des Bildes und noch viel weniger heilige Bilder, sondern nur ein Wirken des Geistes, das sichtbar macht" (S. 206). Auffallend ist, dass bei Cottin dem Bild immer etwas vorgängig ist. Den Ertrag seiner Untersuchung im Teil B fasst Cottin so zusammen: "Für diesen theologischen Durchgang war ein trinitarisches Gerüst notwendig, denn nur der trinitarische Gott ermöglicht eine theologische Verknüpfung von Wort und Bild. Durch die Trinität ergeben sich drei Perspektiven, von denen jede einen eigenen und zugleich komplementären Blickwinkel auf das Bild beiträgt: der Vater verbietet, aber Christus ermöglicht und der Geist fordert das Bild. Es handelt sich also um eine aufsteigende Linie der Bildhaftigkeit: das verbotene Bild, sodann das Mensch gewordene Bild und schließlich das in seinem Recht anerkannte Bild ... Eine Konsequenz, die sich aus dem theologischen Durchgang zur Bilderfrage für eine Kirche des Wortes ergeben hat, soll hier gezogen werden: Es hat sich gezeigt, dass der in der protestantischen Theologie immer wieder beschworene Gegensatz zwischen Wort und Bild eine erstaunlich geringe theologische Relevanz und eine ähnlich schwache biblische Begründung hat ... Wort und Bild als Gegensätze zu verstehen (protestantische Tendenz) oder aber im Gegenteil keinen beachtenswerten Unterschied zu erkennen (katholische Tendenz) - beides geht, so will es scheinen, auf dasselbe objektivistische Denken zurück ... Das biblische Denken ist weder objektivistisch noch subjektivistisch, sondern eschatologisch: Es eint die Gegensätze oder, besser noch, stellt eine dialektische Verknüpfung her: Gegenwart und Abwesenheit, Sichtbares und Unsichtbares, Mensch und Gott, Leben und Tod sind nicht mehr Gegensätze, die sich in einer hoffnungslosen Konfrontation gegenüberstehen; sie werden überholt und ersetzt durch jene gewaltige Hoffnungsbewegung, die den Namen Jesu Christi trägt ... Eine Kirche, die wahrhaft Kirche des Wortes sein will, muß für die visuelle Dimension, das heißt für das Leben in seiner Wirklichkeit und Fülle offen sein." (S. 214f.) Teil CIm Teil C geht es um die "Neubewertung des reformatorischen Bilderstreits" (S. 217-302). Dabei geht Cottin von drei Beobachtungen aus: 1. Die Reformation war überall ikonoklastisch; 2. Der Ikonoklasmus erweist sich als durchaus hartnäckig; 3. Heute lässt es sich nicht gut mit diesem Ikonoklasmus, dieser ablehnenden Haltung, leben (S. 217f.).[21] Letzteres begründet Cottin mit dem von der Gesellschaft und den anderen Kirchen erhobenen Vorwurf des protestantischen Bilderdefizits. Statt dessen wäre natürlich genauso plausibel nach dem Wahrheitswert des fortdauernden Ikonoklasmus innerhalb des Protestantismus zu fragen. Es könnte ja sein, dass sich darin eine Erkenntnis aufbewahrt, die kulturkritisch in die Gesellschaft einzubringen wäre und deren Gehalt auch von der bildenden Kunst der Gegenwart und den Nachbarreligionen Islam und Judentum vehement verfochten wird.[22] Zudem wäre noch einmal verstärkt zu differenzieren zwischen einer generell ikonoklastischen Haltung (die dem Protestantismus eben nicht unterstellt werden kann)[23] und einer spezifisch ikonoklastischen Haltung, die sich auf das religiöse Bild im kultischen Kontext bezieht. Im ersten Abschnitt skizziert Cottin "Das Bild am Vorabend der Reformation" (S. 220-250). Er verweist auf die diversen elementaren Wandlungen, denen sich die Bilder in dieser Zeit gegenübersahen: sie werden angebetet und somit zu Götzenbildern, es gibt technische Neuerungen, die die Abbildfunktion verstärken und es entwickelt sich eine bestimmte Form "visueller Frömmigkeit": "Die Kontemplation eines heiligen Bildes kam der Begegnung mit dem Heiligen selbst gleich" (S. 227). Hierin kann man eine Wieder-Holung der byzantinischen Bilderfrömmigkeit erkennen. Zugleich entwickelt sich mit der Entstehung der Kunst ein neues Bildverständnis, worauf Cottin und Bezugnahme auf Hans Beltings große Studie "Bild und Kult" zutreffend hinweist. Zum ersten Mal beginnt das Bild aus dem kultischen Kontext herauszutreten und autoreferentielle Funktionen zu übernehmen. 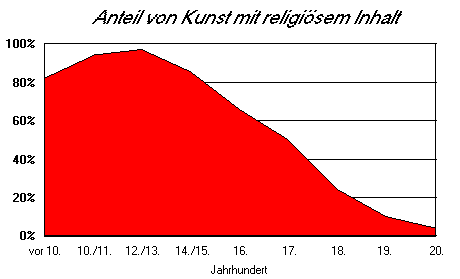 Vorgezeichnet ist dies ideengeschichtlich bereits in den Libri Carolini,[24] kommt aber kulturell erst jetzt zum Austrag. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass der eigentliche Umschlag zur Säkularisierung des Bildes bereits im 12./13. Jahrhundert geschieht. Am Beispiel Albrecht Dürers skizziert Cottin dann die "neue Funktion des Künstlers" in Kultur und Gesellschaft (S. 236-240), um sich schließlich dem Phänomen des Bildersturms bzw. des Ikonoklasmus zuzuwenden (S. 240-250). Der Bildersturm ist einerseits eine gesellschaftliche Protestbewegung, die sich gegen den Missbrauch irdischer Güter durch wenige richtet.[25] Er ist zum zweiten eine revolutionäre, das heißt politische Volksbewegung, die auch die Gesellschaft verändern will. Und erst dann ist der Bildersturm auch eine theologische Bewegung gegen Götzendienst. In den folgenden beiden Abschnitten, "Luther: Bild ohne Ästhetik" (S. 251-273) sowie "Calvin: Ästhetik ohne Bild" (S. 274-299) geht Cottin den Differenzen und Gemeinsamkeiten der beiden Hauptstränge der Reformation nach. Für Luther kann eine sich nach und nach entwickelnde Haltung zum Bild festgestellt werden: Von der dezidierten Ablehnung über eine eher neutrale Haltung (adiaphora!) hin zu einer weitgehend positiven Haltung gegenüber dem Bild. Der Mensch bedarf des Bildes, aber es ist dem Wort untergeordnet, es muss interpretiert, gedeutet werden. Theologisch gilt für Luther, dass das Bild Gott nicht offenbaren kann. Aber das Bild kann nach Luther Gott aussagen, es kann kerygmatische Funktionen erhalten.[26] Das Problem bei Luther besteht darin, dass ihn das Bild als Kunstwerk überhaupt nicht interessiert, er bleibt in dieser Frage dem mittelalterlichen Kosmos verhaftet. Das ist nun bei Calvin etwas anders, dessen Äußerungen Cottin im Anschluss untersucht. Calvin entwickelt eine äußerst kritisch Haltung zum Bild, insofern er als einzige Form das Götzenbild kennt. Wie später bei Karl Barth steht ihm ein Bildverständnis vor Augen, das man am ehesten der orthodoxen Linie zuordnen kann, also dem Bild als Spur. Anthropologisch ist Calvin von einer tiefen Skepsis gegenüber der menschlichen Imagination getragen, die im Wesentlichen Zerrbilder produziert. Sobald Calvin aber auf das Bild jenseits des Religiösen kommt, ändert sich die Tonlage. Hier betont er ausdrückliche die Kunst als göttliche Gnadengabe. Begrüßt werden Historienbilder und "auch körperliche Bilder und Gestalten ohne Bezug auf alles Geschichtliche", das heißt also ästhetische Bilder wie Cottin zutreffend feststellt. Nach Calvin kann das Bild die Schönheit Gottes bezeugen, weshalb Calvin auch eine theologische Ästhetik entwerfen kann: "Ohne Gott je selbst zu vergegenwärtigen, kann das Bild doch ein Zeichen für das Wirken des Geistes in der Welt - und damit indirekt für das Wirken Gottes - sein" (S. 302). Summa summarum gilt nach Cottin für beide reformatorischen Traditionen, dass das Bild immer nur eine Sonderform der Sprache ist und zudem Wort und Bild immer miteinander verbunden sein müssen. SchlussAm Ende zieht Cottin aus dem zuvor Erarbeiteten theologische Konsequenzen, die in fünf Punkten entfaltet werden, von denen die ersten beiden innerprotestantisch einen Common sense bilden sollten, die anderen jedoch einer kontroversen Diskussion bedürfen. 1. Sehen und Hören. Hier gilt, das Wort hören, heißt sehen lernen, denn die Bibel setzt sowohl auf die Sprache des Wortes wie auf die Sprache der Bilder. Eine Entgegensetzung von Wort und Bild ist nicht sachangemessen. 2. Gott sehen? Hier stellt Cottin fest: "Was von Gott in unserer geschichtlichen Zeit sichtbar wird, ist gebunden an Sprache und Zeichen, an Wort und Bild, nicht an eine abrupte Erscheinung, eine plötzliche Vision, ein unmittelbares Erlebnis, eine eindeutige Begegnung von Angesicht zu Angesicht." (S. 306) 3. Gottesbilder sehen. Die Frage "Kann man die christliche Ikonographie ... als locus theologicus bezeichnen?" beantwortet Cottin eindeutig mit Ja. Und sein Argument lautet: "So wie der Diskurs über Gott schriftliche Ausdrucksformen hat, sind Bilder von Gott der visuelle Ausdruck für Gott" (S. 307). Daher sei es "legitim, heute vielleicht sogar notwendig, Gott im Betrachten und genauen Untersuchen seiner bildlichen Darstellungen zu erkennen und zu verstehen zu suchen." Die Frage ist, ob das religiöse Bild, der Differenzierung der kulturellen Moderne folgend, dann nicht am besten zum Design wird. Dem Einwand, dass in der heutigen Kunst keine Gottesbilder mehr auftauchen, begegnet Cottin mit dem Hinweis auf die historische und die außerabendländische Kunst, welche Gott zur Genüge darstelle. Zudem könne die abstrakte Kunst Gott darstellen, ohne ihn abzubilden (S. 308f.). 4. Die Bibel in Bildern sehen. Rundum positiv sieht Cottin den didaktisch begründeten Einsatz der Bilder in Katechese und Unterricht und sieht in dieser ungebrochenen Tradition eine Legitimation, sie auf Predigten auszuweiten.[27] Dass die in didaktischer Perspektive eingesetzten religiösen Bilder in aller Regel nicht den simpelsten Regeln des Kunstdiskurses entsprechen, wird dabei nicht erörtert. 5. Die Welt sehen oder Bilder von der Welt sehen? Zunächst erinnert Cottin daran, dass auch der Calvinismus die weltliche Verwendung von Bildern akzeptiert hat. Weltliche Bilder begegnen uns nach Cottin heute jedoch vor allem als Massenmedienbilder. In religiöser Perspektive müsse der Protestantismus an dieser Stelle aber den Massenmedien entgegentreten und ein "eindeutiges Nein" sagen. "Die Regeln, die die Medienwelt lenken ... (stehen) alle in diametralen Gegensatz zu dem, worauf sich Gemeinschaft gründet, nämlich menschliche (Liebe) und göttliche Grundwerte (Offenbarung Gottes)." Man müsse daher die "vom Medienbild verdrängten menschlichen Werte wieder ans Licht bringen" (S. 312). Diesem Bild multimedialer Kommunikation kann der Rezensent nicht folgen. Zur Kritik der Bildethik CottinsPositiv ist zunächst das Bemühen, die verschiedenen Reformatoren mit ihren jeweiligen Anliegen miteinander ins Gespräch zu bringen, um ihre Begrenztheiten zu überwinden. Positiv zu würdigen ist auch Cottins gelungener Nachweis, dass entgegen aller populärer Vorurteile von einer Bilderfeindlichkeit der evangelischen wie der reformatorischen Theologie in einem strengen Sinne nicht gesprochen werden kann und dass darüber hinaus sogar Ansätze einem positiven Bildgebrauch zu (re-) konstruieren sind. Das kann nicht deutlich genug gesagt werden. Von der Argumentation her gibt es dabei eine Verwandtschaft zu Überlegungen von Eilert Herms, die dieser 1984 unter dem Titel "Die Sprache der Bilder und die Kirche des Wortes"[28] vorgetragen hat, die Cottin aber leider nicht in seine Reflexionen aufgenommen hat. Schon bei Herms war klar erkennbar, dass aus der Perspektive evangelischer Theologie keine grundlegenden Einwände gegen das Bild bestehen können. Insofern muss sich die Kirche des Wortes heute ohne Frage auch in reflektierter Form der Sprache der Bilder bedienen. Ich meine allerdings, dass dies die Evangelische Kirche inzwischen auch konsequent tut - sowohl in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild als auch in ihren Räumen. Gravierende Desiderate - etwa im Vergleich zur katholischen Kirche - kann ich nicht feststellen; jeder Besuch eines Deutschen Evangelischen Kirchentags zeigt pluralistisch-bilderreiche Erscheinungsformen des Protestantismus. Die Frage ist jedoch, ob der Protestantismus es geschafft hat, in seiner Bildpräsenz einen eigenen Stil zu entwickeln oder ob er nicht allzu oft noch den Stil anderer Konfessionen nachahmt.[29] Cottins Studie wäre also über die Frage, ob der Protestantismus Bilder verwenden sollte, weiterzutreiben zur Frage, welche Bilder zum Protestantismus passen. Darüber dürfte ein interessanter Streit entstehen. Davon zu trennen ist aber die Frage nach der bildenden Kunst, welche zu den Überlegungen Cottins eigentümlich quer steht.[30] Cottins Ausführungen sehen sich den gleichen Einwänden ausgesetzt, die auch gegenüber Eilert Herms seinerzeitigen Überlegungen einzubringen waren: dass sich die moderne Kunst nämlich nicht an systematisch-theologische Konzepte hält.[31] Was theologisch möglich ist, ist künstlerisch noch lange nicht geboten. Und nicht nur deshalb wäre ein Kurzschluss vom Bild auf die Bildende Kunst höchst problematisch. Keinesfalls kann davon ausgegangen werden, dass das zum Bild Erarbeitete auf die bildende Kunst übertragen werden kann - ganz im Gegenteil, die zeitgenössische Kunst muß als ästhetische Negativität begriffen werden. Mit Umberto Eco ist davon auszugehen, dass zeichentheoretisch bestimmte Phänomene wie die Malerei bisher noch nicht zureichend theoretisch erfasst sind.[32] Alle Äußerungen von Cottin zur Bildenden Kunst gehen nicht nur an deren Selbstverständnis vorbei, sie verstellen zugleich das zugrunde liegende Problem. Für eine Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst der Gegenwart ist die Erkenntnis, dass sie religiöse Gehalte darstellen darf, ohne auf religiösen Protest zu stoßen, relativ belanglos. Denn für den christlichen Glauben stellt sich ja gerade die Frage, ob er sich nicht inzwischen notwendig den 'extra muros ecclesiae' in der Profanität produzierten und den Glaubenden gegenübergestellten und gegenüberstehenden Bildern in Form der zeitgenössischen Kunst zuwenden muss. Die Herausforderung des Protestantismus ist nicht das Wort Gottes im Bild, sondern die Frage der Möglichkeit einer protestantischen Deutungskultur angesichts einer säkularisierten Kultur. Im Blick auf das Wort Gottes im Bild gilt, was zur Verhältnisbestimmung von Wort und Bild bei Eilert Herms zu sagen war: Ist das ästhetische Zeichen, wie der tschechische Strukturalismus am Beginn des 20. Jahrhunderts gezeigt hat, durch die konsequente Verneinung jeder Mitteilung charakterisiert, ist es m.a.W. autoreferentiell, kann es eben nicht mehr oder nur noch missverständlich als Erinnerungszeichen verstanden werden. Die von Cottin so aufwendig und präzise aufgewiesene Möglichkeit einer Wort-Bild-Relation im Sinne von "Christus è Kerygma è Interpretation è Bild" hat mit der zeitgenössischen bildenden Kunst daher wenig zu tun. Weil "ästhetisch" in seiner gesamten Arbeit fast regelmäßig pejorativ auftaucht, verstellt er sich die Möglichkeit, die im Ästhetischen liegenden - und das heißt grundlegend menschlichen - Potentiale theologisch angemessen zu bewerten. Kritisch finde ich alles in allem - neben Marginalien[33] - vor allem vier Punkte in der Darstellung von Cottin: 1. die fehlende Berücksichtigung der empirisch beschreibbaren lebensweltlichen Bildpraxis des Protestantismus und hier insbesondere des Calvinismus im Gefolge der Reformation; 2. die ausschließlich negative Bewertung heutiger medial vermittelter Bildkultur, die er im ersten Teil seiner Arbeit und dann noch einmal dramatisch verstärkt im Schlussteil vorträgt; 3. das von ihm favorisierte hermeneutische Modell, das zwar das Wort Gottes im Bild erschließt, das sich in seiner Verallgemeinerung aber als Schranke für die Wahrnehmung zeitgenössischer Kunst erweist; 4. das fehlende Verständnis der neuzeitlichen Diskursdifferenzierung zwischen Kunst und Religion, welche eine Fortschreibung christlicher Kunst, wie sie uns Cottin am Ende seines Buches ansinnt, als verfehlt erscheinen lässt. Alle vier Punkte möchte ich im Folgenden kurz explizieren. 1. Calvinismus und Bildkultur
2. Die Kritik der massenmedialen BildkulturCottin kommt zu Verwerfungen heutiger medialer Bildkultur wie der Massenmedien generell, denen ich so nicht folgen kann. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass seine Kritik vor allem auf das Fernsehen zielt und neuere Entwicklungen wie das Internet nicht im Blick hat und auch noch nicht haben konnte. Gerade diese neuen Entwicklungen aber verändern die Verhältnisse eigentümlich, denn sie geben den Subjekten die Möglichkeit, sich nicht nur auf der Ebene der Bilder zunehmend selbst zu artikulieren. Zunächst einmal wäre aber zu bedenken, dass gerade die Kunst, der Cottin in den abschließenden Sätzen seines Buches die Referenz erweist ("das Gespräch, dessen höchste Form die Kunst ist" (S. 313)), sich in den letzten Jahren konsequent den neuen Medien zugewandt hat. Neben der dabei auch zu findenden Medienkritik gibt es viele Künstler und Kunstwerke, die die Welt der Medienbilder kongenial nutzen. Es ist sicher kein Zufall, dass der von Cottin positiv beerbte Kunsthistoriker Hans Belting inzwischen an einer Medienfakultät lehrt und ebenso wenig zufällig ist einer der wichtigsten Orte der Reflexion zeitgenössischer Kunst das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Vor allem möchte ich mit Rafael Capurro darauf verweisen, dass die Differenz zwischen den verschiedenen Medien-Kulturen (personale und technische Medien) nicht so groß ist, wie es scheinen mag. Capurro betont, "dass die Gegenüberstellung zwischen einem medialisierten und einem unmittelbaren zwischenmenschlichen Verhältnis insofern zu relativieren ist, als jede leibhaftige Begegnung wenn nicht ein medialisiertes so doch ein mediatisiertes Verhältnis darstellt ... Ich will aber hiermit keineswegs den Unterschied zwischen dem natürlich-mediatisierten und dem technisch-medialisierten zwischenmenschlichen Verhältnis auflösen. Ich kritisiere lediglich die Gegenüberstellung eines scheinbar unvermittelten face-to-face Verhältnisses im Sinne eines ursprünglich und authentischen menschlichen Verhältnisses im Gegensatz zu einem medialen Miteinander, das wesensmäßig mit dem Makel einer sogar moralischen Verfallsform jenes eigentlichen Verhältnisses behaftet sein soll. Die Möglichkeiten und Grenzen beider Formen des Zusammenseins und ihrer vielfältigen Mischformen müssen von Fall zu Fall und im Hinblick auf die jeweiligen Ziele buchstabiert und vorexerziert werden".[40] Joachim Hörisch hat sich in seiner Mediengeschichte süffisant über das gespannte Verhältnis von Theologie und Medien geäußert. Ihm sei in dieser Frage das letzte Wort erteilt: "Religion wird nicht nur von Kulturkonservativen willig als die Sphäre wahrgenommen, die neumodischen Medien zu widerstehen versucht. Nichts ist abwegiger ... Christliche Theologie ist Teleologie und also Medientheorie. Enge Verwandte aber haben nicht immer ein entspanntes Verhältnis zueinander. Das gilt auch im Hinblick auf das Verhältnis von christlicher Theologie und Medientheorie. Theologie und die christliche Theologie zumal ist - die wenigen Ausnahmen bestätigen die Regel - in dem Maße medienkritisch, in dem sie die Einsicht verdrängt, dass sie Medientheorie ist."[41] 3. Hermeneutik versus NegativitätsästhetikDas im Anschluss an Ricoeur verwendete hermeneutische Modell, so produktiv es in der Erschließung nicht-ästhetischer Texte wie Bilder sein mag, findet nun meines Erachtens gerade an der zeitgenössischen Kunst, m.a.W. an ästhetischer Erfahrung seine Grenze. Zwar ist Cottins Studie keine Theorie der Begegnung von Theologie und Kunst, sondern erörtert das Thema "Bild und Theologie". Insofern er aber aus seiner Studie Schlussfolgerungen im Blick auf die bildende Kunst zieht, ist zu prüfen, ob das dabei zugrundegelegte hermeneutische Modell noch trägt. Im Kern geht es darum, ob "Bedeutung" im klassischen Sinne der Referenz für die Kunst (und hier nicht nur für die bildende Kunst) in Anschlag gebracht werden kann. In den Fällen, in denen Cottin auf bildende Kunst zu sprechen kommt,[42] hebt er immer das Bedeutungsvolle der Kunst hervor, denn "die Verbindung zwischen Kerygma und Bild (vollzieht sich) auf der Ebene der Bedeutung". In diesem Sinne spricht er dann auch von einer Bedeutungshermeneutik. Die Frage ist aber, ob damit nicht Voraussetzungen gemacht werden, die die ästhetische Erfahrung torpedieren. Nun gehört es zu den Gemeinplätzen heutiger Kunsttheorie, als ästhetisch jenen Prozeß zu bezeichnen, "der Identifizierungs- und Bestimmungsversuche erschüttert, irritiert, aussetzt oder verneint."[43] Das aber könnte noch so verstanden werden, dass das Verstehen zwar temporär verzögert wird, um dann doch in einem gelingenden Verstehen von Bedeutung zu terminieren. Christoph Menke ist in seiner Arbeit "Die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida" dem in diesem Punkt kontroversen Verhältnis von Negativitätsästhetik und Hermeneutik nachgegangen. Sein Vorwurf an die hermeneutische Zugangsweise lautet, dass sie auf einer "'strukturellen Heteronomie' beruht: Was sie als Beschreibung der internen Verfasstheit ästhetischer Erfahrung ausgibt - als gelingendes Verstehen -, verdankt sich heteronomen Vorentscheidungen über die externe Funktion der Kunst - als Medium eines zugleich verändernden Wiedererkennens von nichtkünstlerischem Erfahren und Darstellen."[44] Die Negativitätsästhetik Adornos und Derridas beschreibt dagegen "den Status des Kunstwerks durch seine Verweigerung verstehender Aneignung. Negativ nennen sie die Kunst, sofern sie sich in ihrer erratischen Buchstäblichkeit gegen die Übersetzung in ihren Geist, in ihrem freien Signifikantenspiel gegen die Reduktion auf ihre Bedeutung, in ihrer undurchdringlichen Oberfläche gegen die Überschreitung in ein tieferes Wesen sperrt. Damit nehmen Adorno und Derrida zunächst nur ein Motiv auf, das von Anfang an mit der modernen Kunsttheorie verknüpft war: Die Kunst ist eine Weise der Darstellung, die die Hierarchien von Geist und Buchstabe, Allgemeinem und Besonderem, Verstand und Sinnlichkeit überwindet."[45] Ich meine dass Letzteres den Prozeß ästhetischer Erfahrung zutreffend beschreibt. Ist das so, dann ist es ein gewichtiger Einwand gegen die Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus nicht-ästhetischen Prozessen (Bild) auf ästhetische (Kunst). Zumindest im Blick auf die These von der Kunst als visueller Predigt ist somit erhebliche Skepsis angebracht. 4. Christliche Kunst?Damit bin ich beim letzten Punkt meiner Kritik. Gegen die Möglichkeit christlicher Kunst, für die sich Cottin ja engagiert einsetzt, gibt es zunächst die bereits vorstehend erwähnten negativitätsästhetischen Argumente. Selbst wenn in einem Kunstwerk etwas in außerästhetischer Erfahrung als christlich zu Identifizierendes vorhanden wäre, würde es im Prozess ästhetischer Erfahrung unterlaufen. Wenn wir die ästhetische Erfahrung gegenüber einem Objekt geltend machen, verselbständigen wir es gegenüber der Funktion, die es im nichtästhetischen Kontext hatte. Für den religiösen Diskurs bedeutet das zum Beispiel, dass dort, wo die autonom gewordene Kunst sich religiöse Motive aneignet, sie diese in ästhetische Objekte verwandelt, sie aus ihrem Kontext löst und in ihrer Selbstbezüglichkeit darstellt. Deshalb unterscheidet sich das berühmte Urinoir von Marcel Duchamp in ästhetischer Perspektive nicht von einem Farbkissen von Gotthard Graubner, einer Installation von Josef Beuys oder einem Christusbild von Georges Rouault. Wer vor einem Christusbild eine andere Haltung einnimmt als vor dem Urinoir, dem Farbkissen oder einer Installation, verhält sich nicht ästhetisch, er nimmt das Christusbild nicht als Kunstwerk wahr. Selbstverständlich kann man ein Werk unter religiösen Aspekten betrachten - dann ignoriert man aber seinen künstlerischen Charakter und degradiert es zum bloßen Bild, oder man kann es ästhetisch erfahren - dann interessiert seine religiöse Bedeutung nicht. Ästhetische Erfahrung und religiöse Bedeutung schließen sich aus. Ähnliches gilt für die Symbolisierungsleistungen, die Kunstwerken zugeschrieben werden. Auch sie werden von außen bzw. nachträglich an die Kunst herangetragen. Kunstwerke kommen nur dort zu ihrem Recht und entfalten nur da ihre Produktivität, wo sie in ihrem Kunst-Charakter wahrgenommen werden, und ihre Autonomie gewahrt bleibt. Der zweite Einwand, der sich gegen die Rede von der christlichen Kunst wendet, betrifft die - hier nur rhetorisch gestellte - Frage, wie sich denn Kunsthaftes und Religiöses im Kunstwerk zueinander verhalten sollen. Wenn nicht das Ästhetische als solches als Religiöses identifiziert wird (denn dann erübrigte sich ja die Rede von christlicher Kunst), dann kann doch der Prozeß nur so verlaufen, dass eine Fülle von Werken als Kunst erfahren wird und darunter wären dann solche, die aufgrund bestimmter Kriterien als christliche zu bestimmen wären. Das wiederum muss nicht nur auf vehementen theologischen Widerspruch stoßen,[46] es widerstreitet auch elementaren Bestimmungen des Ästhetischen. Das Christliche an der Kunst müsste ja - zumindest für den Gläubigen - von höchstem Interesse sein und würde damit mit dem "interesselosen Wohlgefallen" kollidieren, das Kunstwahrnehmung grundsätzlich charakterisiert. Letztlich handelt es sich bei diesem Einwand um eine Wiederholung jenes Arguments, das schon die Libri Carolini vorgebracht haben. Nach ihnen zählt in der Wahrnehmung der Kunst aufgrund der Zweifelhaftigkeit religiöser Etikettierungen allein die ästhetische Qualität. Anmerkungen
|