
Gegenwartsfragen |
Natur, Sinn und TodWolfgang Vögele
1.Ein bekannter deutscher Fernsehkomiker, mittlerweile 85 Jahre alt, erklärte neulich einem verblüfften Publikum, das ihn gerade als Tänzer und Sänger erlebt hatte: „Das Leben wird ja bestimmt durch zwei Dinge: Geburt und Tod. Und die Zwischenzeit sollte man nutzen.“ Wahrscheinlich war das nur witzig gemeint. Die Sottise, ein harmloser vorbeifliegender Witz, sollte eine langatmige Erklärung ersetzen. Und dennoch versteckt sich in der Bemerkung ein agnostischer Alltagspragmatismus, der sich rotzig und frech religiösen, metaphysischen und theologischen Spekulationen verweigert. Du hast achtzig Jahre, vielleicht ein paar mehr. Mach etwas draus! Verschwende deine Zeit nicht mit allzuviel Nachdenken darüber! Der Philosoph Michael Hampe, der in Zürich lehrt, hat trotzdem versucht, den weiten philosophischen Raum zu vermessen, der sich hinter dieser Bemerkung auftut. Er hat sich dafür eine besondere Versuchsanordnung ausgedacht, die er einen „philosophische[n] Roman“ (388)[1] nennt. Man kann das Buch als eine Sammlung von drei philosophischen Essays lesen, die in eine ein wenig umständliche Rahmenhandlung eingebettet sind. Oder man nimmt auch die Rahmenhandlung ernst und liest dann eine sehr schwarze, traurige Geschichte über Philosophie am Rande der Apokalypse. Und diese Philosophie überschreitet regelmäßig die Grenze zur Theologie. Und das lohnt die folgende gründlichere Auseinandersetzung.[2] 2.
3.Der Protagonist Aaron Fisch, ein Verleger und Redakteur schreibt an der Biographie seines verstorbenen Freundes Moritz Brand. Er sortiert seine Tagebücher und Briefe, und er will seine Gedichte und Essays herausgeben. Dafür hat er sich in eine großzügige Stadtvilla zurückgezogen. Draußen, auf der Straße toben Kämpfe. Drohnen beobachten Passanten aus der Luft und töten sie gezielt. Die Kämpfe reichen bis in den Garten der Villa. Während Fisch an seinem Buch arbeitet, werden die Nachbarn des Biographen getötet, ganz am Ende kommt er selbst ums Leben. Aus der Disposition schon leuchtet die Frage hervor: Wie kann ein Mensch ein sinnvolles Leben führen, wenn die Politik nur Chaos und Kriege produziert und die Religionen nicht mehr trösten können? Die Kämpfe, die bis in die Abgeschiedenheit der mit gut abgehangenem Fleisch, Whiskyvorräten, Festplatten und W-Lan ausgestatteten Villa reichen, dokumentieren das Versagen der Politik. Der Wunsch nach einem transzendenten Jenseits wird in den Essays diskutiert und negativ beschieden. Einen Gott, der sich in Offenbarungen und Inkarnationen mitteilen würde, kann es für Brandt und Fisch nicht geben. Politik und Religion hinterlassen also eine Leerstelle, auf der sich der Biograph und der an einem Hirntumor verstorbene Dichter und philosophische Essayist reflektierend bewegen.
Wie bearbeitet nun der Autor dieses Problem in einem philosophischen Roman? Und welche Gründe führt er an, auf die christliche, theologische Option zu verzichten? Der Roman beginnt zunächst ganz harmlos utopisch. Der Biograph Fisch führt Gespräche mit einem Computerarchiv, dem er einen japanischen Namen gegeben hat: Kagami. Der japanische Vorname bedeutet: Spiegel[3], nämlich in diesem Fall persönlich assistierende Spiegel des Verlegers, Herausgebers und Biographen. Kagami ist ein weiblicher Vorname. Allerdings werden Liebe und Erotik in diesem Buch ausgespart. Frauen tauchen nur auf als feminisierende Festplatte, die spricht, als Schwester des philosophischen Autors Moritz Brandt und als die philosophische Lehrerin, bei der er in Cambridge studiert hat.
Von Anfang an schillert das Buch zwischen Reflexion und Literatur. Die ‚Wirklichkeit‘ des Romans wird durch eingestreute Fotografien der Schauplätze verstärkt. In diesem Schillern zwischen Science-Fiction, Apokalyptik und der gegenwärtigen Realität entsteht das dumpfe Gefühl einer Verunsicherung genauso wie die Frage, ob eine fiktionale Erzählung die genaue philosophische Analyse lohnt. Moritz Brandt, der Autor der im Buch präsentierten Essays, hat in Cambridge studiert – wie der Autor Michael Hampe. Brandt wandte sich von der Philosophie ab, wurde Verlagslektor und begann, eigene Gedichte zu veröffentlichen. Aaron Fisch lässt sich von seiner Archivstimme Kagami Tagebucheinträge von Moritz Brandts Philosophieprofessorin Dorothy Cavendish vorlesen. Dazu kommen Tagebucheinträge von Brandt selbst. Es entsteht das Bild eines durch seine großbürgerliche Herkunft gut versorgten, leicht exzentrischen jungen Mannes, der zwischen Philosophie und Lyrik schwankt – so wie der eigentliche Autor Hampe zwischen Philosophie und Belletristik. In solche biographischen Texte eingebettet, stehen die drei Essays, die dem Buch den Titel gegeben haben: die Wildnis (43ff.), die Seele (149ff.) und das Nichts (254ff.). Manche Texte Brandts, vor allem in den Tagebüchern sind in einer Art orthographisch ungewöhnlichem Jugend-Slang geschrieben. Brandt lässt Vokale weg, die in der Sprache verschluckt werden. Fisch bemerkt später selbst, dass diese Marotten die Lektüre nur stören. In den Text eingesprenkelt sind aber auch merkwürdige Fehler, von denen man nicht weiß, ob es sich um absichtlich eingestreute Unklarheiten oder um fehlendes Lektorat handelt. So heißt es an einer Stelle „Emroy“-Universität, wo doch wohl Emory University gemeint ist (48). An anderer Stelle ist von einer Ivory League Universität (153) die Rede, wo es korrekt Ivy League heißen müsste. Zwischen Elfenbein (ivory) und Efeu (ivy) besteht nicht nur im Englischen ein Unterschied. An einer dritten Stelle wird ein „Dokument“ zitiert, das in der Überschrift als ein Brief von Moritz Brandt an seine Schwester Mariam bezeichnet wird (250). Das „Dokument“ nach der Überschrift ist aber gar kein Brief, sondern seinem Charakter nach eher ein Auszug aus dem Tagebuch Moritz Brandts. 4.
Langsam stellt sich bei der Lektüre heraus, dass Kagami, die Stimme des Festplattenarchivs so etwas wie die Summe allen Wissens bereithält. Auf Nachfrage liefert sie Dokumente, Bücher, Texte, Quellen, Ton- und Bildaufnahmen. Sie kann über diese Dokumente nachdenken, sie nachvollziehen, sie kann sogar Leben und Lebensläufe simulieren. Aber das führt nicht zu weitergehenden Schlussfolgerungen. Kagami kommt nur so weit, dass sie Dokumente und Überzeugungen nebeneinanderstellt. Sie verzichtet darauf, ihr Wissen zu bewerten, zu kategorisieren und die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
5.Der zweite Essay gilt der Seele. Brandt hebt hervor, dass das griechische „psyche“ sowohl für Seele als auch für Schmetterling steht. Der Schmetterling kommt aus einer Verpuppung, die hässliche Raupe macht eine Metamorphose durch (149). Brandt diskutiert die Frage, was mit der Seele nach ihrem Tod geschieht. Er wählt die Alternativen Befreiung vom Körper (Platon), ewiges Leben (Christentum) und Wiedergeburt (Buddhismus). Spiritualität und Theologie entstehen in der Frühzeit daraus, dass Menschen die Erfahrung des Todes bearbeiten wollen (159). In der Vorstellung von einem Leben nach dem Tod liegt ein Trost, eine Stärkung für das Leben, und deswegen taucht sie nach Brandt in allen Religionen auf (161). Diesen Trost benötigen Menschen angesichts der Tatsache, dass der Tod eine „Manifestation des totalen Scheiterns jedes individuellen Lebens“ (161) ist. Dieser anthropologische Pessimismus wirkt schon fast paulinisch. Der einzelne fürchtet sich vor seinem Tod, aber es könnte Trost bringen, dass alle Menschen sterben müssen. Man kann – wie es in der Bibel heißt – lebenssatt sterben. Irgendwann im Alter sind Körperkraft und Bewusstsein verbraucht. Die Individualität der Seele entsteht für Moritz Brandt durch erlebte Lebensgeschichte. Vergangenheit und Gegenwart bilden einen „‘Rahmen‘“, einen Container, der Lebensgeschichte aufnimmt. Lebensgeschichten unterscheiden sich je nach Individuum, aber Rahmen oder Container bleiben gleich (173). Es folgen interessante Gedanken zur Immaterialität der Seele, zum Zusammenhang von Individuum und Zeit und zur Rolle des Lichts (180ff.). Wieder münden im zweiten Essay diese Gedanken in eine Reflexion über den Tod: „Das Einzige, was wir über den Tod wissen, ist: Noch niemand ist zurückgekommen, um von der Verwandlung, die er vielleicht durchlief, berichten zu können.“ (190). Moritz Brandts Argument läuft darauf hinaus, dass der Seele keine ‚Trägersubstanz‘ eignet, mit der sie nach dem Tod des Körpers weiterleben könnte. Eine Ausnahme könnte das Licht sein. Es ist schade, dass Hampe/Brandt hier nicht auf die „Göttliche Komödie“ Dantes[7] zu sprechen kommen, denn Dante verstand ja vor allem im dritten Teil seines Werks, dem ‚Paradiso‘, Gott vorrangig als Licht, welches die in Barmherzigkeit aufgenommenen Seelen und den Rest der Welt beleuchtet und damit allererst lebendig macht. Ebenso wäre an die Licht- und Aufklärungsphilosophie Hans Blumenbergs zu denken.[8]
Es geht hier auch um einen Unterschied zwischen Subjektivismus und Kosmologie. Der Subjektivismus sagt: Gott hat mich erschaffen, und darum muss ich mich selbst entfalten und verwirklichen. Die Kosmologie sagt: Gott hat diesen Kosmos erschaffen, und ich bin einen Funkenschlag lang ein Teil davon. Also nutze ich die Zeit. Der philosophische Pessimismus sagt: Ich kann nicht mit guten Gründen entscheiden, ob es einen Gott gibt. Ich weiß auch nicht, ob hinter dem Kosmos eine gute Kraft steckt. Ich bin in das Leben hineingeworfen, in dem ich keine, wie auch immer geartete moralische Verpflichtung entdecken kann. Wie kann ich dann den Funkenschlag, der mein Leben ist, nutzen? 6.
Leben wird in apokalyptischen Zeiten häufig als so ambivalent bewertet, dass man behauptet: Es wäre besser, wenn es keine Menschen geben würde. Oder zugespitzt: Es wäre besser, wenn ich gar nicht geboren worden wäre. Und: „Wer keine Kinder zeugt, verhindert damit Leid, aber er verhindert nicht Freude oder Lust. Deshalb sei es besser, keine Kinder in die Welt zu setzen.“ (267) Brandt unterscheidet Natalisten und Anti-Natalisten; die einen entscheiden sich für Fortpflanzung und Geburt, die anderen dagegen. Die Entscheidung für das eine oder andere hängt ab von der Möglichkeit intensive Erfahrungen der Wirklichkeit zu machen. Brandt kommt in seinem Essay deshalb auf die Bewertung von Empfindungen und Wahrnehmungen und die subjektiven Anteile daran zu sprechen: „Auch eine künstlerische Tätigkeit wie Zeichnen oder Malen, das Musizieren oder der Versuch, ein Gedicht zu schreiben, kann zu einer so genauen Hinwendung zu den Einzelheiten der Wirklichkeit führen, daß die subjektiven Bewertungen als störend bei der kontemplativen Arbeit empfunden und immer mehr ausgeblendet werden, je mehr die Künstlerin oder der Künstler die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung, weg von sich selbst und hin zum Gegenstand der Kunst, zu lenken imstande ist.“ (247f.) Der Künstler gewinnt die Einsicht, daß ihm das eigene Selbst bei seiner Tätigkeit im Wege steht. Das aber ist keine allmähliche Erkenntnis, sondern nur möglich in einer schlagartigen Intuition, in einer ‚Erleuchtung‘. „Die Reinigung der Empfindungen von den selbstischen Zusammenhängen führt in der Mystik vielmehr zur Intuition einer unendlichen Komplexität, einer Komplexität, die meine Lebensgeschichte bei weitem übersteigt.“ (276) Diese Intuition einer das Ich umgebenden und es übersteigenden Komplexität lässt sich nur als Gefühl oder Ahnung spüren, nicht aber als Text, also sprachlich ausdrücken. „Texte realisieren etwas anderes als das, was sie beschreiben, sie reduzieren die Komplexität des Benannten innerhalb der Perspektive eines auf bestimmte Weise bewertenden Selbst.“ (277) Es geht um die Erkenntnis, daß „die Wirklichkeit zu komplex ist, um sie nur von meinen subjektiven Interessen her zu begreifen und sprachlich zu thematisieren (…).“ (ebd.)
Brandt wechselt in der Folge von der Mystik zur komplementären Weisheit, verstanden als eine Lebenskunst, die im Detail weiterhilft statt sich in allgemeinen und abstrakten Bildungsprogrammen zu verlieren. „Jede begriffliche Schematisierung kapituliert letztlich vor der Bodenlosigkeit und Komplexität der Wirklichkeit, wie sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt manifestiert.“ Weisheit liefert nicht mehr Lebenshilfe-Anleitungen für jedermann, sondern richtet sich an einzelne und „ihre jeweiligen Transformationsbedürfnisse in konkreten Lebenssituationen.“ (285) Mystik sorgt dafür, daß der einzelne sich von seiner Subjektivität befreit und einstellt auf eine wechselseitige „Durchlässigkeit“ zwischen Unbewußtem und Außenwelt. Diese „führt dazu, daß sich die bodenlose Komplexität, die jeder Mensch selbst darstellt, und die bodenlose Komplexität der Situation, in der er sich mit anderen Menschen immer gerade befindet, aufeinander ohne Steuerung abstimmen.“ (286f.) Beispiele dafür, die Hampe nicht nennt, sind der Zen-Bogenschütze, den Eugen Herrigel[10] beschrieben hat, der ins Gebet versunkene Mönch, der alt und krank gewordene Maler Henri Matisse[11] beim Scherenschneiden und Finden von einfachen Formen. Durchlässigkeit heißt, von sich selbst und den eigenen Interessen abzusehen und sich für neue Situationen und Ansprüche zu öffnen.
In einem Tagebucheintrag kommt Brandt später noch einmal auf das Verhältnis von Weisheit, Philosophie und Literatur zurück. „In der Dichtung, vielleicht in der Kunst überhaupt, haben sich vielmehr noch Spuren der Weisheit erhalten. Für die Weisheit gilt anders als für Wissenschaft oder Philosophie: keine endgültige Bewertung einer Situation! Wir verfügen über keinen absoluten, nicht situativ gebundenen Erkenntnisstandpunkt. Jede Darstellung geschieht aus einer begrenzten Perspektive, ist von einem endlichen Wesen mit endlicher Erfahrung erzeugt. Es geht nicht um Allgemeingültigkeit, sondern um Ehrlichkeit, um Authentizität.“ (324) Brandts Gedanken über Weisheit und Mystik erweisen sich als eine Kritik der Vollständigkeit des rationalen Subjekts – und gerade darin als religiös oder theologisch. Das unvollständige Individuum steht vor der Aufgabe, ein Verhältnis zur Wirklichkeit zu finden. Und das geschieht nicht durch Erkenntnis, sondern durch intuitive Übungen. Damit wird auch deutlich, warum die philosophischen Essays von Moritz Brandt in diese apokalyptische Rahmengeschichte eingeordnet sind. Letztere dient der Subjektivierung und Perspektivierung. Der Autor reduziert im guten Sinne abstrakte Philosophie auf situative Weisheit. „Wenn es keine Perspektive auf die ganze Welt und das ganze Leben gibt, wenn es keine Kriterien zur Beurteilung der Welt und des gesamten Lebens gibt, dann bleibt nichts anderes übrig, als zu schildern, wie es sich gerade anfühlt, auf der Welt zu sein und ein bestimmtes Leben zu führen.“ (327) Was folgt daraus? Es folgt daraus eine umfassende Vorsicht gegenüber allen Meinungen und Urteilen, gegenüber allem Positionalismus. Es folgt daraus das Einüben eines gelassenen Sich-Einlassens auf die Welt.
Brandts Essay geht über diesen neutestamentlichen Verweis hinweg und endet dann so. Er beruft sich zuletzt auf ein Zitat von Ian Maclaren: „‘Sei freundlich, denn jedes Wesen, das du triffst, kämpft eine schwere Schlacht!‘ Wer sich daran hält, wird in den Schlachten, die die Menschen selbst anzetteln, nicht mitmachen.“ (333) Das ist das hehre Programm eines intellektuellen Aussteigers, und sein Erfinder Hampe scheint dagegen auch selbst skeptisch zu sein und deutet dies in zwei Wendungen der Geschichten an. Brandt selbst stirbt an einem unheilbaren Hirntumor, viel zu jung. Und Aaron Fisch, der Biograph, wird in den Gefechten getötet, aus denen er sich eigentlich zurückgezogen hatte. 7.Der Leser ist einerseits fasziniert von den Fragen, die Moritz Brandt stellt, von den Methoden, die er vorschlägt und bedenkt. Auf der anderen Seite wirken alle Figuren in Hampes philosophischem Roman doch leicht steril und klischeehaft. Ihnen fehlt die Subjektivität, die sie so gerne mystisch loswerden würden. In Brandt jedenfalls steckt jedes Klischee, das einen rebellischen jungen Intellektuellen charakterisieren könnte. Er pöbelt gegen seine philosophische Lehrerin, er geht zum Boxtraining, er schreibt Gedichte, er bedient sich einer schluffigen Sprache, er weiß in seiner Pubertät nicht, ob er sich als Junge oder Mädchen fühlen soll. Noch mehr gilt der Klischeevorwurf für seinen übergewichtigen Biographen Aaron Fisch. Er hamstert Lebensmittel, wendet viel Zeit auf für ein wunderbares englisches Frühstück, er spricht dem Rotwein zu und haßt den Sport. Die bedrohlichen politischen Geschehnisse, die Kampfdrohnen, die Kampfszenen in seinem Garten lassen ihn kalt. Er plaudert ausführlich mit seinem sprechenden Archiv. Am Ende kommt Aaron Fisch banal und erwartbar bei einem Drohnenangriff vor seinem Haus ums Leben. Und darum stellt sich die Frage: Wieso ist es nötig, dass Hampe diese klischeehaft erwartbare Rahmengeschichte erzählt? Um dem Roman noch mehr apokalyptische Schärfe zu geben? Mich hat das nicht völlig überzeugt. Es wäre an Milan Kundera zu denken, der es in seinem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“[12] meisterlich verstanden hat, existentielle philosophische Fragen mit einer tragischen Liebesgeschichte zu verknüpfen. Kunderas Geschichte lebt von ihren unerwarteten Wendungen und der philosophischen Klugheit seiner Fragen. Beides ist perfekt miteinander verwoben. Bei Hampe kommt die (literarische) Geschichte sehr vorhersehbar daher, was aber der philosophischen Klugheit seiner Fragen keinen Abbruch tut. Die Philosophie triumphiert hier über den Roman.
In einem Nachwort schließlich spricht der Autor selbst, und erst jetzt fällt das erwähnte Stichwort vom philosophischen Roman. Die Versuchsanordnung Hampes entspricht einer „narrativen Philosophie“ (389). Es wäre nach diesen rezensierenden Überlegungen die Frage zu stellen, ob es sich eher um einen Roman oder eher um einen philosophischen Entwurf handelt. Einen Roman würde man nach ästhetischen Kriterien beurteilen, auch wenn dort philosophische Fragen behandelt werden, wie in Diderots „Rameaus Neffe“, in Thomas Manns „Zauberberg“ oder im erwähnten Roman Kunderas. Wenn es sich bei Hampes Werk um einen Roman handelt, dann stellt sich die Frage, wo seine eigene Position zum Vorschein kommt. Auf mich wirkt die apokalyptische Zerstörung am Ende des Buches samt dem Tod der beiden Protagonisten bedrückend. Ich lese das als eine Warnung vor dem Zerfall globaler Solidarität und vor einer drohenden ökologischen Katastrophe.
Unabhängig davon, ob man das Werk für einen Roman oder einen philosophischen Entwurf hält, Hampes Buch trifft die (christliche) Theologie an einem zentralen Punkt, in der Frage nach dem Umgang mit dem Tod und der Frage nach dem Sinn des Lebens. Das liegt auch daran, daß Hampe in seiner mystischen Weisheit eine zwar theologie-affine, aber dennoch nicht-theologische Lösung für diese beiden Fragen bietet. Christlicher Glaube verweist für den Sinn des Lebens auf die Verschränkung von extremem Leiden am Kreuz und seiner Überwindung in der Auferstehung Jesu Christi. Die Fragen nach Leid und Tod verweisen auf ein extrem ungerechtes, in philosophischer Sprache kontingentes Schicksal (Tod durch einen Hirntumor, Tod als Zivilist in einem Bürgerkrieg). Moritz Brandt greift bei der Beantwortung dieser Fragen nicht auf das theologische Reservoir des Christentums zurück. Eher gilt das für seine philosophische Lehrerin Cavendish, deren Tagebücher ausführlich zitiert werden, aber im Kontext des Romans nur eine untergeordnete Bedeutung haben.
Anmerkungen[1] Alle Seitenangaben im Text beziehen sich auf das im Untertitel genannte Buch. [2] Wer es kürzer will, sei verwiesen auf diese sehr positive Rezension: Thomas Ribi, Das, was man Leben nennt, NZZ 15.5.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/das-was-man-leben-nennt-michael-hampe-geht-grosse-fragen-an-ld.1556372. [3] Zur Spiegel-Metaphorik Wolfgang Vögele, Im Labyrinth der Spiegel, tà katoptrizómena, Heft 113, Juni 2018, https://www.theomag.de/113/wv044.htm. [4] Bei John Williams könnte man auf den Gedanken kommen, daß dessen Roman „Stoner“ eine Art Vorbildfunktion für Hampe ausgeübt hat: John Williams, Stoner, München 2013 (engl. 1965); vgl. dazu Wolfgang Vögele, Der Dulder. Zu John Williams Roman „Stoner“, tà katoptrizómena, H.87, 2014, http://theomag.de/87/wv07.htm. [5] Hier treffen die Überlegungen Hampes mit der Philosophie der ‚elektrischen‘ Unmittelbarkeit zusammen, die der französische Philosoph Tristan Garcia entwickelt hat. Vgl. dazu Tristan Garcia, Das intensive Leben. Eine moderne Obsession, Berlin 2017; vgl. dazu Wolfgang Vögele, Elektrische Philosophie. Rezension von Tristan Garcia, Das intensive Leben. Eine moderne Obsession, Berlin 2017, tà katoptrizómena, Heft 111, Februar 2017, https://theomag.de/111/wv041.htm [6] Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, Berlin 2017. [7] Vgl. dazu Dante Alighieri, Commedia in deutscher Prosa, übers. von Kurt Flasch, Frankfurt 2013 sowie Wolfgang Vögele, Die Welt, aus dem Jenseits betrachtet. Einige Bemerkungen über Dantes Commedia, Theologie und Kunst, tà katoptrizómena, H.95, 2015, http://www.theomag.de/95/wv18.htm. [8] Vgl. dazu zusammenfassend Rüdiger Zill, Der absolute Leser. Hans Blumenberg. Eine intellektuelle Biographie, Berlin 2020. [9] Zum Begriff der Übung Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt/M. 2009. [10] Eugen Herrigel, Zen und die Kunst des Bogenschießens, München 2010 (1948). [11] Wolfgang Vögele, Raum in der kleinsten Kapelle. Über den Maler Henri Matisse, seine ungläubige Theologie und die Ästhetik der Vereinfachung, tà katoptrizómena, Heft 121, Dezember 2019, https://theomag.de/122/wv056.htm. [12] Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, München 1986. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/126/wv060.htm |
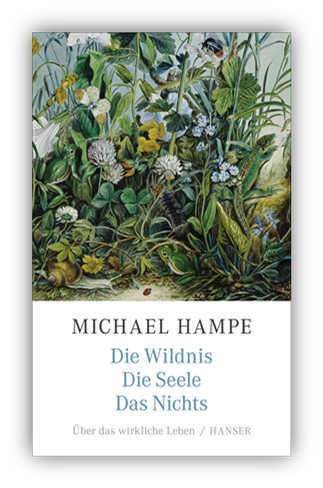
 Kurzer Exkurs über den Zweck von Rezensionen: Es ist der Anspruch dieser Rezension, dass ich mich mit den Thesen Hampes auseinandersetzen will. Vielerorts wird das Genre der Rezension so missverstanden, dass sie nicht viel mehr als eine Leseanregung bietet. Rezensenten lassen sich dann willig in die fünfte Kolonne der Marketingabteilungen der Verlage einreihen. Nach meiner Überzeugung ehrt es einen Autor aber mehr, wenn seine Leser sich mit den Thesen des Buches auseinandersetzen. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich mich mit allen Thesen Hampes auseinandergesetzt habe. Ich habe diejenigen Überlegungen Hampes ausgewählt, die sich durch eine besondere Nähe zur Theologie auszeichnen. Kritische und positive Argumente benötigen Raum zur Entfaltung. Denn im Roman selbst sind die philosophischen Thesen des jungen Philosophen Moritz Brandt mit den biographischen Reflexionen des Philologen Aaron Fisch ineinander gefaltet. Und dieser wiederum entfaltet seine biographischen Überlegungen im Dialog mit einem sprechenden Computer. Der Roman ist eigentlich nur eine Rahmenerzählung, die geprägt ist von milder, gemäßigter Science-Fiction, samt einem guten Anteil gewalttätiger Apokalyptik. In diese Rahmenerzählungen sind philosophische Essays mit theologischem Anspruch eingebettet.
Kurzer Exkurs über den Zweck von Rezensionen: Es ist der Anspruch dieser Rezension, dass ich mich mit den Thesen Hampes auseinandersetzen will. Vielerorts wird das Genre der Rezension so missverstanden, dass sie nicht viel mehr als eine Leseanregung bietet. Rezensenten lassen sich dann willig in die fünfte Kolonne der Marketingabteilungen der Verlage einreihen. Nach meiner Überzeugung ehrt es einen Autor aber mehr, wenn seine Leser sich mit den Thesen des Buches auseinandersetzen. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich mich mit allen Thesen Hampes auseinandergesetzt habe. Ich habe diejenigen Überlegungen Hampes ausgewählt, die sich durch eine besondere Nähe zur Theologie auszeichnen. Kritische und positive Argumente benötigen Raum zur Entfaltung. Denn im Roman selbst sind die philosophischen Thesen des jungen Philosophen Moritz Brandt mit den biographischen Reflexionen des Philologen Aaron Fisch ineinander gefaltet. Und dieser wiederum entfaltet seine biographischen Überlegungen im Dialog mit einem sprechenden Computer. Der Roman ist eigentlich nur eine Rahmenerzählung, die geprägt ist von milder, gemäßigter Science-Fiction, samt einem guten Anteil gewalttätiger Apokalyptik. In diese Rahmenerzählungen sind philosophische Essays mit theologischem Anspruch eingebettet. Das im Untertitel genannte „wirkliche“ Leben kann nur ein sinnvolles Leben sein. Und diese Frage ist theologisch interessant, auch wenn der Schöpfergott von Gen 1-3 lange abgedankt hat. Die Menschen sind auf der einen Seite mit einem Kosmos konfrontiert, der von Naturgesetzen und Wahrscheinlichkeiten bestimmt ist: Man kann die nächste Mondfinsternis, die Sternenbahnen und die Implosionen schwarzer Löcher berechnen. Auf der Ebene darunter, in der Menschenwelt herrschen Kontingenzen, welche Lebenswelt und Alltagsleben zu einem Glückspiel machen. Zwar behauptete Einstein, dass Gott nicht würfle, aber das gilt offensichtlich nur dann, wenn er mit Milchstraßen, schwarzen Zwergen und Kometen jongliert, auf der Ebene des Sozialen und des individuellen Lebens gilt es sehr wohl: Verkehrsunfall, Lungenkrebs, Nobelpreis, glückliche Partnerschaft und berufliche Karriere sind mehr vom Zufall bestimmt als es die ordnende, nach einer nachhaltigen Biographie strebende Vernunft wahrhaben will. Die Entwicklung einer Persönlichkeit wird von Kontingenzen bestimmt, welche Glaube und Vernunft auf ihre Art wegarbeiten wollen. Aber das kann nicht die Tatsache verschleiern, dass sinnvolles, langes Leben samt Anerkennung und Gratifikationen für erstrebenswerter gehalten wird als das tragisch beendete, das kurze oder gescheiterte Leben.
Das im Untertitel genannte „wirkliche“ Leben kann nur ein sinnvolles Leben sein. Und diese Frage ist theologisch interessant, auch wenn der Schöpfergott von Gen 1-3 lange abgedankt hat. Die Menschen sind auf der einen Seite mit einem Kosmos konfrontiert, der von Naturgesetzen und Wahrscheinlichkeiten bestimmt ist: Man kann die nächste Mondfinsternis, die Sternenbahnen und die Implosionen schwarzer Löcher berechnen. Auf der Ebene darunter, in der Menschenwelt herrschen Kontingenzen, welche Lebenswelt und Alltagsleben zu einem Glückspiel machen. Zwar behauptete Einstein, dass Gott nicht würfle, aber das gilt offensichtlich nur dann, wenn er mit Milchstraßen, schwarzen Zwergen und Kometen jongliert, auf der Ebene des Sozialen und des individuellen Lebens gilt es sehr wohl: Verkehrsunfall, Lungenkrebs, Nobelpreis, glückliche Partnerschaft und berufliche Karriere sind mehr vom Zufall bestimmt als es die ordnende, nach einer nachhaltigen Biographie strebende Vernunft wahrhaben will. Die Entwicklung einer Persönlichkeit wird von Kontingenzen bestimmt, welche Glaube und Vernunft auf ihre Art wegarbeiten wollen. Aber das kann nicht die Tatsache verschleiern, dass sinnvolles, langes Leben samt Anerkennung und Gratifikationen für erstrebenswerter gehalten wird als das tragisch beendete, das kurze oder gescheiterte Leben.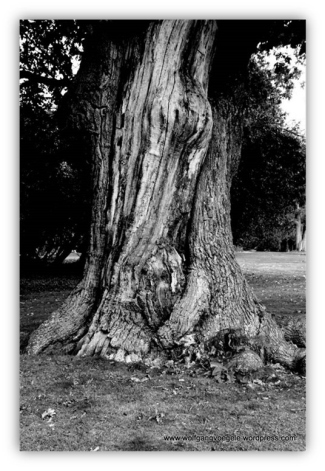 Am Anfang fällt die Widmung auf, die der Autor dem Buch beigegeben hat: „Für die Nachgeborenen, die auftauchen werden aus der Flut oder sie verhindern“ (5). Schon aus dieser dunklen Zeile hört man die apokalyptische Moll-Tonart heraus. Der Leser denkt an das Argument, dass sich gegenwärtige Menschen einmal gegenüber zukünftigen Generationen verantworten müssen. Für die „Flut“, die das Bild biblischer Sintflut evoziert, ist es noch nicht zu spät: Es bestünde noch die Möglichkeit, sie zu verhindern. Die apokalyptischen Zustände, mit denen sich der bärbeißige Biographie Aaron Fisch konfrontiert sieht, sind sie das Ergebnis von Hampes pessimistischem Blick auf die maroden ökologischen Zustände der gegenwärtigen Welt?
Am Anfang fällt die Widmung auf, die der Autor dem Buch beigegeben hat: „Für die Nachgeborenen, die auftauchen werden aus der Flut oder sie verhindern“ (5). Schon aus dieser dunklen Zeile hört man die apokalyptische Moll-Tonart heraus. Der Leser denkt an das Argument, dass sich gegenwärtige Menschen einmal gegenüber zukünftigen Generationen verantworten müssen. Für die „Flut“, die das Bild biblischer Sintflut evoziert, ist es noch nicht zu spät: Es bestünde noch die Möglichkeit, sie zu verhindern. Die apokalyptischen Zustände, mit denen sich der bärbeißige Biographie Aaron Fisch konfrontiert sieht, sind sie das Ergebnis von Hampes pessimistischem Blick auf die maroden ökologischen Zustände der gegenwärtigen Welt? Der erste Essay gilt dem Gegensatz zwischen intensivem Naturerlebnis und banaler Zivilisation. Hampe nimmt auf, was amerikanischen Transzendentalisten wie Thoreau (68ff.) und Emerson (76ff.), aber auch Schriftsteller wie John Williams in „Butcher’s Crossing“ (88ff.)
Der erste Essay gilt dem Gegensatz zwischen intensivem Naturerlebnis und banaler Zivilisation. Hampe nimmt auf, was amerikanischen Transzendentalisten wie Thoreau (68ff.) und Emerson (76ff.), aber auch Schriftsteller wie John Williams in „Butcher’s Crossing“ (88ff.) Moritz Brandt, der Verfasser der Essays wird dargestellt als ein junger Wilder, als einer, der versucht, sich zum starken Mann heranzubilden, nicht nur im intellektuellen, auch im sportlichen Leben. Der Philosophiestudent schätzte das Boxen, das aus Kampf, Reflexen und Unmittelbarkeit besteht. Boxen braucht Kraft, Intuition, Reaktionsschnelligkeit, auch Intensität, vorausschauendes Handeln, Nachdenken, aber eben nicht träge, langatmige Reflexion. Aaron Fisch deutet die aggressive Außenseiterrolle, die Brandt einnimmt, als Versuch, sich selbst zu schützen (140). Moritz wurde beruflich nicht zu der erfolgreichen Person, die sich seine Eltern für ihren Sohn vorgestellt hatten. Kagami erklärt dazu: „Menschen wie Moritz wollen machen, was sie wollen, sich möglichst wenig nach anderen richten, doch sie wollen auch von anderen wahrgenommen werden.“ (141) Das ist eine typische Künstler-Paradoxie: Moritz beansprucht soziale Anerkennung, ohne selbst sozial zu sein. Er lebt und bearbeitet einen Antagonismus zwischen Künstler und Gesellschaft, in der Sprache des Soziologen Andreas Reckwitz der entscheidende Widerspruch des „singularisierten“ Menschen.
Moritz Brandt, der Verfasser der Essays wird dargestellt als ein junger Wilder, als einer, der versucht, sich zum starken Mann heranzubilden, nicht nur im intellektuellen, auch im sportlichen Leben. Der Philosophiestudent schätzte das Boxen, das aus Kampf, Reflexen und Unmittelbarkeit besteht. Boxen braucht Kraft, Intuition, Reaktionsschnelligkeit, auch Intensität, vorausschauendes Handeln, Nachdenken, aber eben nicht träge, langatmige Reflexion. Aaron Fisch deutet die aggressive Außenseiterrolle, die Brandt einnimmt, als Versuch, sich selbst zu schützen (140). Moritz wurde beruflich nicht zu der erfolgreichen Person, die sich seine Eltern für ihren Sohn vorgestellt hatten. Kagami erklärt dazu: „Menschen wie Moritz wollen machen, was sie wollen, sich möglichst wenig nach anderen richten, doch sie wollen auch von anderen wahrgenommen werden.“ (141) Das ist eine typische Künstler-Paradoxie: Moritz beansprucht soziale Anerkennung, ohne selbst sozial zu sein. Er lebt und bearbeitet einen Antagonismus zwischen Künstler und Gesellschaft, in der Sprache des Soziologen Andreas Reckwitz der entscheidende Widerspruch des „singularisierten“ Menschen. In Brandts Seelen-Essay wird deutlich, dass der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele keine rationale Begründung haben kann. Die Position, im christlich-philosophischen Sinn trotzdem davon überzeugt zu sein, verteidigt Brandts Lehrerin Dorothy Cavendish in ihren Tagebüchern. Cavendish schreibt über Brandt: „Es hat ihm in seiner Hinwendung zum Buddhismus nur gedämmert, daß da irgendwas nicht stimmt, aber richtig eingesehen hat er nicht, daß er hier in einem Irrtum befangen ist, daß es keine Letzt- und Selbstbegründung gibt, daß die Kette der Argumente an ein Ende kommt, ein Ende, das beliebig und zufällig ist, und daß wir unser Leben deshalb nicht auf Argumenten aufbauen können. (…) Er war damals noch nicht reif genug um einzusehen, daß wir den Glauben brauchen, um darum bitten zu können, daß wir nicht in Schlimmeres geraten und daß wir richtig wählen, wo uns die Argumente fehlen.“ (199) Danach kommt Cavendish auf die Versuchungsbitte des Vaterunsers zu sprechen. Sie argumentiert, es brauche, um zu leben, Überzeugungen und Orientierungen. Diese versehen die Menschen mit argumentativen Begründungen. Ausschließlich mit Begründungen kommt niemand aus. Die Ketten der Argumente kommen aus dem Leeren und laufen wieder ins Leere. Am Anfang und am Ende von Argumentationsketten steht darum ein Glaube, der sich willkürlichen Entscheidungen verdankt. Von ihnen kann man nur hoffen, dass es sich um lebensdienliche, gute Entscheidungen handelte. Ist das schon Religion, sich damit zufrieden zu geben, ein rationales Leben zu führen, das sich in seinen Begründungen willkürlichen Entscheidungen verdankt? Ist das Christentum, in Schöpfung, Providenz, Kreuz und Auferstehung und ewigem Leben Symbole zu sehen, die auf die Unverfügbarkeit, Würde des Lebens und die prinzipielle Sinnhaftigkeit des Kosmos deuten? Glaube hieße dann: Die Menschen tun einfach so, als ob es diesen Sinn gibt. Das Gefühl der spirituellen Verehrung gilt derjenigen Kraft, die diesen Kosmos hervorgebracht hat.
In Brandts Seelen-Essay wird deutlich, dass der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele keine rationale Begründung haben kann. Die Position, im christlich-philosophischen Sinn trotzdem davon überzeugt zu sein, verteidigt Brandts Lehrerin Dorothy Cavendish in ihren Tagebüchern. Cavendish schreibt über Brandt: „Es hat ihm in seiner Hinwendung zum Buddhismus nur gedämmert, daß da irgendwas nicht stimmt, aber richtig eingesehen hat er nicht, daß er hier in einem Irrtum befangen ist, daß es keine Letzt- und Selbstbegründung gibt, daß die Kette der Argumente an ein Ende kommt, ein Ende, das beliebig und zufällig ist, und daß wir unser Leben deshalb nicht auf Argumenten aufbauen können. (…) Er war damals noch nicht reif genug um einzusehen, daß wir den Glauben brauchen, um darum bitten zu können, daß wir nicht in Schlimmeres geraten und daß wir richtig wählen, wo uns die Argumente fehlen.“ (199) Danach kommt Cavendish auf die Versuchungsbitte des Vaterunsers zu sprechen. Sie argumentiert, es brauche, um zu leben, Überzeugungen und Orientierungen. Diese versehen die Menschen mit argumentativen Begründungen. Ausschließlich mit Begründungen kommt niemand aus. Die Ketten der Argumente kommen aus dem Leeren und laufen wieder ins Leere. Am Anfang und am Ende von Argumentationsketten steht darum ein Glaube, der sich willkürlichen Entscheidungen verdankt. Von ihnen kann man nur hoffen, dass es sich um lebensdienliche, gute Entscheidungen handelte. Ist das schon Religion, sich damit zufrieden zu geben, ein rationales Leben zu führen, das sich in seinen Begründungen willkürlichen Entscheidungen verdankt? Ist das Christentum, in Schöpfung, Providenz, Kreuz und Auferstehung und ewigem Leben Symbole zu sehen, die auf die Unverfügbarkeit, Würde des Lebens und die prinzipielle Sinnhaftigkeit des Kosmos deuten? Glaube hieße dann: Die Menschen tun einfach so, als ob es diesen Sinn gibt. Das Gefühl der spirituellen Verehrung gilt derjenigen Kraft, die diesen Kosmos hervorgebracht hat. Der dritte Essay Moritz Brandts über das Nichts ist bei weitem der spannendste. Er stellt die Frage nach dem Weiterleben in den eigenen Kindern. „Leben Menschen in ihren Kindern in verwandelter Form weiter; in deren Genen und Gewohnheiten? Ist die Mutation nicht die Transformation des Körperlichen in eine neue junge, vielleicht bessere Gestalt? Ist die eigentliche Unsterblichkeit nicht die der Seele, sondern die der Gattung?“ (254) Die Praxis des Zölibats zeigt, daß Menschen aus bestimmten spirituellen Gründen auf Kinder verzichten können. Die Bibel zeigt aber auch (Sara, Mutter von Isaak, Elisabeth, Mutter von Johannes dem Täufer, Hanna, Mutter Samuels, und viele weitere Frauen), daß Kinderlosigkeit als sehr bedrückend empfunden werden kann.
Der dritte Essay Moritz Brandts über das Nichts ist bei weitem der spannendste. Er stellt die Frage nach dem Weiterleben in den eigenen Kindern. „Leben Menschen in ihren Kindern in verwandelter Form weiter; in deren Genen und Gewohnheiten? Ist die Mutation nicht die Transformation des Körperlichen in eine neue junge, vielleicht bessere Gestalt? Ist die eigentliche Unsterblichkeit nicht die der Seele, sondern die der Gattung?“ (254) Die Praxis des Zölibats zeigt, daß Menschen aus bestimmten spirituellen Gründen auf Kinder verzichten können. Die Bibel zeigt aber auch (Sara, Mutter von Isaak, Elisabeth, Mutter von Johannes dem Täufer, Hanna, Mutter Samuels, und viele weitere Frauen), daß Kinderlosigkeit als sehr bedrückend empfunden werden kann. Das Streben nach von subjektiven Empfindungen bereinigtem Denken und Handeln nennt Brandt Mystik. Dem Mystiker geht es um „die Bodenlosigkeit der Wirklichkeit jenseits ihres Selbst“ (278). Wahrnehmung ist grundsätzlich die Einschränkung der Wirklichkeit auf einen bestimmten Aspekt. Wer bewertet, schränkt diese Wahrnehmung der Wirklichkeit noch weiter ein. Für den Mystiker wird es durch lange Übung möglich, sich von den Beschränkungen der Wahrnehmung durch Bewertung zu befreien. Mystik versteht Brandt also als eine Entschränkung der Wirklichkeit, als eine (plötzliche) Befreiung des Selbst von den Einschränkungen der Wahrnehmung. „Die Abschmelzung des sozialen Selbst dient in den genannten Meditationspraktiken deshalb nicht einfach dazu, die eigenen Bewertungskontexte bedeutungslos werden zu lassen, um zu einer reicheren Wirklichkeitswahrnehmung zu kommen. Sie wird auch angestrebt, um nicht mehr auf selbstische oder kulturelle Kontexte im Wirklichkeitsbezug festgelegt zu sein, um die Flexibilität in der Beziehung zu anderen, Fremden zu erwerben und die Relativität der Bewertungskontexte einzusehen.“ (279) Die Leere, die Brandt qua Meditation oder Kunst herstellen will, eröffnet Sinnhorizonte; beim depressiven Menschen verschließt Leere Sinnhorizonte (280f.) „Es sind also zwei Formen der Leere, mit denen wir konfrontiert sind: die Leere, in der alles ausgelöscht ist, und die Leere, in der jedes Einzelwesen und jeder Aspekt an jedem Einzelwesen als abhängig von unendlichen vielen anderen Einzelwesen, die alle kommen und gehen, wahrgenommen wird. In beiden Fällen findet die Sprache keinen festen Halt mehr, aber aus jeweils verschiedenen Gründen. Einmal gibt es nichts mehr zu sagen, weil alles gleichgültig geworden ist. Das andere Mal gibt es nichts Gewisses mehr zu sagen, weil sprachliche Kategorisierungen zu grob und zu fest sind, um dem, was sich tatsächlich zeigt und ständig verändert, in seiner Komplexität und Wandelbarkeit gerecht zu werden.“ (281f.) Das ist die Leere, die entsteht, wenn sich das Ich so weit wie möglich von den eigenen subjektiven Vorurteilen entfernt. Es ergibt sich ein „Vorbehalt gegenüber einem selbstgewissen Theoretisieren, das mit bestimmten ‚Lieblingsallgemeinbegriffen‘ operiert und sie auch anderen ‚ansinnen‘ will.“ (282)
Das Streben nach von subjektiven Empfindungen bereinigtem Denken und Handeln nennt Brandt Mystik. Dem Mystiker geht es um „die Bodenlosigkeit der Wirklichkeit jenseits ihres Selbst“ (278). Wahrnehmung ist grundsätzlich die Einschränkung der Wirklichkeit auf einen bestimmten Aspekt. Wer bewertet, schränkt diese Wahrnehmung der Wirklichkeit noch weiter ein. Für den Mystiker wird es durch lange Übung möglich, sich von den Beschränkungen der Wahrnehmung durch Bewertung zu befreien. Mystik versteht Brandt also als eine Entschränkung der Wirklichkeit, als eine (plötzliche) Befreiung des Selbst von den Einschränkungen der Wahrnehmung. „Die Abschmelzung des sozialen Selbst dient in den genannten Meditationspraktiken deshalb nicht einfach dazu, die eigenen Bewertungskontexte bedeutungslos werden zu lassen, um zu einer reicheren Wirklichkeitswahrnehmung zu kommen. Sie wird auch angestrebt, um nicht mehr auf selbstische oder kulturelle Kontexte im Wirklichkeitsbezug festgelegt zu sein, um die Flexibilität in der Beziehung zu anderen, Fremden zu erwerben und die Relativität der Bewertungskontexte einzusehen.“ (279) Die Leere, die Brandt qua Meditation oder Kunst herstellen will, eröffnet Sinnhorizonte; beim depressiven Menschen verschließt Leere Sinnhorizonte (280f.) „Es sind also zwei Formen der Leere, mit denen wir konfrontiert sind: die Leere, in der alles ausgelöscht ist, und die Leere, in der jedes Einzelwesen und jeder Aspekt an jedem Einzelwesen als abhängig von unendlichen vielen anderen Einzelwesen, die alle kommen und gehen, wahrgenommen wird. In beiden Fällen findet die Sprache keinen festen Halt mehr, aber aus jeweils verschiedenen Gründen. Einmal gibt es nichts mehr zu sagen, weil alles gleichgültig geworden ist. Das andere Mal gibt es nichts Gewisses mehr zu sagen, weil sprachliche Kategorisierungen zu grob und zu fest sind, um dem, was sich tatsächlich zeigt und ständig verändert, in seiner Komplexität und Wandelbarkeit gerecht zu werden.“ (281f.) Das ist die Leere, die entsteht, wenn sich das Ich so weit wie möglich von den eigenen subjektiven Vorurteilen entfernt. Es ergibt sich ein „Vorbehalt gegenüber einem selbstgewissen Theoretisieren, das mit bestimmten ‚Lieblingsallgemeinbegriffen‘ operiert und sie auch anderen ‚ansinnen‘ will.“ (282) Moritz Brandt nennt das mit einem Begriff, der ihm selbst nicht richtig zu gefallen scheint, einen „situativen Relativismus“, der für ein bestimmtes Handeln in einer bestimmten Situation keine in allgemeinen Begriffen, also für andere verständliche Begründung mehr abgeben kann (282). Diese Mystik, von der Brandt spricht, kann doch dann nichts anderes als ein Glaube sein, wenn auch ein höchst individueller, ein religiöser Glaube, der rein subjektiv bleibt wie alle mystische Erfahrung, ohne Bindung an eine Institution. Diese Haltung des situativen Relativismus wird durch dauerndes Üben
Moritz Brandt nennt das mit einem Begriff, der ihm selbst nicht richtig zu gefallen scheint, einen „situativen Relativismus“, der für ein bestimmtes Handeln in einer bestimmten Situation keine in allgemeinen Begriffen, also für andere verständliche Begründung mehr abgeben kann (282). Diese Mystik, von der Brandt spricht, kann doch dann nichts anderes als ein Glaube sein, wenn auch ein höchst individueller, ein religiöser Glaube, der rein subjektiv bleibt wie alle mystische Erfahrung, ohne Bindung an eine Institution. Diese Haltung des situativen Relativismus wird durch dauerndes Üben Von dieser Durchlässigkeit und Weisheit her öffnet sich Brandt der Frage, ob ein Paar Kinder bekommen soll oder nicht. Die einen entscheiden sich dagegen, weil sie das Leid auf der Erde nicht noch vergrößern wollen. Die anderen entscheiden sich dafür, weil Kinder später Kultur sinnvoll aufbauen können. Aber diese beiden antagonistischen Positionen bleiben letztlich abstrakte Spielereien, die nicht zu einer ‚weisen‘ Entscheidung verhelfen, zumal er selbst nie eine Beziehung eingegangen ist.
Von dieser Durchlässigkeit und Weisheit her öffnet sich Brandt der Frage, ob ein Paar Kinder bekommen soll oder nicht. Die einen entscheiden sich dagegen, weil sie das Leid auf der Erde nicht noch vergrößern wollen. Die anderen entscheiden sich dafür, weil Kinder später Kultur sinnvoll aufbauen können. Aber diese beiden antagonistischen Positionen bleiben letztlich abstrakte Spielereien, die nicht zu einer ‚weisen‘ Entscheidung verhelfen, zumal er selbst nie eine Beziehung eingegangen ist. In seinem letzten Essay verabschiedet sich Brandt von der Philosophie zugunsten der Lyrik und der Weisheit: „Kontemplative Kunst wie Weisheit schätzen die Komplexität der Welt und des Lebens und sind nicht bereit, ihre genaue Wahrnehmung dieser Komplexität für Erklärungs- und Verständnisabsichten oder gar für richterliche Rechtfertigungs- oder Bekenntnisprojekte zu opfern, die nur um den Preis von Abstraktionen und Vereinfachungen realisierbar sind.“ (327f.) Das Plädoyer für Weisheit wird allerdings in einem ganz merkwürdigen Verwaltungsjargon artikuliert. Brandts Essay nimmt neben diesem Jargon etwas sehr Predigthaftes und Moralisierendes an (bes. 330f.), etwa wenn gesagt wird, Weisheit überwinde die Vereinfachungen der Politik: „Wenn, wie Carl Schmitt behauptet hat, das Politische da existiert, wo es den Unterschied zwischen Freund und Feind gibt, dann ist die Weisheit (und auch die Poesie) sogar antipolitisch, weil sie die Differenz zwischen Freund und Feind aufheben, als Resultat von Vereinfachungen ansehen will.“ (330) Ich habe von predigthaftem Ton gesprochen, weil sich Brandt in seinem dritten Essay vom Philosophen in einen Propheten verwandelt. Aaron Fisch liest diese Ausführungen über Mystik und Weisheit in seinem abgekapselten Haus, während draußen apokalyptische Kämpfe toben. Brandt beruft sich plötzlich und nicht ohne Grund auf Jesus von Nazareth: „Denn Politik hat als letztes Mittel immer den gewaltsamen Kampf. Jesus dagegen heilte das Ohr des Malchus und ließ sich kreuzigen. (…) Sein Reich war nicht von dieser Welt.“ (331)
In seinem letzten Essay verabschiedet sich Brandt von der Philosophie zugunsten der Lyrik und der Weisheit: „Kontemplative Kunst wie Weisheit schätzen die Komplexität der Welt und des Lebens und sind nicht bereit, ihre genaue Wahrnehmung dieser Komplexität für Erklärungs- und Verständnisabsichten oder gar für richterliche Rechtfertigungs- oder Bekenntnisprojekte zu opfern, die nur um den Preis von Abstraktionen und Vereinfachungen realisierbar sind.“ (327f.) Das Plädoyer für Weisheit wird allerdings in einem ganz merkwürdigen Verwaltungsjargon artikuliert. Brandts Essay nimmt neben diesem Jargon etwas sehr Predigthaftes und Moralisierendes an (bes. 330f.), etwa wenn gesagt wird, Weisheit überwinde die Vereinfachungen der Politik: „Wenn, wie Carl Schmitt behauptet hat, das Politische da existiert, wo es den Unterschied zwischen Freund und Feind gibt, dann ist die Weisheit (und auch die Poesie) sogar antipolitisch, weil sie die Differenz zwischen Freund und Feind aufheben, als Resultat von Vereinfachungen ansehen will.“ (330) Ich habe von predigthaftem Ton gesprochen, weil sich Brandt in seinem dritten Essay vom Philosophen in einen Propheten verwandelt. Aaron Fisch liest diese Ausführungen über Mystik und Weisheit in seinem abgekapselten Haus, während draußen apokalyptische Kämpfe toben. Brandt beruft sich plötzlich und nicht ohne Grund auf Jesus von Nazareth: „Denn Politik hat als letztes Mittel immer den gewaltsamen Kampf. Jesus dagegen heilte das Ohr des Malchus und ließ sich kreuzigen. (…) Sein Reich war nicht von dieser Welt.“ (331) Hampe hat Aaron Fischs Lektüre der drei Essays auf vier Tage verteilt. Es wird deutlich (355), daß der schwärzeste Essay über das Nichts am Heiligen Abend (24.Dezember) verlesen wurde. Am vierten Tag werden die Tagebucheinträge Brandts gelesen, aus der Zeit, nachdem der Hirntumor entdeckt worden war. Die Krankheit, auch wenn es furchtbar klingt, das zu schreiben, wirkt als Versatzstück der Geschichte hölzern und konstruiert, auf eine bestimmte Weise unglaubwürdig. Am Ende bleibt nur das digitale Archiv, Kagami, denn unter dem Manuskript steht ein Dateiname, der auf das Archiv hindeutet. Das Manuskript bzw. die gespeicherte Datei erscheint so wie das apokalyptische Buch des Lebens, das die Apokalypse selbst überdauert.
Hampe hat Aaron Fischs Lektüre der drei Essays auf vier Tage verteilt. Es wird deutlich (355), daß der schwärzeste Essay über das Nichts am Heiligen Abend (24.Dezember) verlesen wurde. Am vierten Tag werden die Tagebucheinträge Brandts gelesen, aus der Zeit, nachdem der Hirntumor entdeckt worden war. Die Krankheit, auch wenn es furchtbar klingt, das zu schreiben, wirkt als Versatzstück der Geschichte hölzern und konstruiert, auf eine bestimmte Weise unglaubwürdig. Am Ende bleibt nur das digitale Archiv, Kagami, denn unter dem Manuskript steht ein Dateiname, der auf das Archiv hindeutet. Das Manuskript bzw. die gespeicherte Datei erscheint so wie das apokalyptische Buch des Lebens, das die Apokalypse selbst überdauert. Liest man das Buch als philosophischen Entwurf, dann fällt auf, wie konstruiert der plot wirkt, wie klischeehaft und platt sich manche Elemente der Erzählung und der Figuren in den Roman integrieren. Im Fall der Lektüre als Philosophie richtet sich die Aufmerksamkeit auf die drei Essays. Die Rahmengeschichte rückt in den Hintergrund. Das Braten von Spiegeleiern, das Aufkochen von Porridge, die Reflexionen über das Hamstern von Feinkost wirken dann merkwürdig, wenn nicht fehl am Platz. Das gilt auch für den Photorealismus der über das Buch verteilten Bilder. Sie erzeugen eine künstliche Authentizität.
Liest man das Buch als philosophischen Entwurf, dann fällt auf, wie konstruiert der plot wirkt, wie klischeehaft und platt sich manche Elemente der Erzählung und der Figuren in den Roman integrieren. Im Fall der Lektüre als Philosophie richtet sich die Aufmerksamkeit auf die drei Essays. Die Rahmengeschichte rückt in den Hintergrund. Das Braten von Spiegeleiern, das Aufkochen von Porridge, die Reflexionen über das Hamstern von Feinkost wirken dann merkwürdig, wenn nicht fehl am Platz. Das gilt auch für den Photorealismus der über das Buch verteilten Bilder. Sie erzeugen eine künstliche Authentizität. Sie illustrieren den Bildungsweg Brandts, aber er selbst nimmt sie in ihrer philosophischen Theologie nicht ernst. Der Lyriker-Philosoph Brandt stellt die Frage nach dem Tod und verwirft jede objektivierende Metaphysik. Brandts realistische Eschatologie besteht dann darin, dass er das Weiterleben nach dem Tod nur im Fortleben der eigenen Kinder, also in einem Natalismus denken kann. Die zweite Antwort besteht in der Option für eine mystische, am Zen Buddhismus orientierte Weisheit, die an die Stelle objektivierender Philosophie tritt. Diese Weisheit erkennt die unendliche Komplexität der Wirklichkeit an, sie verzichtet auf die allgemeine Beantwortung abstrakter Fragen, und sie begnügt sich damit, daß das Ich intuitiv auf ‚Situationen‘ reagiert, mit denen es konfrontiert wird. Sowohl Weisheit (in Gestalt der Weisheitsbücher des Alten Testaments) als auch Mystik sind im Protestantismus vernachlässigte Formen theologischer Reflexion. Aus der philosophischen Distanz ruft Michael Hampe mit diesem Roman zur Wiederbelebung des Gesprächs.
Sie illustrieren den Bildungsweg Brandts, aber er selbst nimmt sie in ihrer philosophischen Theologie nicht ernst. Der Lyriker-Philosoph Brandt stellt die Frage nach dem Tod und verwirft jede objektivierende Metaphysik. Brandts realistische Eschatologie besteht dann darin, dass er das Weiterleben nach dem Tod nur im Fortleben der eigenen Kinder, also in einem Natalismus denken kann. Die zweite Antwort besteht in der Option für eine mystische, am Zen Buddhismus orientierte Weisheit, die an die Stelle objektivierender Philosophie tritt. Diese Weisheit erkennt die unendliche Komplexität der Wirklichkeit an, sie verzichtet auf die allgemeine Beantwortung abstrakter Fragen, und sie begnügt sich damit, daß das Ich intuitiv auf ‚Situationen‘ reagiert, mit denen es konfrontiert wird. Sowohl Weisheit (in Gestalt der Weisheitsbücher des Alten Testaments) als auch Mystik sind im Protestantismus vernachlässigte Formen theologischer Reflexion. Aus der philosophischen Distanz ruft Michael Hampe mit diesem Roman zur Wiederbelebung des Gesprächs.