
Weltbegebenheiten |
Schach in GeleeBemerkungen zum Verhältnis von öffentlicher Theologie und politischer Ethik der Macht, dargestellt am Beispiel der Serie „House of Cards“ und der Tudor-Romane Hilary MantelsWolfgang Vögele I. Die Krake der Systemrelevanz
Wenn der Vorwurf mangelnder Systemrelevanz also jeglicher sachlicher Vernunft entbehrt[1], so muss man konzedieren, dass die Theologen, die sich des Begriffs bedienten, nach Aufmerksamkeit heischten, um dann jeweils theologische Empfehlungen anzuschließen, die regelmäßig nur die eigenen geliebten Steckenpferde in den Vordergrund rückten. Langjährige theologische Beobachter kennen die Steckenpferde schon seit langem. Da wird dann plötzlich eine „realistische“ Anthropologie der „Vulnerabilität“ wolkig aufgebauscht, die doch in ihrer latinisierten Wissenschaftlichkeit nur dürftig kaschiert, dass sich dahinter verbirgt, was schon seit Jahrhunderten als realistisch bekannt ist. In der aufgeregten und aufgeplusterten gegenwärtigen Auseinandersetzung steht noch immer das Verhältnis von Ethik, Theologie und Politik zur Debatte, sowohl in ihrer populären theologiejournalistischen Form als auch bei den unaufgeregteren Debatten, die das Verhältnis von Religion und Gesellschaft interdisziplinär klären wollten.
Es zeigte sich, dass theologische und ethische Reflexionen stets von neuem durch die Ereignisse der Wirklichkeit eingeholt und manchmal auch ausgehebelt werden. Die Loccumer Szene steht emblematisch für das Verhältnis von Politik und Reflexion, sei sie ethisch, philosophisch oder theologisch. Denn es wäre ja naiv anzunehmen, dass sich politische, soziale und religiöse Weltläufte nach den Regeln Loccumer Arbeitsgruppen oder nach den Pamphleten von Theologen richten, die sich nach einer angeblichen Systemrelevanz der Kirchen sehnen. Politische, ethische, theologische Theorie scheint stets von der Wirklichkeit überboten zu werden. Intellektuelle Zuordnungen erweisen sich als regelmäßig als unzureichend. In den letzten beiden Jahrzehnten hat das die Stellung der Intellektuellen in der Öffentlichkeit nachhaltig geschwächt. Dasselbe gilt für die Stellung der Theologen in der Kirche. Diese Erkenntnis der geringen Reichweite vernünftigen Argumentierens erwies sich als nachhaltige Kränkung.
Die Diskussion über das Kontingente in der Politik ist jedenfalls in der theologischen Ethik in den letzten beiden Jahrzehnten nie abgebrochen, sie musste aber stets mit der Schwierigkeit kämpfen, dass der Begriff der öffentlichen Theologie stets umstritten war und sich nie vollständig durchsetzen konnte. Öffentliche Theologie ist als klischeehaft und positionell bezeichnet worden, man monierte, dass es einem Begriff wie der öffentlichen Theologie immer noch an Prägnanz und Deutungskraft mangele. Deswegen erscheint es an der Zeit, in der ethischen Reflexion Experimente zu wagen, die nicht mehr die ausgetretenen Wege beschreiten, sondern versuchen, Neuland zu betreten. Dies soll geschehen, indem ich das Verhältnis von Politik und Religion am Beispiel einer Fernsehserie und eines historischen Romans untersuche. Das mag auf den ersten Blick verblüffend erscheinen, aber schon der Film „Contagion“[4] des Regisseurs Steven Soderbergh nahm dramatisierend und zuspitzend vieles von dem vorweg, was Gesellschaften und Staaten in den Zeiten des Shutdown während der Corona-Epidemie 2020 erlebten. Mit dieser Konzentration auf zwei ästhetische Formen der Darstellung von Politik soll nicht suggeriert werden, dass ich die Unterschiede zwischen ‚richtiger‘ Politik und ihrer kulturellen oder ästhetischen Darstellung nicht mehr ernstnehme. Sie bestehen sehr wohl, aber ich habe mich von der Vermutung leiten, dass die ästhetische Darstellung von Politik mit Sicherheit Probleme aufnimmt, die auch unter ‚realen‘ Verhältnissen virulent sind. Insbesondere an den historisierenden Romanen Hilary Mantels wird sich zeigen, wie sie gegenwartsrelevante Fragestellungen bearbeiten, ohne dabei die historische Dimension aus den Augen zu verlieren. Mich interessiert an der ästhetischen Darstellung von Politik vor allem der Umgang mit Kontingenz, und ich habe die Vermutung, dass daraus etwas für Ethik und Politik zu lernen wäre.
Um diese Verhältnisse zu analysieren, sind besondere Methoden und methodische Vorentscheidungen nötig. Es geht nicht um eine ausführliche Inhaltsangabe der beiden Werke. Der Inhalt beider Werke wird vorausgesetzt. In beiden Fällen ist die ‚story‘ im Übrigen banal. In „House of Cards“ wird der Weg eines Kongressabgeordneten zum amerikanischen Präsidentenamt erzählt. Als er stirbt, übernimmt seine Frau das Amt. In der Tudor-Trilogie erzählt Hilary Mantel den Aufstieg von Thomas Cromwell zum Hauptberater Heinrichs VIII. Er wird hingerichtet, als er nicht mehr leisten kann, was der König von ihm erwartet. Das kennt jeder sowieso aus dem Geschichtsunterricht. Es geht mir um ein „close reading“ von Serie und Romanen, die auf die spezifische Fragestellung von Kontingenz, Vernunftgebrauch und politischer Ethik zugespitzt wird. Dabei wird eine Fülle von Details erwähnt, die alle auf das Verhältnis von Politik, Ethik und Religion bezogen sind. Diejenigen Leser des Essays, die danach noch die Serie schauen oder die Romane lesen wollen, könnten das als Spoiler missverstehen. Ihnen wird geraten, sich zuerst in Serie und Roman zu vertiefen, bevor sie diese Analyse konsultieren. Zwei wichtige Themen seien von vornherein ausgeklammert: 1. Ich unterscheide nicht zwischen Serie als visuellem und Roman als literarischem Format. Das scheint mir für das Thema der politischen Ethik nicht von Belang, zumal die ersten beiden Teile der Trilogie von Hilary Mantel auch in eine Fernsehserie umgewandelt worden sind. Diese Serie besitzt allerdings Schwächen, welche der Roman mehr als kompensiert. Davon wird noch zu reden sein. 2. Selbstverständlich ist mir klar, dass Thomas Cromwell (1485-1540) eine historische Figur des 16.Jahrhunderts ist. Dennoch gehe ich nicht auf die Differenzen ein, die zwischen Mantels Cromwell und der historischen Figur bestehen. Das ist eine Sache der Historiker. Stattdessen gehe ich davon aus, dass Mantel Cromwell mit guten Gründen als jemanden ausgewählt hat, der für die Gegenwart (des Großbritannien, das im Brexit die Europäische Union verlassen hat) ein außerordentlich aktuelles Beispiel eines vernünftig, aber gelegentlich auch skrupellos abwägenden Politikers abgibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine einfache Gliederung. Nach diesen einleitenden Bemerkungen (I.), die das Unbehagen an den Diskussionen über politische Ethik und öffentliche Theologie zum Anlass nehmen, eine neue Fragestellung zu entwickeln, dienen die folgenden beiden Abschnitte der Skizzierung der gegenwärtigen Lage von öffentlicher Theologie (II.) und politischer Ethik (III.). Danach folgt eine Reflexion zur Geschichte des politischen Romans, in deren Kontext sowohl die Serie als auch die Romantrilogie hineingestellt sind (IV.). Die folgenden beiden Hauptteile beschäftigen sich mit der Serie „House of Cards“ (V.) und vor allem dem dritten Band, „Spiegel und Licht“ von Mantels Trilogie (VI.). Dem schließt sich ein Vergleich zentraler Punkte an (VII.), und am Ende stehen theologische und ethische Schlussfolgerungen (VIII.) und ein Schlusswort (IX.). -> Forts.: II. Krise der Öffentlichen Theologie? Anmerkungen[1] Als Ausnahmebeispiel für einen nachdenklichen Essay, der gerade deshalb lesenswert ist, weil er die ekklesiale Aufregung ignoriert: Notger Slenczka, Was haben wir zu sagen? Corona und unsere Rede von Gott, Zeitzeichen 15.6.2020, https://zeitzeichen.net/node/8365 . [2] Diese Episode, leider begründet in einem unerwarteten und schrecklichen Ereignis, begründete eine Reihe von Begegnungen bei Tagungen und Konferenzen, weswegen dieser Essay Jörn Rüsen gewidmet wird. [3] Gerhard Kruip, Wolfgang Vögele (Hg.), Schatten der Differenz. Das Paradigma der Anerkennung und die Realität gesellschaftlicher Konflikte, Philosophie aktuell. Veröffentlichungen aus der Arbeit des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, Bd.4, Hamburg 2006. [4] Steven Soderbergh, Contagion, 2011. [5] Wolfgang Vögele, Kriminaldauerdienst. Eine Spurensicherung zu Erzähltheorie und Theologie des Krimis in sechsundvierzig Indizien, tà katoptrizómena, Heft 104, Dezember 2016, https://www.theomag.de/104/wv27.htm. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/127/wv061.htm |
 Seit sich im März 2020 die Corona-Pandemie in den Ländern des Westens und Ostens ausbreitete, geistert, was die Kirchen angeht, das böse Wort von der fehlenden „Systemrelevanz“ der Kirchen durch die öffentlichen Debatten. Zu klaglos habe man die öffentlichen Gottesdienste eingestellt, habe weitgehende Einschränkungen der Religionsfreiheit zu gehorsam akzeptiert und habe überhaupt nicht zeigen können, wie Kirchen und Religionsgemeinschaften schon immer zu gelingendem gesellschaftlichen Leben beitragen. Man habe sich kirchlicherseits darauf beschränkt in einer unverhofften Wiedergeburt des alten protestantischen Obrigkeitsgehorsams die Anweisungen von Exekutive und Epidemiologen zu befolgen. Die Rückfrage an die Vertreter dieses merkwürdigen Arguments müsste lauten: Was hätte man denn sonst tun sollen? Der öffentliche Shutdown führte zu einer zugegeben merkwürdigen Blüte digitaler Selbstversuche der Kirchen, die deutlich machten, wieviel in den vergangenen Jahrzehnten an Modernitätsanpassung versäumt wurde. Aber wäre es „systemrelevant“ gewesen, weiter Gottesdienste zu feiern, wenn Opern- und Theateraufführungen, Kinovorstellungen und Vorträge strikt aus dem einzigen Grund nicht stattfanden, um die Anballung großer Menschenmengen und damit die Ausbreitung des Virus zu verhindern? Welche Gründe könnte es geben, ausgerechnet die Kirchen von solchen Versammlungsverboten auszunehmen, wenn man nicht, wie einige sektiererhafte russlanddeutsche Freikirchen oder Splittergrüppchen am rechten Rand des katholischen Fundamentalismus annehmen wollte, Gott selbst schaffe epidemiologische Freiräume zur Feier von Abendmahl und Gottesdienst und man könne so, im Glauben durch eine besondere Wahrheit ausgezeichnet, medizinische Schutzmaßnahmen ignorieren? Man kann das behaupten, aber man muss sich dann auch gefallen lassen, dass ein solches substantialistisches Verständnis des Abendmahls die Grenzen von Aberglaube und Magie mindestens streift.
Seit sich im März 2020 die Corona-Pandemie in den Ländern des Westens und Ostens ausbreitete, geistert, was die Kirchen angeht, das böse Wort von der fehlenden „Systemrelevanz“ der Kirchen durch die öffentlichen Debatten. Zu klaglos habe man die öffentlichen Gottesdienste eingestellt, habe weitgehende Einschränkungen der Religionsfreiheit zu gehorsam akzeptiert und habe überhaupt nicht zeigen können, wie Kirchen und Religionsgemeinschaften schon immer zu gelingendem gesellschaftlichen Leben beitragen. Man habe sich kirchlicherseits darauf beschränkt in einer unverhofften Wiedergeburt des alten protestantischen Obrigkeitsgehorsams die Anweisungen von Exekutive und Epidemiologen zu befolgen. Die Rückfrage an die Vertreter dieses merkwürdigen Arguments müsste lauten: Was hätte man denn sonst tun sollen? Der öffentliche Shutdown führte zu einer zugegeben merkwürdigen Blüte digitaler Selbstversuche der Kirchen, die deutlich machten, wieviel in den vergangenen Jahrzehnten an Modernitätsanpassung versäumt wurde. Aber wäre es „systemrelevant“ gewesen, weiter Gottesdienste zu feiern, wenn Opern- und Theateraufführungen, Kinovorstellungen und Vorträge strikt aus dem einzigen Grund nicht stattfanden, um die Anballung großer Menschenmengen und damit die Ausbreitung des Virus zu verhindern? Welche Gründe könnte es geben, ausgerechnet die Kirchen von solchen Versammlungsverboten auszunehmen, wenn man nicht, wie einige sektiererhafte russlanddeutsche Freikirchen oder Splittergrüppchen am rechten Rand des katholischen Fundamentalismus annehmen wollte, Gott selbst schaffe epidemiologische Freiräume zur Feier von Abendmahl und Gottesdienst und man könne so, im Glauben durch eine besondere Wahrheit ausgezeichnet, medizinische Schutzmaßnahmen ignorieren? Man kann das behaupten, aber man muss sich dann auch gefallen lassen, dass ein solches substantialistisches Verständnis des Abendmahls die Grenzen von Aberglaube und Magie mindestens streift. An folgender Geschichte lässt sich das leicht illustrieren. Im September 2001 tagte an der Evangelischen Akademie Loccum ein kleiner Arbeitskreis, der sich mit der Frage beschäftigte, inwiefern sich unterschiedliche Religionen gegenseitig anerkennen müssen, um ihre Konfliktpotentiale untereinander so stillzustellen, das gemeinsame Projekte und Entwicklungen nicht behindert werden. Der Arbeitskreis nannte sich „Kulturen der Anerkennung“, und man beabsichtigte, eine gemeinsame Tagung zu den benannten Fragen zu veranstalten, aus dem sich Forschungsprojekte und vielleicht ein auf längere Zeit projektierter Arbeitskreis bilden sollten. In der Bibliothek der Loccumer Akademie saßen, auch in Erwartung des Nachmittagskaffees unter anderem Jörn Rüsen
An folgender Geschichte lässt sich das leicht illustrieren. Im September 2001 tagte an der Evangelischen Akademie Loccum ein kleiner Arbeitskreis, der sich mit der Frage beschäftigte, inwiefern sich unterschiedliche Religionen gegenseitig anerkennen müssen, um ihre Konfliktpotentiale untereinander so stillzustellen, das gemeinsame Projekte und Entwicklungen nicht behindert werden. Der Arbeitskreis nannte sich „Kulturen der Anerkennung“, und man beabsichtigte, eine gemeinsame Tagung zu den benannten Fragen zu veranstalten, aus dem sich Forschungsprojekte und vielleicht ein auf längere Zeit projektierter Arbeitskreis bilden sollten. In der Bibliothek der Loccumer Akademie saßen, auch in Erwartung des Nachmittagskaffees unter anderem Jörn Rüsen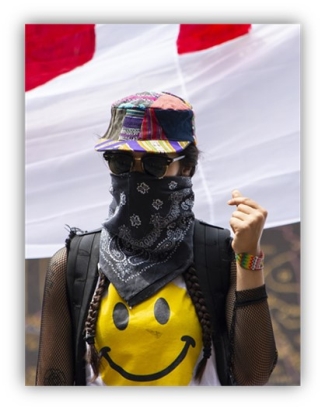 Allerdings ist es auch möglich, die Perspektive zu wechseln und das Verhältnis von Politik und Reflexion so zu bestimmen, dass Überraschungen und Fehleinschätzungen in die Argumentation eingeholt werden. Ethische Reflexion stellt sich adäquater auf die kontingenten Vorgaben der Wirklichkeit ein: Sie rechnet mit dem Unberechenbaren. In der theologischen Ethik wird dieses Problem unter Stichworten wie „politische“ oder „öffentliche Theologie“ verortet, in letzter Zeit auch unter dem Stichwort einer „ökumenischen Ethik“, welche die Konfessionsgrenzen überwindet. In der politischen Ethik kommt diese Frage unter dem Gegensatz zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, den Max Weber 1919 entwickelt hat, zu stehen.
Allerdings ist es auch möglich, die Perspektive zu wechseln und das Verhältnis von Politik und Reflexion so zu bestimmen, dass Überraschungen und Fehleinschätzungen in die Argumentation eingeholt werden. Ethische Reflexion stellt sich adäquater auf die kontingenten Vorgaben der Wirklichkeit ein: Sie rechnet mit dem Unberechenbaren. In der theologischen Ethik wird dieses Problem unter Stichworten wie „politische“ oder „öffentliche Theologie“ verortet, in letzter Zeit auch unter dem Stichwort einer „ökumenischen Ethik“, welche die Konfessionsgrenzen überwindet. In der politischen Ethik kommt diese Frage unter dem Gegensatz zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, den Max Weber 1919 entwickelt hat, zu stehen. Dies ist nicht das erste Experiment, das ich in dieser Richtung unternehme. Bei der Untersuchung von Fernsehkrimis
Dies ist nicht das erste Experiment, das ich in dieser Richtung unternehme. Bei der Untersuchung von Fernsehkrimis