Evangelische Bekenntnisse und Glaubenswahrheiten
unter den Bedingungen des Pluralismus
Wolfgang Vögele
0. Gliederung
1. Ist die Union eine Partei?
2. Schneisen zwischen Fundamentalismus und Relativismus
3. Eine Wahrheit des Glaubens (Notger Slenczka)
4. Relativismus in der Gesellschaft
5. Eine Theologie der Gesprächsbereitschaft
6. Ist die Union eine Lösung?
7. Gänseblümchen und Brombeerhecke
8. Angewiesen auf Wahrheit
1. Ist die Union eine Partei?
 In den spröden Nullerjahren wechselte ich beruflich zu einer evangelischen Institution in Berlin, und im Beirat dieser Einrichtung saß auch ein Alt-Bundespräsident. Nach Beginn meiner Arbeit ließ ich mir in seinem Büro einen Termin geben und lief Tage später, am frühen Nachmittag eines trügen, nebligen Herbsttages hinüber in Richtung Museumsinsel, um mich vorzustellen. Das schmucklose Büro lag in einem gesichtslosen Gebäude, gegenüber dem Pergamon-Museum. Richard von Weizsäcker (1920-2015) begrüßte mich freundlich, wir setzten uns, eine Sekretärin servierte Earl Grey in Porzellantassen. Wir machten uns bekannt, erzählten von den Projekten, die wir verfolgten. Selbstverständlich hatte ich eines meiner Bücher als Geschenk mitgebracht. Weizsäcker gab sich so, wie ich ihn später noch oft erleben sollte: freundlich, verbindlich, interessiert, im politischen und intellektuellen Urteil messerscharf und unbestechlich; Geschwätz und wolkiges Gerede konnten ihn ärgern.
In den spröden Nullerjahren wechselte ich beruflich zu einer evangelischen Institution in Berlin, und im Beirat dieser Einrichtung saß auch ein Alt-Bundespräsident. Nach Beginn meiner Arbeit ließ ich mir in seinem Büro einen Termin geben und lief Tage später, am frühen Nachmittag eines trügen, nebligen Herbsttages hinüber in Richtung Museumsinsel, um mich vorzustellen. Das schmucklose Büro lag in einem gesichtslosen Gebäude, gegenüber dem Pergamon-Museum. Richard von Weizsäcker (1920-2015) begrüßte mich freundlich, wir setzten uns, eine Sekretärin servierte Earl Grey in Porzellantassen. Wir machten uns bekannt, erzählten von den Projekten, die wir verfolgten. Selbstverständlich hatte ich eines meiner Bücher als Geschenk mitgebracht. Weizsäcker gab sich so, wie ich ihn später noch oft erleben sollte: freundlich, verbindlich, interessiert, im politischen und intellektuellen Urteil messerscharf und unbestechlich; Geschwätz und wolkiges Gerede konnten ihn ärgern.
Irgendwann fragte er nach meiner Dissertation, und ich begann, über das Phänomen der Zivilreligion in der Bundesrepublik zu berichten. Und er runzelte schon die Stirn, als ich Rousseaus Konzept der religion civile erläuterte. Er wollte nicht glauben, dass nach Rousseau jeder Staatsbürger ein politisch-theologisches Bekenntnis ablegen müsse, um politische Verantwortung zu übernehmen. Ich erläuterte, dass es solche Verbindlichkeiten in der Bundesrepublik nicht gebe. Trotzdem manifestiere sich eine bundesdeutsche Zivilreligion in den Reden von Politikern, unter anderem in seinen Reden, die er als Bundespräsident gehalten haben. Da wirkte er verärgert, das wollte er überhaupt nicht wahrhaben. Selbstverständlich habe er als Bundespräsident inhaltliche Impulse gegeben, aber niemals jemanden zu seiner Meinung zwingen wollen.
Er erzählte dann, er sei als junger Mann bewusst in die Christlich-Demokratische Union eingetreten, weil die Union keine Partei sei. Eine Partei zeichne sich dadurch aus, dass sie sich ein Grundsatzprogramm gebe, das alle Mitglieder gemeinsam mittrügen und vertreten würden. Eine Union dagegen sei keine Partei, sondern eine Vereinigung von Menschen unterschiedlicher politischer Interessen, die zwar zusammen politische Ziele verfolgen, aber sich eben kein gemeinsames inhaltliches Programm gegeben haben. Das Gespräch nahm schnell eine andere Wendung, zumal die Stunde des Termins schon beinahe vorbei war und der nächste Besucher wartete.
Ich habe später über diese Bemerkung zur Union lange nachgedacht. Denn eigentlich widerspricht sie politischer und sozialer Allgemeinbildung und herrschender Meinung. Alle politischen Beobachter würden die CDU analog zur FDP, SPD, den Grünen und Linken für eine Partei halten. Wenn es den im Unionsbegriff angelegten innerparteilichen Pluralismus je gegeben hätte, so hat er sich längst verschliffen, zumal es auch nicht stimmt, dass die Union nie ein Grundsatzprogramm hatte. Seit dem Ahlener Programm von 1947 hat sich die CDU sequentiell sogar mehrere Grundsatzprogramme gegeben. Insofern hielt ich vor und bei meinem Besuch beim Altbundespräsidenten auch die CDU für eine völlig normale Partei, die sich von den Sozialdemokraten in diesem Bereich höchstens darin unterschied, dass dem Grundsatzprogramm dort etwas mehr Bedeutung zugemessen wurde. Ich wusste bei meinem Besuch auch nicht, dass eine Parteimitgliedschaft aus naheliegenden Gründen für Bundespräsidenten während ihrer Amtszeit ruht und dann im Regelfall nach dem Ende der höchstens zwei Amtszeiten wieder aufgenommen wird. Genau das aber hatte Richard von Weizsäcker nach dem Ende seiner Amtszeit nicht getan, was innerhalb der Christlich-Demokratischen Union sehr wohl wahrgenommen wurde.
Der Unionsbegriff, um den es in diesem Essay gehen soll, kann in unterschiedlichen gesellschaftlichen Partitionen verwendet werden: für eine Partei oder eine politische Vereinigung im Sinne Weizsäckers, für einen Staatenverbund (Europäische Union), für Fußballvereine (1.FC Union Berlin, Union 1861 Schönebeck), für Wirtschaftsunternehmen (Auto Union, Union Investment), für Verbände (Union der italienischen Speiseeishersteller), für Kirchen und Bekenntnisse (unierte Landeskirchen, badische Unionsurkunde). Es ist zu bezweifeln, ob die Momente des Politischen, Kirchlichen, Ökonomischen und Sportlichen sich im Unionsbegriff vermischen. Man kann nicht für jede Union einen besonderen Binnenpluralismus annehmen, sondern es gilt, die jeweiligen Besonderheiten zu untersuchen.
2. Schneisen zwischen Fundamentalismus und Relativismus
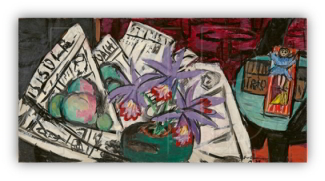 Der Begriff der Union schillert und wird in vielen Bereichen verwendet. Evangelische Kirchen besitzen für ihn keineswegs ein Deutungsmonopol, fügen aber seiner theologischen Eigenart interessante Facetten hinzu. Das zweihundertjährige Jubiläum der Unionsurkunde der Badischen Landeskirche will ich nun zum Anlass einer theologischen Reflexion über Bekenntnisse, Wahrheit und Unionsbegriff nehmen. Es sollen nicht ein weiteres Mal die problematischen Aspekte der merkwürdigen Werbekampagne zum Unionsjubiläum beleuchtet werden, die Fußball[1] und Bekenntnis zu einem veritablen Eigentor miteinander vermengte und sich an provinziell beleuchteten ‚Erinnerungsorten‘ verhob.[2]
Der Begriff der Union schillert und wird in vielen Bereichen verwendet. Evangelische Kirchen besitzen für ihn keineswegs ein Deutungsmonopol, fügen aber seiner theologischen Eigenart interessante Facetten hinzu. Das zweihundertjährige Jubiläum der Unionsurkunde der Badischen Landeskirche will ich nun zum Anlass einer theologischen Reflexion über Bekenntnisse, Wahrheit und Unionsbegriff nehmen. Es sollen nicht ein weiteres Mal die problematischen Aspekte der merkwürdigen Werbekampagne zum Unionsjubiläum beleuchtet werden, die Fußball[1] und Bekenntnis zu einem veritablen Eigentor miteinander vermengte und sich an provinziell beleuchteten ‚Erinnerungsorten‘ verhob.[2]
Wie Richard von Weizsäcker politisch zwischen Partei und Union unterschied, so könnte man theologisch fragen, ob sich lutherische und reformierte Kirchen von unierten Kirchen unterscheiden. Mit dem Text der Unionsurkunde der Badischen Landeskirche[3] wollte der Großherzog gerade die Unterschiede zwischen reformiertem und lutherischem Bekenntnis auf badischem Territorium überwinden. Es stellen sich dabei mehrere Fragen: Wie ist der Glaube von Gemeinden historisch und aktuell in einem oder mehreren Bekenntnissen fixiert? Welchen Stellenwert nehmen diese schriftlich fixierten und durch die Grundordnung bekräftigten Bekenntnisse ein? Wie werden solche Bekenntnisse heute möglicherweise neu interpretiert? Die Unterschiede werden schnell deutlich, wiederum am Beispiel der Unionsurkunde: Während die Gemeindeglieder des frühen 19. Jahrhunderts einen Konsens ausschließlich in der Abendmahlsfrage formulierten, so wird diese Urkunde heute eigentlich gar nicht mehr als Konsensdokument, sondern als Legitimationsdokument eines innerkirchlichen, eines ökumenischen und sogar eines interreligiösen Pluralismus gelesen. Und es wäre zu fragen, ob die historische Auslegung der Urkunde die letzten beiden Interpretationsstrategien überhaupt zulässt. Man kann in gegenwärtigen kirchlichen Stellungnahmen eine gewisse Scheu und Zurückhaltung vor inhaltlichen Stellungnahmen spüren, um nur ja nicht aus Angst vor eindeutigen Festlegungen diejenigen Menschen, die anderer Meinung sind, nicht aus der Kirche zu verschrecken. Man kann sogar wahrnehmen, dass man in Sachen des Glaubens völlig ohne Not was auch immer an dogmatischen Gehalten (Trinitätslehre, Christologie, Rechtfertigungslehre) preisgibt, während man sich in rebus politicis auf eine moralisierend eindeutige Variante der politischen Theologie kapriziert, deren Probleme von der Besserwisserei über politische Korrektheit bis zur Woke-Kultur hier nicht weiter beschrieben werden sollen. Es könnte so sein, dass im Moment Bekenntnisse und Konsense des Glaubens abgewertet werden zugunsten einer politisierten Kirche, selbst wenn das unter dem Stichwort einer öffentlichen Theologie geschehen sollte – wobei ich der Meinung bin, dass zwischen den moralisierenden politischen Stellungnahmen klerikaler Funktionsträger und dem Projekt einer öffentlichen Theologie weiterhin unterschieden werden sollte.
Um die Fragen dieses Essays auf den Punkt zu bringen, sie lauten: Wie viel gemeinsames inhaltliches Bekenntnis benötigt eine Kirche? Wie viel Differenz in Sachen des Glaubens (Individualisierung, Singularisierung) kann sie ertragen? Diese Fragen erfordern unter den Bedingungen moderner pluralistischer Gesellschaften offensichtlich andere Antworten als im Mittelalter, zur Zeit des Augsburger Religionsfriedens oder des aufgeklärten preußischen Toleranzprinzips. Und das würde heißen: Möglicherweise erfordert das auch andere, nämlich unierte oder uniert erneuerte, Bekenntnisse.
Positionen in dieser Frage werden innerhalb und außerhalb der Kirche vertreten und lassen sich auf einem Spektrum darstellen, das vom sturen und starren Fundamentalismus am einen bis zu einem völligen Relativismus am anderen Ende reicht. Religiöse wie nicht-religiöse Fundamentalisten betrachten ihre eigenen Wahrheiten als absolut richtig und dichten sie gegen alle anderen Positionen ab, die ausdrücklich als falsch, ungläubig, unangemessen, boshaft gekennzeichnet werden. Relativistische Positionen gehen genau umgekehrt vor: Sie lassen alle Meinungen und Positionen gelten und verweigern sich methodisch einer Wahrheits- oder Richtigkeitsentscheidung zwischen verschiedenen Bekenntnis-Positionen. Solche Extreme sind aber für diesen Essay nicht interessant, weil sie im Grunde beide den Pluralismus moderner Gesellschaften faktisch unterlaufen. Der Fundamentalismus lässt nur eine Wahrheit gelten, das ist in modernen Gesellschaften nicht lebbar. Der Relativismus lässt alle Meinungen gelten, damit ist das, was man alteuropäisch (oder altmodisch) die Wahrheitsfrage nennen könnte, völlig suspendiert.
Im Folgenden sollen vermittelnde Zwischenpositionen betrachtet werden, welche alle ausgerichtet sind auf die Frage nach der Legitimation theologischer Bekenntnisse. Zunächst möchte ich auf den scharfsinnigen Versuch Notger Slenczkas eingehen, den bleibenden Wert reformatorischer Bekenntnisse für die Gegenwart zu beschreiben (3.). Seine lutherische Position, die weiter an einem Konsens über eindeutiges Bekenntnis in der Gegenwart festhält, soll sozusagen den Maßstab bilden, um stärker pluralistische und gegenwartsorientierte Modelle zu beschreiben. Gesellschaftlich sind solche Modelle unter dem Blickwinkel der Religionsfreiheit, des Milieus und des Habitus, der Singularisierung und der Anerkennungstheorie vorgestellt worden. Diese nehme ich im nächsten Abschnitt (4.) in den Blick, weil sie die Voraussetzung für gegenwärtige theologische Pluralismusmodelle liefern. Die theologischen Modelle pluralistischer Bekenntnisbildung reagieren auf die Pluralismen der Gegenwart und können beschreiben werden als Moderation, (Bekenntnis-)Freiheit, Kommunikation (5.). Von da aus ist dann auf die theologische Konsensbildung in den Unionen des 19. Jahrhunderts zu blicken (6.). Der auf das Abendmahl bezogene Unionspluralismus wurde in den landeskirchlichen Ekklesiologien des 20.Jahrhunderts konsequent erweitert: Dabei müssen auch kritische Perspektiven eingenommen werden, zum Beispiel gegenüber dem mißlungenen Islam-Papier der Badischen Landeskirche. In einigen theologischen Schlußfolgerungen werde ich mich mit der Frage beschäftigen, wie in dieser Diskussion Wahrheit des Glaubens und Differenzen zu vermitteln sind (7.). Am Ende steht eine Schlußbemerkung, die Perspektiven für die Weiterarbeit zeigt (8.).
3. Eine Wahrheit des Glaubens (Notger Slenczka)
 Im Jahr 2020 hat der Berliner systematische Theologe Notger Slenczka eine Theologie der reformatorischen Bekenntnisschriften vorgelegt[4], die ausdrücklich mehr sein will als deren historische Kontextualisierung und Interpretation. Er erhebt den Anspruch, deutlich zu machen, wie diese Bekenntnisse „auch in die Gegenwart sprechen“ (30). Dabei arbeitet er mit mehreren hermeneutischen Zuspitzungen:
Im Jahr 2020 hat der Berliner systematische Theologe Notger Slenczka eine Theologie der reformatorischen Bekenntnisschriften vorgelegt[4], die ausdrücklich mehr sein will als deren historische Kontextualisierung und Interpretation. Er erhebt den Anspruch, deutlich zu machen, wie diese Bekenntnisse „auch in die Gegenwart sprechen“ (30). Dabei arbeitet er mit mehreren hermeneutischen Zuspitzungen:
1. Der Inhalt dieser Lehrbekenntnisse versteht sich in der Gegenwart nicht von selbst und muss erst aus der Differenz von historischer und aktueller Bedeutung entwickelt werden.
2. Entscheidend ist dafür die Unterscheidung zwischen fides quae und fides qua, die er so auslegt, dass die fides quae, also das manifeste Lehr-Bekenntnis, nicht ignoriert, sondern neu zur Geltung gebracht wird. Glaube kann für ihn nicht liberal auf Vertrauen (fides qua) umgepolt werden.
3. Slenczka reduziert mit Melanchthon (42) die eigentliche Aufgabe der Theologie auf die Entfaltung des Selbstverständnisses des Menschen. Mit Luthers berühmter Definition der Theologie gesprochen: „Theologiae proprium subiectum est homo peccati reus ac perditus et Deus iustificans ac salvator hominis peccatoris. Quicquid extra hoc subiectum in theologia queritur et disputatur, est error et venenum.“[5]
Diese Aussage Luthers formuliert Slenczka so in eigene Worte um: „Nur die Aussagen, die sich auf die Existenz zwischen Sünde und Erlösung hin vermitteln lassen, haben einen Platz in der Theologie. Oder anders: Theologie ist mit allen gegenständlichen Aussagen immer zugleich Auslegung menschlicher Existenz, und die Aussagen, die das nicht sind, haben in der Theologie nichts verloren.“ (43) Damit verfolgt der Theologe nach eigener Aussage eine „programmatische radikale Reduktion, die einer Schwerpunktverlagerung im theologischen Denken entspringt.“ (43) Er nimmt Harnacks Kritik an Lehr-Bekenntnissen ernst (44ff.) und lässt theologisch nur noch diejenigen Lehr-Inhalte gelten, die hermeneutisch beitragen zur Beschreibung der existenziellen Situation des Menschen vor Gott. Letzteres wird als die entscheidende reformatorische Entdeckung qualifiziert.
Der Glaube lässt sich aber nun im Gefolge Harnacks nicht auf ein inhaltlich nicht qualifiziertes Vertrauen reduzieren, sondern gerade die reformatorischen Bekenntnisschriften stehen ein für die inhaltliche Beschreibung dieser existentiellen Situation des Menschen vor Gott. In den Bekenntnisschriften findet Slenczka gerade keinen Katalog verpflichtender christlicher Glaubenssätze, sondern die qualifizierten Voraussetzungen dafür, die „Glauben als Lebensvertrauen“ (53) möglich machen. Damit ist für ihn das Verhältnis von Glaubensvertrauen und konfessorischen Inhalten neu justiert. Dieses neu bestimmte Verhältnis dient als hermeneutischer Schlüssel, um Aktualität der Bekenntnisschriften in der Gegenwart zu zeigen. Die Frage, die demgegenüber zu stellen wäre, würde lauten, ob diese normativ gesetzte existentielle Bekenntnisdeutung nicht doch eine Ontologisierung einer bestimmten menschlichen Situation darstellt, deren Geltung jenseits historischer Relativierungen behauptet wird. Denn im Grunde sagt Slenczka, wenn ich ihn richtig verstehe, nichts anderes als dass die Bestimmung des Menschen als Sünder im Gegenüber zum erlösenden Gott noch heute gilt. Davon später noch mehr. In der Folge seiner Überlegungen wird er diese anthropologischen Erklärungen noch ekklesiologisch zuspitzen: Die Bekenntnisschriften deuten theologisch die existentielle Situation des Menschen und weisen darum der Kirche bestimmte Aufgaben (Evangeliumsverkündigung und Sakramentsverwaltung in CA VII) zu.[6]
Für die systematische Theologie entdeckt Slenczka die Aufgabe, in der Gegenwart als Anwältin und Hermeneutikerin der christlichen (Text-)Tradition zu prüfen, ob sie weiter in Geltung stehen, also Relevanz für die theologische Erklärung des Glaubens haben. Er will also die Bekenntnisschriften aus ihrem historischen Entstehungszusammenhang erklären und ihre bleibende Bedeutung (oder ihre Irrelevanz) für die Gegenwart herausarbeiten. Man kann mit dem Text gehen, oder gegen ihn (57). In diesem Band Slenczkas allerdings fehlt dann eine Analyse der sozialen, kulturellen, theologischen Bedingungen, die sich in, mit und unter der Gegenwart ergeben. In anderen Worten: Es fehlt eine hermeneutische Analyse der aktuellen Situation; stattdessen beschränkt sich Slenczka auf die Durchführung des im Eingangsteils entwickelten historisch-theologischen Programms. Allerdings kündigt er mehrfach einen zweiten Band dieser Theologie der Bekenntnisschriften an, der dann auch den zweiten Schritt des theologischen Programms entfalten wird (60 sowie 92f.) – wobei allerdings nicht ganz klar wird, wie er diese Gegenwartsanalyse theologisch anlegen will.
In der historischen Durchführung seiner Bekenntnisanalyse kommt der Lutheraner Slenczka dann zu erstaunlich positiven Bewertungen der reformierten Bekenntnisschriften; er spricht davon, die Leuenberger Kirchengemeinschaft bekenntnistheologisch weiterentwickeln zu wollen, indem er zeigt, dass diese, das „Modell eines differenzierten Konsenses“ bzw. eine differenziert konsensuelle „Einheit in den Lehrgrundlagen“ (63) schon im 16. Jahrhundert bestand. Wegen der großen Bedeutung, die Slenczka Leuenberg zumisst (71), kann man davon ausgehen, dass er den genaueren Begriff des differenzierten Konsenses dem der Union vorzieht. Als Verwaltungsunion scheint mir dieser Begriff auch eine bürokratisch-klerikale Hilfskonstruktion, die verschleiert, dass die ökumenisch-innerprotestantischen Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Bekenntnis-Unionen, die einen höheren theologischen Anspruch haben, erwähnt Slenczka leider nur an peripherer Stelle (75 Anm. 59). Auch im Abschnitt „Die Diskussionen um das Bekenntnis im 19. Jahrhundert“ (665-667) wird der Unionsbildungsprozess in Landeskirchen wie der Pfalz, Badens und anderer nicht erwähnt.
Diesen Sachverhalt begründet Slenczka nur indirekt. Zum einen kritisiert er die untergeordnete Funktion, welche die Bekenntnisschriften in den Landeskirchen einnehmen. Zwar stünden die Bekenntnisschriften an hervorgehobener Stelle in den Präambeln der Grundordnungen, aber das nehme kein Mensch ernst (77). Der andere Grund scheint mir darin zu liegen, dass Slenczka implizit annimmt, dass der Unionsbildungsprozess des 19. Jahrhunderts sich durch Barmen und Leuenberg überholt hat, weil diese beiden Bekenntnisdokumente weitergehende Ansprüche entfalten. Beide sind ja historisch keinesfalls zu den Bekenntnisschriften der Reformationszeit zu zählen. Slenczka führt dennoch Gründe an, die es für ihn legitimieren, dass diese beiden Schriften die Theologie der Reformation im Sinne seines theologischen Programms ergänzen, erweitern und vertiefen. In dieser Entwicklung, vor allem durch die Konkordie und die europäische Kirchengemeinschaft von Leuenberg, ist dann auch die Unionsbildung aufgehoben. Aber auch er wird nicht bestreiten können, dass die Unionsbildung des 19. Jahrhunderts ein erheblicher Faktor in der ökumenischen Entwicklung war, die Leuenberg erst möglich machte.
Slenczkas Barmen- und Leuenberg-Deutung sind nun in diesem Zusammenhang aus mehreren Gründen interessant. Die Barmer Theologische Erklärung gibt für ihn einen Hinweis auf das Verhältnis von Christentum und Moderne. Er konzediert, dass das Christentum sich schon immer zur theologischen Verständigung externer philosophischer und kultureller Positionen bedient hat. Diese Rezeption geschah aber innerhalb einer theologischen Perspektive, die solchen Außendeutungen stets vorgeordnet war (638). Mit dem Nationalsozialismus erhob eine totalitäre Weltanschauung Ansprüche auf Kirche und Theologie, der von ihren Anhängern ein Wahrheitsgehalt zugesprochen wurde, der über der Offenbarung des rechtfertigenden Gottes stand. In den Worten Slenczkas: „Die Abgrenzung der Barmer Theologischen Erklärung richtet sich im Zeitalter der säkularen, religionsförmigen Totalitarismen gegen eine Position, die außerhalb des Wirkungsbereiches der christlichen Verkündigung erwachsene Einsichten und weltanschauliche Vorgaben des kirchlichen Lehrens und Handelns verbindlich machen will mit dem Ziel, das kirchliche Lehren und Handeln auf diese Vorgaben hin zu finalisieren.“ (637) Deutlich ist an diesem Zitat, dass Slenczka die Bedeutung Barmens nicht nur historisch-kontextuell in der Abwehr des nationalsozialistischen Totalitarismus sieht, sondern generell in der Abwehr von „säkularen, religionsförmigen Totalitarismen“. Dem kann man selbstverständlich zustimmen. Aber wenn es für die Alte Kirche und die Reformation galt, so ist doch auch damit zu rechnen, dass gegenwärtige Theologien und Kirchen philosophische und kulturelle Modelle zum Zwecke des theologischen Verstehens und ekklesiologischen Handelns rezipieren und auf den christlichen Glauben anwenden, ohne dass sie sich sofort einem wie immer gearteten Totalitarismus ausliefern. Diesen Gedanken aber entfaltet Slenczka nicht weiter.
Stattdessen wirft er – der zweite Punkt – dem als konsensuell und überzeitlich markierten Evangeliumsverständnis der Leuenberger Konkordie[7] unhistorisches, zeitloses theologisches Argumentieren vor. Die Passage sei hier in ihrem Zusammenhang wiedergegeben: „Ein solcher Anspruch, den zeitlosen Kern, der allen Denkformen verschiedener Zeiten vorgegeben ist, identifizieren zu können, ist hermeneutisch hochproblematisch und subkomplex. Denn unter den Bedingungen geschichtlichen Denkens ist davon auszugehen, dass auch die Formulierung eines scheinbar zeitlosen Kerns den Verstehensbedingungen der je eigenen Gegenwart unterworfen ist, ja dass die Unterscheidung von ‚Zeitbedingtem‘ und ‚Überzeitlichem‘ selbst dem hermeneutischen Zirkel unterliegt. Denn auch der Vollzug dieser Unterscheidung und das Identifizieren des ‚Zeitlosen‘ unterliegt selbst den Bedingungen und Voraussetzungen einer bestimmten Gegenwart.“ (650) Nach meiner Überzeugung verfällt dieser Leuenberg-Kritik Slenczkas auch die oben behandelte These Luthers, das Thema der Theologe seien der Mensch als Sünder und der erlösende Gott. Zwar geht der Berliner Theologe hier so weit über die historische Exegese hinaus, dass er diese These existentiell interpretiert, aber das genügt m.E. nicht, um sie gegenwartsfähig zu machen. Es reicht nicht, die historischen Bekenntnisdokumente für die Gegenwart theologisch zu deuten. Sondern es muss nach meiner Auffassung zur historischen Aktualisierung eine theologische Gegenwartsanalyse hinzukommen, auf deren Voraussetzungen ich gleich komme.
Slenczka fragt nun für Leuenberg vor allem nach dem markierten theologischen Konsens, der die alten Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts einer neuen Interpretation unterzieht. Diese Neu-Interpretation sieht er nicht als gelungen an. Vorsichtig schreibt er, es sei der „der Eindruck nicht ganz von der Hand zu weisen, dass hier eine rein verbale Einigung erreicht und als Konsens in der Lehre ausgegeben wird, unter dem die sachlichen Differenzen einfach weiterbestehen (…). Erzielt wird nicht eigentlich eine Lehreinheit, sondern eine Einheit in einer Formulierung, die einen Lehrgegensatz verbirgt.“ (663) Das nun wiederum ist ein Vorwurf, den man den Abendmahlsfragen der badischen Unionsurkunde[8] ebenfalls machen könnte, was zuerst im 19. Jahrhundert, aber auch in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu Auseinandersetzungen über eine rein lutherische oder rein reformierte Interpretation der badischen Union oder mindestens ihres Abendmahlsverständnisses geführt hat.
Slenczka löst nun seine Kritik an Leuenberg so auf, dass er sich der Deutung von Eilert Herms anschließt, der zwischen Glaubensgrund und Lehre unterscheidet. Das Evangelium, wie es sich aus der Bibel erschließt, ist danach eindeutig vorgegeben, wird aber in den Bekenntnissen und theologischen Lehren der (protestantischen) Kirchen unterschiedlich interpretiert (663). Und damit gelangt Slenczka schließlich auf einem vorsichtigen Umweg doch zu derselben Anerkennung von theologischer Differenz, wie es die Leuenberger Konkordie anstrebte, eben im Modell eines differenzierten ökumenischen Konsenses, wie es Slenczka zu Beginn seines Buches eingeführt hatte.
Aus dieser Analyse von Slenczkas scharfsinnigem Werk ergeben sich für mich eine Feststellung und zwei Fragen, die eine nach dem Fluchtpunkt einer theologischen Gegenwartsanalyse, die andere nach dem theologischen Charakter des Unionsbegriffs. Die Feststellung besteht darin, dass die Frage nach der einen Wahrheit der Kirche nicht aufgegeben werden darf, nicht in innerprotestantischer, nicht in ökumenischer und nicht in öffentlich-theologischer Absicht.
Denn, was die erste Frage angeht, die gegenwärtigen pluralistischen Gesellschaften des Westens scheinen mir nicht durch Pluralismen, sondern vielmehr durch den Versuch des toleranten Umgangs mit verschiedenen Wahrheiten geprägt, gleich ob man das Pluralismus, Relativismus oder anders nennt. Die evangelischen Kirchen, ich komme zur zweiten Frage, haben sich in den letzten Jahrzehnten, auf diesen Pluralismus eingelassen und konnten trotzdem massive Mitgliederverluste nicht verhindern. Sie müssen sich der Frage stellen, wie sie innerprotestantisch und ökumenisch mit der Existenz unterschiedlicher theologischer Deutungen umgehen, die sich in unterschiedlichen konfessionellen Kirchen ausprägen. Die Frage ist also, wie kirchliche Unionen und Konkordien theologisch genau zu beschreiben sind. Damit reagieren die Kirchen zum einen auf die gesellschaftliche Pluralisierung, die viel mehr umfasst als religiöse Wahrheiten, zum anderen auf den innerkirchlichen Pluralismus, der theologisch gedeutet werden muss. Diesen beiden Punkten sind die folgenden beiden Abschnitte gewidmet.
4. Relativismus in der Gesellschaft
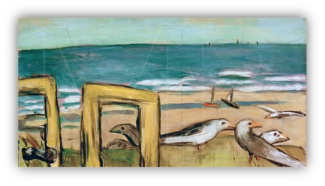 Slenczka ging ja in seiner Analyse der Barmer Theologischen Erklärung den für Lutheraner ungewöhnlichen Schritt, dass er Barmen als Bekenntnisschrift anerkannte; normalerweise gilt nach lutherischem Verständnis die Bekenntnisbildung mit der Konkordienformel als beendet. Slenczka akzeptierte Barmen nicht in der von den Verfassern intendierten Funktion der Ablehnung der Deutschen Christen, sondern sehr viel allgemeiner in der Ablehnung von „säkularen, religionsförmigen Totalitarismen“. Dass darunter die Ideologie der Deutschen Christen fällt, wird niemand bezweifeln, aber genügt die Barmer Erklärung auch, um den modernen Relativismen zu begegnen, die sich als Pluralismus, Religionsfreiheit und Individualismus beschreiben lassen?
Slenczka ging ja in seiner Analyse der Barmer Theologischen Erklärung den für Lutheraner ungewöhnlichen Schritt, dass er Barmen als Bekenntnisschrift anerkannte; normalerweise gilt nach lutherischem Verständnis die Bekenntnisbildung mit der Konkordienformel als beendet. Slenczka akzeptierte Barmen nicht in der von den Verfassern intendierten Funktion der Ablehnung der Deutschen Christen, sondern sehr viel allgemeiner in der Ablehnung von „säkularen, religionsförmigen Totalitarismen“. Dass darunter die Ideologie der Deutschen Christen fällt, wird niemand bezweifeln, aber genügt die Barmer Erklärung auch, um den modernen Relativismen zu begegnen, die sich als Pluralismus, Religionsfreiheit und Individualismus beschreiben lassen?
Es ist Slenczkas Intention, die lutherischen Bekenntnisschriften des 16. Jahrhundert und die Grundentscheidungen der lutherischen Reformation theologisch erneut zur Geltung zu bringen. Er will die (Bekenntnis-)Texte für die Gegenwart stark machen. Die Texte aus dem 16. Jahrhundert aber sind dafür geschrieben, Konsens und Dissens zu wenigen anderen religiösen Bekenntnissen zu markieren, insbesondere zur traditionellen katholischen Kirche und zu den konkurrierenden evangelischen Konfessionen. Die alten lutherischen Bekenntnistexte setzen die mit der Moderne gegebenen sozialen und kulturellen Bedingungen von Pluralismus und Individualismus nicht voraus. Es stellt sich die Frage, ob diese neuen, erst mit der Modernisierung aufkommenden Bedingungen, die sich an einem anderen Umgang mit Wahrheitsansprüchen zeigen, auch andere, neue theologische Grundentscheidungen nach sich ziehen. Wenn das richtig ist, wäre Slenczkas Auslegung der Bekenntnisschriften der Vorwurf machen, dass sie aus systematischen Gründen die historischen Dokumente und theologischen Analysen der Reformationszeit privilegiert und darüber die sozialen und kulturellen Bedingungen, die mit der Moderne gegeben sind, vernachlässigt.
Gesellschaftlich sind Prozesse der Pluralisierung von Weltanschauungen und Religionen und damit auch der entsprechenden Wahrheitsfragen juristisch durch eine Theorie der Religionsfreiheit, soziologisch in Milieu-, Individiualisierungs- oder Singularisierungstheorien, philosophisch als Anerkennungstheorie beschrieben worden.
Das Menschenrecht der Religionsfreiheit[9] kann individuell und institutionell verstanden werden. Es sorgt dafür, dass Glaubende und religiöse Institutionen mit ihren konkurrierenden Wahrheitsansprüchen und Überzeugungen nebeneinander koexistieren können. Der Staat verhält sich weltanschaulich neutral und privilegiert nicht bestimmte Religionen. Staatsbürgerschaft und Teilhabe am politischen Leben sind grundsätzlich nicht mehr an bestimmte religiöse Überzeugungen gekoppelt. Die Frage nach der Wahrheit der Religion bleibt darüber juristisch und gesellschaftlich ausdrücklich offen. Staat und Politik vertreten keine emphatischen, im religiösen Sinn dogmatischen Vorgaben. Im Sinne Slenczkas ist diese säkulare Theorie der Religionsfreiheit (mit theologischen Voraussetzungen) nicht offen für totalitaristische Weltanschauungen, die ihrerseits darauf gerichtet sind, diese pluralistische Offenheit für unterschiedliche Weltanschauungen und Religionen zu zerstören. Aus dieser Perspektive betrachtet, sind die evangelischen Bekenntnisse, sei sie uniert, lutherisch oder reformiert, Optionen unter vielen, die innerhalb des eigenen Glaubens nach eindeutiger Verkündigung der eigenen Überzeugungen streben, während sie zu anderen Religionen zwar Beziehungen pflegen, aber deren Wahrheitsansprüchen die eigenen Ansprüche des Evangeliums entgegensetzen. Insgesamt handelt es sich um ein juristisches Modell der Koexistenz religiöser Wahrheitsansprüche in pluralistischen Gesellschaften.
Die vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu entwickelte Milieutheorie[10] erklärt soziale Unterschiede aus der Entwicklung stabiler sozialer Habitusformen bei den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft, die sich zu Milieus zusammenschließen und, angeeignet durch Prozesse der Sozialisation. nur schwer wieder verflüssigen und verändern lassen. Schlechthin alles, von der bevorzugten Zahnpasta über die Lieblingsmusik, den Lieblingsfußballverein (Union Berlin) bis zu Wahrheitsansprüchen und religiösen Überzeugungen kann zum Merkmal sozialer Differenzierung bzw. von sozialen Abgrenzungsprozessen werden. Wenn soziale Assoziationen wie die Kirchen also wieder mehr Menschen erreichen wollen, dann müssen sie ihr soziales Handeln entsprechend dieser stabilen sozialen Milieus differenzieren. Damit aber entsteht in den Kirchen eine Spannung. Auf der einen Seite behaupten die Kirchen mit dem Galaterbrief: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28; Hervorhebung wv) Auf der anderen Seite gewinnt diese Einheit in Gottesdienst und Abendmahl nur symbolisch Gestalt, während im innerkirchlichen Leben, sowohl in der Gemeinde als auch noch sehr viel mehr in der klerikalen Bürokratie die alten Differenzen unreflektiert und unbearbeitet weiter entscheidende Einflüsse ausüben. Es besteht ekklesiologisch eine Tendenz, eben nicht nach dem einen Glauben der Bekenntnisse zu leben, sondern einfach unter dem (oberflächlichen) Dach eines Bekenntnisses zur Gleichheit der Glaubenden die pluralistischen Differenzen des Menschseins in den Glauben hineinzuziehen. Kirche ist dann nicht mehr bestimmt durch die eindeutige Lehre des Evangeliums, sondern durch einen Mix aus Gleichheitsbehauptungen (je nach Bedarf) und der ‚milieusensiblen‘ Anerkennung innerkirchlicher oder innerreligiöser Differenzen.
Aus der Milieutheorie lässt sich gerade nicht lernen, wie die Kirchen sich neue Zielgruppen erschließen können, sondern wie stark solche sozialen Differenzansprüche mit der Identität von Individuen verknüpft sind. Gerade die Milieutheorie zeigt nicht die Flüssigkeit und Wechselmöglichkeiten von Milieuprägungen, sondern ihre Festigkeit und Zähigkeit.
Individualisierungstheoreme haben die Milieubindung von sozialen Gruppen noch sehr viel weiter aufgelöst. Enorme Aufmerksamkeit hat diesem Typus von soziologischer Differenzanalyse der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz verschafft, der nicht mehr von Milieus, sondern von singularisierten Individuen spricht, die sich ihre Identität kulturell, sozial, religiös so gestalten, dass sie nicht mehr als Angehörige von Großgruppen (Parteien, Kirchen, Gewerkschaften) erscheinen[11]. Der einzelne will gar kein typischer SPD-Wähler, kein typischer evangelischer Christ oder Kirchentagsbesucher, kein typischer Neureicher, kein typischer Fußballfan mehr sein. Sondern er will seine individuelle, singularisierte Identität in den Vordergrund rücken, und diese läßt keinen Raum mehr für institutionalisierte Mitgliedschaften religiöser oder anderer Art. Gleichwohl gilt auch für Reckwitz, dass solche Individualisierungsprozesse Milieuzugehörigkeiten nicht vollständig auflösen.
Mit dieser Singularisierungstheorie kann Reckwitz den Niedergang von Parteien, Gewerkschaften und die hohen Kirchenaustrittszahlen gut erklären. Niemand will sich auf einen Parteisoldaten, als gewohnheitsmäßigen Gottesdienstbesucher oder gewerkschaftstreuen Kämpfer für die Arbeiterklasse reduzieren. An die Stelle der alten Groß-Institutionen treten „Neo-Gemeinschaften“, die sich um flüchtige Interessen, Neigungen, Vorlieben bilden. Sie sind bei weitem nicht so stabil wie die alten Institutionen und lösen sich auf, wenn der Grund des ursprünglichen Interesses (ein bestimmtes Computerspiel etc.) weggefallen ist. In dieser Perspektive ist eine in Bekenntnissen entfaltete theologische Großtheorie von Wahrheitsansprüchen des Evangeliums gar nicht mehr nötig – und vielleicht auch gar nicht möglich. In dieser Perspektive – man kann es nicht anders sagen – verlieren die großen Kirchen, aber auch andere Religionsgemeinschaften ihre soziale Legitimation und ihre angestammte soziale Selbstverständlichkeit. Konsequent dünnen sie in pluralistischen Gesellschaften durch jahrzehntelangen Mitgliederschwund aus. Eine Theorie der bleibenden theologischen Geltung der Bekenntnisschriften erscheint vor diesem soziologischen Hintergrund überhaupt nicht mehr notwendig. Trotzdem muss auch hier die Frage erlaubt sein, ob es nicht seinen Reiz hätte, in die singularisierten Identitäten wechselbereiter und veränderungswilliger Individuen wenn nicht die gesamte, eigentlich unteilbare Bekenntnistheologie, sondern mindestens Elemente einer bestimmten theologischen Evangeliumsdeutung einzuschleusen.
Die philosophische Anerkennungstheorie[12] schließlich hat den sozialen Pluralisierungstendenzen dadurch Rechnung getragen, dass sie die Frage nach dem guten Leben für insgesamt unentscheidbar erklärt hat. An ihre Stelle tritt neben der Konkurrenz unterschiedlicher Wahrheitsansprüche eine Theorie der gegenseitigen Anerkennung unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Lebens- und Sinnmodelle, die eigentlich keine andere Bedingung erfüllen müssen, als politische, religiöse und kulturelle Freiheiten anzuerkennen. Kurzum: Nicht zugelassen sind Sinnmodelle und Weltanschauungen, die totalitaristisch das System der offenen Fragen, der – im guten Sinne: nicht endenden - Debatten um das gute Leben selbst in Frage stellen. Das läßt sich umgekehrt auch positiv formulieren: Zwischen den Religionen und Weltanschauungen herrscht nicht nur (gleichgültige) Toleranz, sondern Religionen und Weltanschauungen erkennen sich untereinander als gleichberechtigte Optionen an.[13]
Aus dem aktuellen soziologischen, philosophischen und juristischen, nicht aus der theologischen Theoriebildung wird das Stichwort von der Anerkennung von Differenzen eingespielt. Dem könnte man theologisch so begegnen, dass man die reformatorischen Bekenntnisschriften als die Entwicklung einer weiterhin aktuellen, einen Position im Konzert unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen in pluralistischen Gesellschaften versteht. Das jedoch greift deshalb zu kurz, weil die Bekenntnisschriften selbst andere theologische Positionen als die eigene nur als Spielart von Unwahrheit in das eigene Denken einordnen können. Die Abwehr totalitärer Weltanschauungen und Religionen reicht nicht aus. Es braucht eine Theorie der Relativität der eigenen bekannten und geglaubten Wahrheit. Diese differenziert nicht nach glaubenden Bekenntnistreuen und nicht-glaubenden konfessionellen Gegnern, sondern sie legt diese Differenz zwischen Wahrheit und Unwahrheit in die Glaubenden selbst hinein, und zwar als die Differenz zwischen Glauben und Zweifel. Diese Deutung war ja schon bei Luther und seinen reformatorischen Nachfolgern angelegt: Sie entfaltete sich zum Beispiel in der Unterscheidung zwischen „securitas“ und „certitudo“. Glaubensgewissheit kann nicht sicheres Wissen sein, sondern ist stets angefochten und von Zweifeln behaftet. Die Wahrheitstheorie des evangelischen Glaubens ist also bereits seit der Reformation in sich selbst relativiert. Und genau dieses Moment ist in der Moderne auszubauen. Slenczka hat dazu eine Reihe von Andeutungen gemacht: Er erkennt Differenzen der reformatorischen Positionen an, aber er hält am normativen Anspruch der Bekenntnisschriften fest[14]. Dieser Ansatz wäre weiter zu verfolgen.
5. Eine Theologie der Gesprächsbereitschaft
 Gesellschaftlich scheint es aktuell so zu sein, dass die Zahl der sozialen Differenzierungsprozesse die zentripetalen Kräfte bei weitem überwiegt, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Pluralistische Demokratien besitzen in der Regel nur sehr schwach ausgeprägte Zivilreligionen, wenn überhaupt. In der Bundesrepublik haben in den letzten beiden Jahrzehnten die Großparteien einen anhaltenden Niedergang erlebt. An die Stelle stabiler Wählerschaften sind kritische Wechselwähler getreten, die ihre Gunst von Wahl zu Wahl neu verteilen. Für Arbeiter und Angestellte ist es nicht mehr selbstverständlich, in eine Gewerkschaft einzutreten. Autobesitzer bleiben nicht ein Leben lang einer bestimmten Automarke treu, sondern wechseln je nach eigenem Geschmack, nach Mode und Qualität des Anbieters. Von diesen gesellschaftsweit wahrzunehmenden Differenzierungs- und Singularisierungsprozessen sind auch Religionen und Kirchen betroffen. Die Theologie hat darauf mit normativen und empirischen Programmen der Anerkennung oder der Kritik von religiöser Differenz reagiert. Im Grunde reagiert auch Slenczkas Bekenntnistheologie auf diese gesellschaftliche Entwicklung, denn er fragt, ob trotz aller wahrgenommenen Differenzierungsprozesse noch an einem normativen einheitlichen Bekenntnis festzuhalten ist oder ob es sich dabei nicht um ein Theologumenon der Vergangenheit handelt. Seinem theologischen Versuch stehen eine Reihe von aufzuzählenden anderen theologischen Entwicklungen gegenüber, welche die Anerkennung theologischer oder bekenntnismäßiger Differenzen erklären wollen. Sie seien hier stichwortartig aufgezählt.
Gesellschaftlich scheint es aktuell so zu sein, dass die Zahl der sozialen Differenzierungsprozesse die zentripetalen Kräfte bei weitem überwiegt, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Pluralistische Demokratien besitzen in der Regel nur sehr schwach ausgeprägte Zivilreligionen, wenn überhaupt. In der Bundesrepublik haben in den letzten beiden Jahrzehnten die Großparteien einen anhaltenden Niedergang erlebt. An die Stelle stabiler Wählerschaften sind kritische Wechselwähler getreten, die ihre Gunst von Wahl zu Wahl neu verteilen. Für Arbeiter und Angestellte ist es nicht mehr selbstverständlich, in eine Gewerkschaft einzutreten. Autobesitzer bleiben nicht ein Leben lang einer bestimmten Automarke treu, sondern wechseln je nach eigenem Geschmack, nach Mode und Qualität des Anbieters. Von diesen gesellschaftsweit wahrzunehmenden Differenzierungs- und Singularisierungsprozessen sind auch Religionen und Kirchen betroffen. Die Theologie hat darauf mit normativen und empirischen Programmen der Anerkennung oder der Kritik von religiöser Differenz reagiert. Im Grunde reagiert auch Slenczkas Bekenntnistheologie auf diese gesellschaftliche Entwicklung, denn er fragt, ob trotz aller wahrgenommenen Differenzierungsprozesse noch an einem normativen einheitlichen Bekenntnis festzuhalten ist oder ob es sich dabei nicht um ein Theologumenon der Vergangenheit handelt. Seinem theologischen Versuch stehen eine Reihe von aufzuzählenden anderen theologischen Entwicklungen gegenüber, welche die Anerkennung theologischer oder bekenntnismäßiger Differenzen erklären wollen. Sie seien hier stichwortartig aufgezählt.
Schon die Erfahrungstheologie Schleiermachers und Jahrzehnte später die Religionsphilosophie von William James erklärte die religiöse Erfahrung zum Ausgangspunkt theologischen Denkens. Erfahrung aber lässt sich nicht anders als individuelle Erfahrung denken, die in der Folge zum Substrat allen theologischen Denkens wird. Gegenüber inhaltlichen, dogmatischen Bekenntnissen reagieren solche Theologien in der Regel kritisch, es sei denn sie machen den Versuch, die Übereinstimmung oder mindestens die Kompatibilität zwischen Erfahrung und Dogma nachzuweisen. Aber im Kern solcher Erfahrungstheologien steht dennoch ein individuelles spirituelles Erleben, dem der Einzelne mehr traut als dem vorgegebenen Dogma. In der Gegenwart hat zum Beispiel der Soziologe Hans Joas[15] eine Religionstheorie in dieser Richtung vorgelegt und damit seine Kritik des Säkularisierungstheorems begründet, insbesondere die Prognose vom allgemeinen Absterben der Religion.
In der evangelischen systematischen Theologie hat die These von der Unhintergehbarkeit individueller Erfahrung im Anschluss an Ernst Troeltsch der Münchener Theologe Friedrich-Wilhelm Graf[16] aufgenommen, der sich über die Jahre einer Theologiekritik verschrieb, die gegenüber jedem als normativ behaupteten Glaubenssatz seine kontingente Entstehungsgeschichte, die Abhängigkeit vom historisch-religiösen Kontext sowie die Möglichkeit alternativer theologischer Lösungen ins Spiel brachte. Die evangelischen Kirchen leiden für Graf an einem Zuviel verbindlicher moralisierender Glaubenssätze und an einem Zuwenig der Akzeptanz individualisierter theologischer Meinungen. Diese Kritik erscheint, wo sich moralisierende Ansprüche einer verkürzten politischen Theologie mit zähflüssiger klerikaler Bürokratie verbinden, ohne weiteres berechtigt.[17]
In der Praktischen Theologie hat der Münsteraner Theologe Christian Grethlein eine Umstellung des theologischen Denkens auf die „Kommunikation des Evangeliums“[18] gefordert. Grethlein will weg von belehrenden, sich aufoktroyierenden, freiheitsbeschneidenden kirchlichen Doktrinen zum gleichberechtigten religiösen Gespräch über moderne Lebensverhältnisse, die mit Hilfe der befreienden Kraft des Evangeliums in pluralistischen Gesellschaften gestaltet, kritisiert, erweitert werden. Für Normativität und Belehrung bleibt in diesem Programm kein Platz. In der Vergangenheit, im Kontext stabiler, unverrückbarer gesellschaftlicher Verhältnisse, war sie Ausgangspunkt kirchlicher Verkündigung, schreckte damit aber im Kontext der Entwicklung pluralistischer, auf Freiheit beruhender Gesellschaften immer mehr Menschen durch ihren autoritären Charakter ab. Normativität kann bei Grethlein nur noch als Konsens aus vorherigen, umfassenden (religiösen) Gesprächen entstehen. Wenn dabei die Bekenntnisschriften ins Spiel kommen, so höchstens als eine Art Spielmaterial.
Es ist in diesem Kontext auch die in letzter Zeit oft missverstandene öffentliche Theologie zu erwähnen. Denn bei dieser handelt es sich ja nicht um ein moralisierendes Programm zur Verbesserung der Welt, schon gar nicht um ein Bischofswahlprogramm oder um einen Ersatz für die alte politische Theologie. Sondern ein wesentlicher Aspekt der ursprünglichen Überlegungen zur öffentlichen Theologie bestand in der Anerkennung anderer nicht-kirchlicher und nicht-religiöser Positionen in der politischen Kultur[19]. Insofern war öffentliche Theologie ein Gesprächsprogramm in die Öffentlichkeit hinein, und es war eine ihrer Schwächen, dass sie die innerkirchliche Normativität nicht reflektierend mit einbezogen hat.[20]
In der theologischen Landschaft amerikanischer Universitäten ist in letzter Zeit eine andere Entwicklung zu beobachten. Danach verlegen sich theologische Fakultäten und Departments for Religious Studies darauf, den jungen Theologen nicht mehr inhaltliche Kenntnisse über systematische Theologie und Bekenntnisse nahezubringen, sondern konzentrieren die Rolle der Theologie darauf, in interreligiösen Gesprächen – gleich welchen Inhalts und Ziels – zu vermitteln.[21] Theologen ‚lehren‘ dann nicht mehr, was sie als normativ verstanden haben, sondern halten nur noch als Moderatoren das (religiöse) Gespräch in Gang. Damit wird aber die Theologie von ihren inhaltlichen Ursprüngen abgeschnitten, egal ob man diese – in der christlichen Tradition – als biblische oder bekenntnishaft konfessionelle Orientierungen auffasst.
Diese wenigen Bemerkungen zeigen, dass in modernen pluralistischen Gesellschaften Kirchen und Religionen auf welche Weise auch immer ein Programm zum Gespräch mit externen Partnern (Politik, Gewerkschaften, Verbände, Vereine und Institutionen der Zivilgesellschaft) entwickeln müssen. Sie zeigen zweitens, dass Bekenntnisse in ihrer normativen Bestimmtheit weder den Glaubenden innerhalb der Kirche noch den Gesprächspartnern außerhalb normativ aufgepfropft werden können. Es gibt – mit Slenczka - gute Gründe, an Bekenntnissen normativ festzuhalten, aber ihnen muss eine – wie immer gestaltete – Theologie der Gesprächsbereitschaft beigeordnet sein, die das alte Modell der autoritären Belehrung, der katechetischen Imprägnierung von Taufaspiranten, Konfirmanden, Ausgetretenen und allen an der Kirche Interessierten ersetzt.
6. Ist die Union eine Lösung?
 Wenn man die bisherigen Denkschritte dieses Essays so zusammenfasst, dass (normative) Bekenntnisorientierung und (kommunikative) Gesprächsbereitschaft zusammengehören, so stellt sich die Frage, wie die Kirchen in den letzten zweihundert Jahren mit diesem Thema umgegangen sind. Ich gehe nun zum einen auf evangelische Kirchen ein, die sich im Postulat der Bekenntnisfreiheit von den Bekenntnissen verabschiedet haben, zum anderen auf unierte Kirchen wie diejenigen der Pfalz und Baden. Letztere feiert im Jahr 2021 das zweihundertjährige ihrer Bekenntnisunion.
Wenn man die bisherigen Denkschritte dieses Essays so zusammenfasst, dass (normative) Bekenntnisorientierung und (kommunikative) Gesprächsbereitschaft zusammengehören, so stellt sich die Frage, wie die Kirchen in den letzten zweihundert Jahren mit diesem Thema umgegangen sind. Ich gehe nun zum einen auf evangelische Kirchen ein, die sich im Postulat der Bekenntnisfreiheit von den Bekenntnissen verabschiedet haben, zum anderen auf unierte Kirchen wie diejenigen der Pfalz und Baden. Letztere feiert im Jahr 2021 das zweihundertjährige ihrer Bekenntnisunion.
Die Vereinigungsurkunde der Evangelischen Kirche der Pfalz sowie deren Verfassung[22] verweisen auf die Unterordnung der Bekenntnisse unter die Heilige Schrift, also auf das Verhältnis von normae normatae und norma normans. In der Vereinigungsurkunde (§ 3) heißt es: „Die protestantisch-evangelisch-christliche Kirche hält die allgemeinen Symbola und die bei den getrennten protestantischen Konfessionen gebräuchlichen symbolischen Bücher in gebührender Achtung, erkennt jedoch keinen andern Glaubensgrund noch Lehrnorm als allein die heilige Schrift.“ Dies wird in der Verfassung in ähnlichen Formulierungen bestätigt (§ 2). Ebenfalls bekennt sich die pfälzische Landeskirche zuerst zur Person Jesu Christi und danach zu Bekenntnissen und den Lehren, die darin aufbewahrt sind. Die konfessionellen Gegensätze werden als überholt betrachtet und stattdessen die Einheit der heiligen Schrift betont. Das muss man als eine Relativierung (und Historisierung) der Bekenntnislehren sehen, die am Anfang des 19. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich war und sich auch nicht in allen anderen Landeskirchen durchsetzen konnte.
Demgegenüber mutet die Behauptung der reformierten Kirche Berns, des Juras und Solothurns merkwürdig an, nach der man sich als „bekenntnisfreie“ Kirche verstehe. Von außen betrachtet, wird damit zum einen die reformierte Geschichte der eigenen Kantonalkirchen dementiert. Zum anderen mutet es merkwürdig an, dass bei Taufen nicht einmal zwingend das Apostolicum gesprochen wird, sondern Pfarrer die Freiheit haben, ein beliebiges Bekenntnis zu verwenden.[23] In der Verfassung der Kirche ist folgerichtig von Bekenntnissen nicht die Rede, sondern nur von reformatorischen Texten, welche die „geschichtliche Grundlage“ der Kirche bilden.[24] Von einer gemeinsamen theologischen Grundlage ist nicht die Rede. Zwar bekennt sich auch die Berner Kirche zur Person Jesu Christi, aber mit der ‚Freigabe‘ des Bekenntnisses handelt man sich systematische und ekklesiologische Schwierigkeiten ein: Zum Beispiel hat auch die Berner Kirche die Leuenberger Konkordie unterzeichnet und ist damit quasi in einem europäisch-ökumenischen Vertrag darauf festgelegt, eine evangelische Kirche reformierter, lutherischer oder unierter Tradition zu sein, die mit anderen evangelischen Kirchen in Europa Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft teilt.
Die Konfessionsunion der Evangelischen Landeskirche in Baden von 1821 vermeidet die theologischen Strategien der pfälzischen und der Berner Kirche. Mit ihr bekennt sich die vereinigte badische Kirche zur Person Jesu Christi, zum magnus consensus der drei altkirchlichen Bekenntnisse, zur Confessio Augustana als reformatorischem Urbekenntnis sowie zum lutherischen Kleinen und zum reformierten Heidelberger Katechismus, denen gleiche kirchliche Geltung zugeschrieben wird. Für das Abendmahl[25] stellen eine Reihe von ergänzenden Katechismusfragen einen Konsens her. Man kann diesen Katechismusfragen mit einem gewissen Recht den gleichen Vorwurf machen, den Slenczka gegenüber der Leuenberger Konkordie erhoben hatte. Sie kaschieren unter uneindeutigen Formulierungen das Fortbestehen zweier theologischer Interpretationslinien. Das scheint jedoch – nach dem differenzierten Konsens der Leuenberger Konkordie – nicht so ein großes Problem wie die Tatsache, dass die badische Union, die historisch ursprünglich als ein Konsens unterschiedlicher Abendmahlsdeutungen gedacht war und damit ausschließlich einen innerprotestantischen konfessionellen Dissens überwinden sollte, nun zum Gründungsdokument eines pluralistischen, demokratischen Kirchenverständnisses umstilisiert wird.[26]
Der historische Blick auf die Unionsurkunde zeigt folgendes:
1. Zwar hat eine Bekenntnissynode der Unionsurkunde einhellig zugestimmt, aber die kirchenpolitischen Impulse zur Überwindung des Konfessionalismus kamen vom Großherzog, aus dem landesherrlichen Kirchenregiment.
2. Mit der Union waren die konfessionalistischen Streitigkeiten keineswegs beseitigt, sie brachen im Gegenteil nach der Verabschiedung erst richtig aus, was die Synode dann im Jahr 1855 zu einer „Authentischen Interpretation“[27] der Unionsurkunde nötigte, welche in der Abendmahlsfrage auf biblische Begründungen und persönliche Gewissensfreiheit abstellte. Erst im 20. Jahrhundert verschwamm – zumindest in Baden – die inhaltliche Trennung zwischen reformierter und lutherischer Konfession, und es ist aktuell sehr zweifelhaft geworden, ob – nach Leuenberg! – die Trennung der evangelischen Kirche in zwei Konfessionen theologisch überhaupt noch einen Sinn macht. Ob das auch auf der Ebene reformierter und lutherischer (Religions-)Kultur gilt[28], das mag dahingestellt sein.
3. Es ist zweifellos ein Verdienst der Unionsurkunde, dass sie à la longue einen wirksamen Gegenpunkt gegen theologische Rechthaberei gesetzt hat. Unionsurkunde und authentische Interpretation sind deshalb von besonderem Wert, weil beide die Gewissensfreiheit gegen das fanatische Insistieren auf Glaubenswahrheit setzen. Schon Jahre vor der Unionsurkunde zog Johann Peter Hebel in seiner ökumenischen Verwechslungsgeschichte „Die Bekehrung“[29] folgende moralisch-spirituellen Schlussfolgerungen: „Merke: du sollst nicht über die Religion grübeln und düfteln, damit du nicht deines Glaubens Kraft verlierst. Auch sollst du nicht mit Andersdenkenden disputieren, am wenigsten mit solchen, die es ebensowenig verstehen als du, noch weniger mit Gelehrten, denn die besiegen dich durch ihre Gelehrsamkeit und Kunst, nicht durch deine Überzeugung. Sondern du sollst deines Glaubens leben, und was gerade ist, nicht krumm machen. Es sei denn, dass dich dein Gewissen selber treibt zu schanschieren.“[30] Hier werden Religion und Theologie deshalb dem Disput unter den Kriterien von Wahrheitsfragen entzogen, weil sie in der Tradition des liberalen Theologie des frühen 19. Jahrhunderts als selbstverständliche, private Gewissheiten verstanden werden, deren öffentliche Disputation nach Hebels Überzeugung der religiösen Gewissheit selbst nicht zuträglich sein kann.
Es kann eigentlich nicht anders sein, dass man den theologischen Sinn der Unionsurkunde nach ihrem ‚original intent‘ auslegt, das heißt im Kontext der historisch-religiösen Verhältnisse Anfang des 19. Jahrhunderts. Schwierig wird es, wenn dieser ursprüngliche Sinn der Union in den Hintergrund rückt und aktuelle volkskirchliche Interessen an deren Stelle treten. Die (badische) Union gilt dann nicht mehr als der Versuch, die Wahrheit des Evangeliums – in diesem Fall die Überwindung der Konfessionsgrenzen – neu zur Sprache zu bringen, sondern Union wird dann zu einer Methode der Pluralismusbewältigung stilisiert, welche die theologischen Ansprüche von Wahrheitsfragen weitgehend suspendiert und eher an einer Vielzahl religiöser Gewissheiten als an einem gemeinsamen Bekenntnis interessiert ist. Union bedeutet dann nicht mehr nur, dass sich die evangelischen Christen in der Abendmahlsfrage einig sind. Union bedeutet dann, dass sich in der Kirche Menschen mit unterschiedlichen religiösen Gewissheiten zusammenfinden, in der sämtliche Differenzen planmäßig verwischt werden: Differenzen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, Engagierten und Nicht-Engagierten, zwischen Pfarrern, Diakonen und Prädikanten, zwischen unterschiedlichen Milieus etc.. Allerdings gilt kirchlich wie gesellschaftlich: Wer Unterschiede konsequent nivelliert, endet irgendwann in einer Gleichmacherei zur Banalität. Das gilt für Wahrheitsansprüche, Berufskompetenzen und -funktionen.
Dieses neue pluralistische Unionsverständnis ist spirituell-ideologisch hoch empfindlich besetzt und wird dementsprechend aggressiv rhetorisch verteidigt. In der Regel wird die historische Union als Legitimation dieses pluralistischen und relativistischen Konzepts beansprucht. Um das eine aus dem anderen zu erklären, werden in der Regel vier Gründe geltend gemacht.
1. Kirchlich werden Entwicklungen aus der Gesellschaft einfach übernommen. Die Kirchen haben in mehreren Milieuuntersuchungen die differenzierten Verhältnisse der Gesellschaft ausgiebig analysiert, bis hin zu den von Reckwitz beschriebenen Tendenzen zur Singularisierung. Reckwitz aber geht so weit, dass er den Sinn von Gemeinschaften und Institutionen alten Typs (Parteien, Gewerkschaften, Kirchen) bestreitet und sich an deren Stelle ausgiebig mit den gar nicht so verbindlichen, flüssigen ‚Neo-Gemeinschaften‘ beschäftigt.
2. Ein zweiter Grund besteht in der insbesondere in der kirchlichen Hierarchie verbreiteten Angst vor weiteren Austrittsbewegungen, die dazu führt, dass man inhaltliche Auseinandersetzungen um Glaubensfragen nach Möglichkeit vermeidet, um niemanden abzuschrecken und möglichst keinen auszuschließen. Wer trotzdem nach Glaubenswahrheiten fragt, wird schnell als Fundamentalist verunglimpft. In solch ein Klima der Ängstlichkeit passt eine ‚Unionskirche‘ hervorragend hinein, weil sie – vermeintlich – einen Pluralismus garantiert, den die Glaubenden schon aus der Gesellschaft kennen.
3. Man scheut die mit klaren Grenzziehungen und Unterscheidungen verbundene theologische Auseinandersetzung. Zur Lösung anstehende Fragen werden in Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Kommissionen endlos zerredet (‚Dialoge‘)[31] und dann in widersprüchlichen Kompromissdokumenten – man denke an die unüberschaubare Zahl von Gottesdienst-, Bildungs-, Missions-, Ökumene-, Seelsorgekonzeptionen - verbreitet, in denen jeder seine Wahrheit wiederfindet, weil jeder ‚mitgenommen‘ werden soll. Dem religiösen Inklusivismus solchen klerikalen Kommissionsdenkens kann niemand entkommen. In den Labyrinthen solcher religiös offener Konzeptpapiere verendet die theologische Reflexion.[32]
4. Der Anspruch, alle ‚mitzunehmen‘ reicht über die Kirche hinaus und verdichtet sich zu einem theologischen Konzept, das sich – als Gegengewicht zur kirchlichen und gesellschaftlichen Aufteilung in Milieus – auf Gal 3,28, die Einheit der Menschen in Christus und das Priestertum aller Gläubigen beruft. In Christus seien alle eins und darum seien Unterschiede zwischen Menschen coram Deo aufgehoben. Damit meint man, eine wohlfeile Brücke zwischen christlicher Gewissensfreiheit und einem allgemeinen Kulturrelativismus gefunden zu haben. Allerdings kommt es im Galaterbrief eben auf dieses coram Deo an. Dieses macht den Unterschied zum Kulturrelativismus. Schon Paul Tillich schrieb in den fünfziger Jahren: „Gleichheit als ein Element der Gerechtigkeit wird von den Kirchen als die Gleichheit aller vor Gott verstanden. Diese transzendente Gleichheit hat die Forderungen nach sozialer und politischer Gleichheit nicht unmittelbar zur Folge. Die Versuche, eine solche Gleichheit durchzuführen, hat keine christliche Grundlage, sondern wurzelt im antiken und modernen Stoizismus. Aber die Gleichheit vor Gott sollte auch bei denen, die zu Gott kommen, den Wunsch nach Gleichheit schaffen, d.h. Gleichheit innerhalb des Lebens der Gemeinde.“[33] Es ist nicht so, dass Tillich nicht einen Moment später einen Bezug herstellen würde zwischen theologischer und sozialer Gleichheit, aber er verwahrt sich mit guten Gründen gegen ihre vorschnelle Gleichsetzung. Und diese Kritik trifft eben auf alle ekklesiologischen Versuche zu, die in einer kruden Form von Woke-Kultur und politischer Korrektheit, beides unter dem Mäntelchen des Liberalismus, über dem Werben für Gleichheit alle Differenzen vergessen wollen. Union ist zum planen Schlagwort dieser nivellierenden Gleichheitstheologie geworden, die in den klerikalen Bürokratien im Moment fröhliche Urständ feiert. Sie triumphiert, weil sie so bequem zu gebrauchen ist, konfliktscheu, auf eine klebrige Weise integrativ und in ihrer nebulösen Wolkigkeit scheinbar unangreifbar.
Ein Beispiel unter mehreren für diese unionistische Gleichheitsideologie findet sich in dem fehlgeschlagenen und weithin kritisierten Islam-Papier[34] der Badischen Landeskirche. Der Versuch, eine gemeinsame theologische Basis zwischen Christentum und Islam zu finden, endet im Missverständnis von Rechtsinstitutionen wie der Religionsfreiheit sowie in der Preisgabe wesentlicher theologischer Gehalte rein um des Dialogs willen. Etwa die Trinitätslehre wird dann einfach zu einer Interpretation des Evangeliums erklärt, die man schon deshalb aufgeben muss, weil sie mit den monotheistischen Vorgaben des Islam nicht zusammenpasst. In vorauslaufender Selbstbeschneidung werden in diesem Papier wesentliche Gehalte des Christentums und des Bekenntnisses angepasst, relativiert, kleingeredet, alles um des Dialogs willen. Und man muss sich dann nicht wundern, dass selbst liberale Muslime gegen diese Form des Dialogs Einspruch erheben, weil sich herausstellt, dass die evangelische Seite dieses Dialogs im Wesentlichen an konservative, restriktive Gruppen des Islam gerichtet ist.[35] Die vorherrschende Unionstheologie übernimmt in diesem Fall einfach das Narrativ einer Theologie der Religionen, deren Kritik in diesem Essay nicht geleistet werden kann.
Die Widersprüchlichkeit der affirmativen Unionstheologie zeigt sich in der Badischen Landeskirche im Übrigen an weiteren Punkten: etwa an den harmlosen vierzig Leitsätzen („Wir wollen offen, ehrlich und glaubwürdig miteinander umgehen.“)[36] der Kirche, die ihr Bekenntnis ergänzen, modernisieren, aktualisieren sollen. Auf der anderen Seite ist es mit Kooperations- und Unionsbereitschaft nicht weit her, wenn es um die aus Einsparungsgründen dringend notwendige Vereinigung der badischen mit der württembergischen Landeskirche geht. Hier muss die jubilierende Unionstheologie gegenüber billigen und untheologischen regionalpatriotischen Argumenten schnöde zurückstehen. Man weiß sich „hochherzig“ mit den Christen aller Welt vereint, aber kurz hinter Pforzheim hört es mit Begeisterung und gemeinsamem Verständnis des Evangeliums auf.
Alle diese Entwicklungen haben mit der ursprünglichen, historischen Absicht der Unionsurkunde wenig zu tun. Der Unionsbegriff wird hier zweckentfremdet zur Legitimation einer umfassenden Vorstellung von Gleichheit und Pluralismus, die beide eben nicht um ihrer selbst zustimmungsfähig sind, sondern bei denen man die theologische Frage nach ihrem Verhältnis zu Glaubenswahrheit und Bekenntnis stellen muss. Diese Frage wird im Moment kirchlich nicht gestellt. Den Unionskirchen ist allerdings zugute zu halten, dass sich in den eindeutig reformierten und lutherischen Kirchen ähnliche Entwicklungen im Schwange befinden. Das aber ändert nichts daran, dass hier dringender theologischer Diskussionsbedarf besteht.
7. Gänseblümchen und Brombeerhecke
 Slenczkas Überlegungen haben die Wahrheit des lutherischen Evangeliumsverständnisses in den Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts verortet. Das ist die große Stärke seines Werks, dass er in systematischer Absicht einen historischen theologischen Kontext entfaltet. Ich entnehme diesen Überlegungen ein bleibendes theologisches Festhalten an der Frage nach der Wahrheit des christlichen Glaubens, der in der Gegenwart entfaltet werden muss. Dabei wäre noch auf Slenczkas von ihm selbst angekündigten zweiten Band seiner Theologie zu warten. Ich möchte die Frage stellen, ob die Wahrheit des Glaubens dann immer noch in Auslegung des Heidelberger oder Kleinen Katechismus stattfinden kann oder ob die Situation des sündigen Menschen vor dem rechtfertigenden Gott nicht einer Art Situationsanalyse der Gegenwart bedarf. Es müssten geklärt werden die Fragen nach den Bedingungen von Glauben und evangelischer Wahrheit in modernen pluralistischen Gesellschaften.
Slenczkas Überlegungen haben die Wahrheit des lutherischen Evangeliumsverständnisses in den Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts verortet. Das ist die große Stärke seines Werks, dass er in systematischer Absicht einen historischen theologischen Kontext entfaltet. Ich entnehme diesen Überlegungen ein bleibendes theologisches Festhalten an der Frage nach der Wahrheit des christlichen Glaubens, der in der Gegenwart entfaltet werden muss. Dabei wäre noch auf Slenczkas von ihm selbst angekündigten zweiten Band seiner Theologie zu warten. Ich möchte die Frage stellen, ob die Wahrheit des Glaubens dann immer noch in Auslegung des Heidelberger oder Kleinen Katechismus stattfinden kann oder ob die Situation des sündigen Menschen vor dem rechtfertigenden Gott nicht einer Art Situationsanalyse der Gegenwart bedarf. Es müssten geklärt werden die Fragen nach den Bedingungen von Glauben und evangelischer Wahrheit in modernen pluralistischen Gesellschaften.
Dass diese sich verändern und die Kirchen sich daran anpassen, haben die Debatten um die badische Unionstheologie selbst dort gezeigt, wo ich ihnen eine vorschnelle Enthistorisierung, billigen Pluralismus um der Konfliktvermeidung willen und Banalität vorgeworfen habe. Zu unterscheiden wäre zwischen den Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Pluralismus, der auf dem Boden des Rechtsinstituts der Religionsfreiheit beruht, und den Möglichkeiten ökumenischen innerprotestantischen und innerkonfessionellen Verständigungsprozesses. Mit Slenczka kann die Debatte darüber nur so stattfinden, dass sie auf die theologisch zu ermittelnden Wahrheitsansprüche des christlichen Glaubens nicht verzichtet. Mit der Unionsdebatte im Hintergrund kann sie nur so stattfinden, dass sie Raum lässt für Gewissensfreiheit und individuelle Deutungen. Letztere kristallisieren sich vermittels Austausch und Verfahren zu innerkirchlichen Debatten über das, was eine Kirche Jesu Christi ausmacht. Dabei sind ekklesiologisch die unterschiedlichen Verfahren zu beachten. Jedenfalls lässt sich christliche Wahrheit nicht einfach mit einem Mehrheitsbeschluss herbeiführen.
Die Irrwege bei diesem Prozess zeichnen sich ab. Der erste macht die Kirche zur Agentur einer moralisierenden Fehlform öffentlicher Theologie, welche über theologischen Fragen resigniert und sich stattdessen für die scheinbare Attraktivität einer Verstärkung von Forderungen aus dem politischen Raum entschieden hat. Allerdings wirkt sich die Selbstermächtigung zum Moralismus so aus, dass Selbstverständnis und Identität evangelischer Kirchen tendenziell verlorengehen.[37] Die zweite macht die Bekenntnisse der christlichen Kirche zu willkürlich zusammengestellten Interpretationen christlicher Wahrheit, die sich in ihrer Beschränktheit erst unter der Meinungsführerschaft einer Theologie der Religionen zu einem Gesamtbild der religiösen Wahrheit runden. Die dritte macht die Wahrheit des Bekenntnisses zum Lippenbekenntnis von Leitsätzen, die sich nur noch der Selbsterhaltung des klerikalen Apparates verpflichtet fühlen. Das Evangelium verhält sich ja zum Klerikalismus wie ein Gänseblümchen zu einer wuchernden Brombeerhecke.
Kurzum: Dieses ist, wie schon in anderen Essays ausgeführt, ein Plädoyer für die Wiedergewinnung der theologischen Dimension in der Kirche, die nicht den klerikalen Bürokraten, den simplifizierten Theologien der Erwachsenenbildung oder den allzu modischen Woke-Moralismen evangelischer Korrektheit überlassen werden dürfen.
8. Angewiesen auf Wahrheit
 Richard von Weizsäcker war skeptisch gegenüber Parteien mit Grundsatzprogrammen, deswegen bevorzugte er politisch eine Union, die er für eine locker zusammengebundene parteiliche Vereinigung hielt, in der aus politisch-strategischen Gründen Menschen unterschiedlicher Meinung und Grundeinstellung zusammenfinden, um politische Ziele zu verfolgen. Nach den Überlegungen dieses Essays würde ich sagen: Für eine (evangelische) Kirche gilt das nicht. Aus dem Auftrag, das Evangelium zu verkünden, folgt ein bestimmtes inhaltliches Programm, das als (theologisches) Bekenntnis festgehalten wird. Der Unionsbegriff schillert nach seiner politischen und seiner theologischen Seite. Dass die Gesellschaft nicht von einer gemeinsam geteilten Zivilreligion (auch nicht von einem Wertkonsens oder einem gemeinsamen europäisch-abendländischen Weltbild) getragen wird, scheint mir unbestritten. Aber eine Gesellschaft ist angewiesen auf Quellen, die theologische Wahrheiten formulieren, diskutieren, bekennen, um mit diesen verkündeten Wahrheiten politisch, sozial oder kulturell zu nachzudenken, ihre Plausibilität zu erweisen und ihre Evidenz zu leben. Diese Wahrheit steht nicht auf einem Sockel, sie verändert sich, sie muss jeweils neu im Gespräch mit den Vorgängern, den religiösen Konkurrenten und der Öffentlichkeit entwickelt werden. In diesem Essay wollte ich den einen Punkt machen, dass die Frage nach der theologischen Wahrheit, die in der Gegenwart verantwortet werden kann, weiter im Gespräch mit der Bibel, den Bekenntnissen der historischen Vorgänger und den formativen Bedingungen der Gegenwart gestellt und diskutiert werden muss. Weder reformierte, lutherische noch unierte Kirchen können sich den Ausweg leisten, die Frage nach der Wahrheit des Evangeliums in einen billigen Pluralismus zu verwässern. Trotzdem geht ein Gespenst um in der Kirchenlandschaft: Unter den Schaumkronen eines nivellierenden Gleichheitspluralismus erscheint das blasse, verstockte Gesicht der alten, klerikalen Obrigkeitskirche. Letztere allerdings fürchtet nichts so sehr wie theologische Argumente.
Richard von Weizsäcker war skeptisch gegenüber Parteien mit Grundsatzprogrammen, deswegen bevorzugte er politisch eine Union, die er für eine locker zusammengebundene parteiliche Vereinigung hielt, in der aus politisch-strategischen Gründen Menschen unterschiedlicher Meinung und Grundeinstellung zusammenfinden, um politische Ziele zu verfolgen. Nach den Überlegungen dieses Essays würde ich sagen: Für eine (evangelische) Kirche gilt das nicht. Aus dem Auftrag, das Evangelium zu verkünden, folgt ein bestimmtes inhaltliches Programm, das als (theologisches) Bekenntnis festgehalten wird. Der Unionsbegriff schillert nach seiner politischen und seiner theologischen Seite. Dass die Gesellschaft nicht von einer gemeinsam geteilten Zivilreligion (auch nicht von einem Wertkonsens oder einem gemeinsamen europäisch-abendländischen Weltbild) getragen wird, scheint mir unbestritten. Aber eine Gesellschaft ist angewiesen auf Quellen, die theologische Wahrheiten formulieren, diskutieren, bekennen, um mit diesen verkündeten Wahrheiten politisch, sozial oder kulturell zu nachzudenken, ihre Plausibilität zu erweisen und ihre Evidenz zu leben. Diese Wahrheit steht nicht auf einem Sockel, sie verändert sich, sie muss jeweils neu im Gespräch mit den Vorgängern, den religiösen Konkurrenten und der Öffentlichkeit entwickelt werden. In diesem Essay wollte ich den einen Punkt machen, dass die Frage nach der theologischen Wahrheit, die in der Gegenwart verantwortet werden kann, weiter im Gespräch mit der Bibel, den Bekenntnissen der historischen Vorgänger und den formativen Bedingungen der Gegenwart gestellt und diskutiert werden muss. Weder reformierte, lutherische noch unierte Kirchen können sich den Ausweg leisten, die Frage nach der Wahrheit des Evangeliums in einen billigen Pluralismus zu verwässern. Trotzdem geht ein Gespenst um in der Kirchenlandschaft: Unter den Schaumkronen eines nivellierenden Gleichheitspluralismus erscheint das blasse, verstockte Gesicht der alten, klerikalen Obrigkeitskirche. Letztere allerdings fürchtet nichts so sehr wie theologische Argumente.
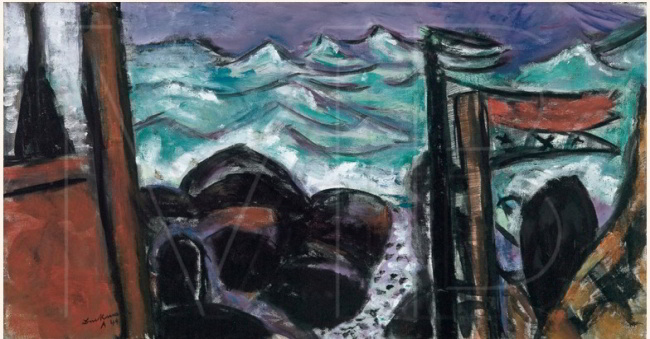
[Redaktion:]
Die Kunstwerke in diesem Artikel stammen von dem Künstler Max Beckmann
(* 12. Februar 1884 in Leipzig; † 27. Dezember 1950 in New York City)
Anmerkungen
[1] Der Titel dieses Essays entstammt der Fanhymne des Fußballvereins 1.FC Union Berlin und lautet im Kontext des Refrains: „Wo riecht's nach verbranntem Rasen?/ Eisern Union, Eisern Union/ Da wo wir zum Angriff blasen/ Eisern Union, Eisern Union / Es kann nur einen geben / Eisern Union, Eisern Union / Wir werden ewig leben/ Eisern Union, Eisern Union“ Auf Punkte und Kommas wird hier offensichtlich aus naheliegenden Gründen verzichtet. Vgl. https://www.unioner.eu/textsicher-ins-stadion/ sowie http://union-berlin.com/general-info/union-songs/. Es gilt auch: Selbstverständlich wird hier Union Berlin, ein Fußballclub zur Ersatz-Religion stilisiert. Das aber ist nicht das Thema dieses Essays, auch wenn sich so genannte Fußball- oder WM-Pfarrer aus durchsichtigen Gründen für solche Analogien begeistern.
[2] Vgl. Andreas Mertin, Das falsche Bild im Schaukasten. Zur aktuellen Ikonographie des Religiösen XV, tà katoptrizómena, H.130, April 2021, https://theomag.de/130/am723.htm; Wolfgang Vögele, Badische Erinnerungsorte (alternativ), tà katoptrizómena, H. 130, 2021, https://www.theomag.de/130/wv066.htm; ders., Union Karlsruhe? Rezension von Johannes Ehmann, Gottfried Gerner-Wolfhard (Hg.), 200 Jahre Vereinigte Evangelische Landeskirche in Baden 1821-2021. Geschichte. Gottesdienst. Gemeinde, Sonderveröffentlichungen des Vereins für Kirchengeschichte Bd. 12, Neulingen 2020, tà katoptrizómena, H.3, Nr. 131, 2021, https://theomag.de/131/wv069.htm.
[3] Wolfgang Vögele (Hg.), Die Bekenntnisschriften der Badischen Landeskirche, Bd.1+2, Karlsruhe 2015.
[4] Notger Slenczka, Theologie der reformatorischen Bekenntnisschriften. Einheit und Anspruch, Leipzig 2020. Die folgenden Seitenangaben dieses Abschnitts beziehen sich auf dieses Werk.
[5] Martin Luther, Enarratio in Ps LI, WA 40/II, 328.
[6] Vgl. Slenczka, a.a.O., 91: „…durch die Bekenntnisse soll eine Verkündigung und Sakramentsverwaltung sichergestellt werden, die eine Existenz im Glauben aus sich heraussetzen, die also die Existenz im Glauben ermöglichen und damit die Gemeinschaft der Glaubenden – die Kirche – konstituieren und erhalten.“
[7] Der Text der Leuenberger Konkordie in Vögele, a.a.O., Anm.3, Bd.1, 151-162; vgl. dazu Wolfgang Vögele, Übereinstimmung im Evangelium und Kirchengemeinschaft, in: ders., Kirchenkritik. Beiträge zu Kirchentheorie, praktischer und ökumenischer Theologie, KirchenZukunft konkret 12, Münster u.a. 2019, 185-202.
[8] Der Text der Unionsurkunde, in Vögele, a.a.O., Anm.3, 133-140.
[9] Dazu Wolfgang Vögele, Menschenwürde zwischen Recht und Theologie. Begründungen von Menschenrechten in der Perspektive öffentlicher Theologie, Öffentliche Theologie Bd. 14, Gütersloh 2000.
[10] Dazu Wolfgang Vögele, Helmut Bremer, Michael Vester (Hg.), Soziale Milieus und Kirche, Religion in der Gesellschaft 11, Würzburg 2002. Dem folgte bis heute eine unüberschaubare Zahl von Milieu-Veröffentlichungen.
[11] Dazu Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, Berlin 2017; vgl. zur theologischen Interpretation und zur religionssoziologischen Einordnung Wolfgang Vögele, Singularisierung, Säkularisierung oder sichere Schrumpfung. Eine Auseinandersetzung mit Andreas Reckwitz‘ These von der Singularisierung unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage in Religionssoziologie und Kirchentheorie, tà katoptrizómena, Heft 125, Juni 2020, https://theomag.de/125/wv059.htm.
[12] Axel Honneth, Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte, Berlin 2018. Aus katholischer fundamentaltheologischer Perspektive dazu sehr spannend Markus Knapp, Weltbeziehung und Gottesbeziehung. Das Christentum in der säkularen Moderne - eine anerkennungstheoretische Erschließung, Freiburg/Breisgau 2020.
[13] Dazu anstelle vieler anderer Publikationen Gerhard Kruip, Wolfgang Vögele (Hg.), Schatten der Differenz. Das Paradigma der Anerkennung und die Realität gesellschaftlicher Konflikte, Philosophie aktuell. Veröffentlichungen aus der Arbeit des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, Bd.4, Hamburg 2006.
[14] Slenczka, a.a.O., Anm. 4, 77.
[15] Stellvertretend für viele andere Publikationen Hans Joas, Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg Basel Wien 2004.
[16] Zum Beispiel Friedrich-Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur. München 2004.
[17] Vgl. Vögele, Kirchenkritik, a.a.O., Anm.7 sowie ders., Das Handwerk der Theologie – ein Versuch, in: Konvent des Klosters Loccum (Hg.), Kirche in reformatorischer Verantwortung: Wahrnehmen – Leiten – Gestalten, FS Horst Hirschler, Göttingen 2008, 341-354, dort besonders Abschnitt 4: „Kleine Kritik klerikaler Sozialtechnologie“.
[18] Christian Grethlein, Art. Kommunikation des Evangeliums, Wibilex 2020, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200852/ . Mittlerweile hat Grethlein sein Programm an mehreren theologischen Beispielen demonstriert, vgl. ders., Abendmahl feiern in Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Leipzig 2015.
[19] Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Kirchen als freiwillige Assoziationen der Zivilgesellschaft. Theologische Überlegungen im Anschluß an Ronald Thiemanns Rezeption des Kommunitarismus, PTh 87, 1998, 175-183; zum Versuch einer Neudefinition dessen, was öffentliche Theologie sein könnte, ders., Schach in Gelee. Bemerkungen zum Verhältnis von öffentlicher Theologie und politischer Ethik der Macht, dargestellt am Beispiel der Serie „House of Cards“ und der Tudor-Romane Hilary Mantels, tà katoptrizómena, H. 128, Dezember 2020, https://theomag.de/128/Schach%20in%20Gelee.pdf.
[20] Es gehört zu den Paradoxa der öffentlichen Theologie, dass sie sich einerseits gegen die Autoritäts- und Obrigkeitshörigkeit in der Gesellschaft wendet, andererseits aber den blinden Fleck übersieht, der in der eigenen, internen klerikalen Autoritätshörigkeit besteht. Ich hoffe, zu diesem Paradox bald weitere theologische Reflexionen vorlegen zu können.
[23] So die Information auf dem Webportal der Kirche: vgl. https://www.refbejuso.ch/grundlagen/bekenntnisse/: „Bis auf den heutigen Tag ist die Bekenntnisfreiheit der reformierten Kirchen der Schweiz umstritten. Die einen schätzen sie sehr hoch ein als die der reformierten Kirchen anstehende Offenheit für die Vielfalt an Glaubensformen und Glaubensinhalten und für die Geltung der Glaubens- und Gewissensfreiheit auch innerhalb der Kirche, andere machen kein Hehl aus dem Vorwurf, eine Kirche ohne Bekenntnis könne eigentlich keine Kirche sein, weil sie nicht behaftbar sei. (…) Im übrigen liegt es nicht an geschrieben Texten. Der Akt des Bekennens ist wichtiger als Bekenntnisakten, und echt ist das Bekennen nur dann, wenn es in Freiheit geschieht.“
[25] Zum Thema Abendmahl und Union: Wolfgang Vögele, Brot und Wein. Ein Gutachten zur gegenwärtigen Abendmahlspraxis in ökumenischer Perspektive, in: ders., Kirchenkritik, a.a.O., Anm. 7, 269-362.
[26] Zur Geschichte der Union neuestens Johannes Ehmann, Gottfried Gerner-Wolfhard (Hg.), 200 Jahre Vereinigte Evangelische Landeskirche in Baden 1821-2021. Geschichte. Gottesdienst. Gemeinde, Sonderveröffentlichungen des Vereins für Kirchengeschichte Bd. 12, Neulingen 2020, darin insbesondere die beiden kirchenhistorischen Beiträge von Johannes Ehmann (Die badische Union in historisch-systematischer Betrachtung (13-30); Die Urkunde über die Vereinigung beider Evangelischen Kirchen im Großherzogtum Baden vom 26.Juli 1821. Ein historisch-theologischer Kommentar (31-66)).
[27] Vögele, Bd. 1, a.a.O., Anm.3, 141.
[28] Dazu zum Beispiel über die Tradition reformierter Raumästhetik Andreas Mertin, Die Geste des weißen Raumes. White Cube – oder: Gibt es eine Szenografie reformierten Glaubens?, tà katoptrizómena, H. 83, Juni 2013, https://www.theomag.de/83/am439.htm.
[29] Johann Peter Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, Frankfurt 2008 (nach der Ausgabe Tübingen 1811), 220f.
[31] Besonders beliebt sind die Metaphern des Baumes mit vielen Ästen, auf denen sich jede singende christliche Amsel ihr Nest bauen kann, oder das Mobile, bei dem verschiedene christliche Wahrheiten gleichzeitig durch die gute Luft schweben und sich um sich selbst drehend nie in die Quere kommen. So lassen sich dann auch Schwitzhütten, Schamanenzelte, Feuerläufe, Runenorakel, Reiki, maskuline Wallfahrten und andere Sonderangebote aus dem religiösen Supermarkt in die theologisch weichgespülte Erwachsenenbildung integrieren.
[32] Dazu ausführlicher Wolfgang Vögele, Das Abendmahl der Aktenordner. Beobachtungen zum Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung, in: ders., Kirchenkritik, a.a.O., Anm. 7, 17-44.
[33] Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. III, Stuttgart 1966, 239.
[34] Kollegium des Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe (Hg.), Christen und Muslime. Gesprächspapier zu einer theologischen Wegbestimmung der Evangelischen Landeskirche in Baden, Karlsruhe 2018, (PDF) .
[35] Zur Kritik des Islampapiers ausführlicher: Wolfgang Vögele, Dialog zwischen Christentum und Islam. Eine Thesenreihe, in: ders., Kirchenkritik, a.a.O., Anm. 7, 363-388 sowie a.a.O., 54ff. Zur Kritik des Papiers aus der Sicht eines liberalen Muslim: Abdel-Hakim Ourghi, Interreligiöser Dialog muß sein – aber bitte ohne Weichspüler, NZZ 20.12.2019, https://www.nzz.ch/feuilleton/interreligioeser-dialog-muss-sein-aber-bitte-ohne-weichspueler-ld.1528333.
[37] Nach meiner Meinung wäre die Frage zu stellen, worin eigentlich die „Theologie“ der öffentlichen Theologie besteht. Soweit ich sehe, hat sie sich in den letzten Jahren eher in eine politische Ethik oder in eine Ekklesiologie verwandelt.

