
Differenz - Dissidenz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmunder Anstöße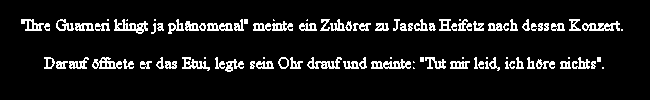
Zur fortgeschriebenen Subjektlosigkeit des evangelischen KirchenbausAndreas Mertin
Im Folgenden möchte ich am Beispiel der so genannten Dortmunder Denkanstöße des Evangelischen Kirchbautages 2008 einmal den Worten, den Veränderungen von Worten und ihren Implikationen nachgehen. Ich betreibe also ein Stück Exegese heutiger Kirchenkultur. Der Text liegt in zwei Varianten vor, einmal als Beschlussvorlage und einmal als beschlossener Text.
Die deutsche Sprache unterscheidet zwischen dem Gebrauch von „ändern“ und „verändern“. Während „ändern“ sich auf konkrete einzelne Tatbestände bezieht, meint „verändern“ eine Änderung im Grundsätzlichen. Die einleitenden Formulierungen in den Dortmunder Denkanstößen sind daher von einer sprachlichen Ambivalenz, die nicht uninteressant ist. Man müsste fragen: Was unterscheidet eine Formulierung wie „Gesellschaften ändern sich“ von der Formulierung „Gesellschaften werden verändert“? In der ersten Formulierung ist das Subjekt ebenso beobachtend wie erleidend, in der zweiten ist seine aktive Rolle mitgesetzt. „Geschichte ist machbar, Herr Nachbar“ skandierten die 68er und wollten sich nicht damit abfinden, dass die Gesellschaft sich einfach nur ändert, sondern sie wollten die Gesellschaft durch Änderungen auch verändern. Im 20. Jahrhundert wurde die Gesellschaft mehrfach verändert: durch Arbeiteraufstände, durch Ermächtigungsgesetze, durch Kriege, durch Protestbewegungen, durch Anti-Terror-Maßnahmen. Jedes Mal ging es nicht nur um Änderungen, sondern um Veränderungen. Im Resultat war die Gesellschaft eine andere. Ähnliches gilt auch für Gemeinden: Gemeinden ändern sich nicht einfach nur, sie werden von Menschen und Gruppierungen mit konkreten Interessen geändert mit dem Ziel ihrer Veränderung – das erleben wir zur Zeit, insoweit die Kirchen nach und nach von oben nach unten verändert werden. Die Veränderung der Gemeinden ist kein Naturprozess, sondern ein historischer und damit beeinflussbarer Vorgang. Die Subjektlosigkeit der einleitenden Formulierung ist daher ebenso wie die Beschränkung auf bloße Änderungen symptomatisch, er verschleiert die Verantwortlichkeit der Handlungsträger. Man kann auch fragen, ob die einleitenden Sätze eventuell eine Neuformulierung des „ecclesia semper reformanda est“ sein sollen. Dieses immer wieder Luther zugewiesene Wort stammt in Wirklichkeit aus der reformierten hugenottischen Tradition: „Ecclesia reformata semper reformanda.” Und es spricht nicht von einem anonym und gleichsam naturwüchsig erfolgenden Prozess der Änderung der Gemeinde, sondern – das macht das appellative reformanda deutlich – von der Veränderungsbedürftigkeit der Kirche durch handelnde Subjekte.
Nein, Liturgien verändern sich nicht, sie werden geändert und verändert (am dramatischsten im Bereich der katholischen Kirche im Rahmen des 2. Vatikanums). Es sind ganz konkrete Subjekte, die Liturgien verändern, Subjekte, die gesellschaftliche und kirchliche Strömungen repräsentieren und sich mit ihren Ansichten von Fall zu Fall durchsetzen. Nein, Kirchbauten verändern sich nicht (sieht man einmal von Naturprozessen und Witterungseinflüssen ab), sie werden geändert und verändert. (Auch hier ist das 2. Vatikanum beispielhaft). Es liegt an den beteiligten Subjekten, wie sich Liturgien und Kirchbauten ändern, wenn es denn zu einer Veränderung kommen soll. Auch dies wird durch die Formulierung verschleiert. Was meint ein Satz wie „Gott können wir hörbar und spürbar erfahren“? Heißt das: Gott können wir hören und spüren? Und wo? Oder ist es eine Umformulierung des Satzes, dass wir Gott in Predigt und Sakrament erfahren? Aber genau das ist ja die zentrale raumtheologische Frage, ob wir Gott „nur“ in Predigt und Sakrament erfahren (wie dies Martin Luther und ihm folgend zum Beispiel das nordelbische Papier „Zur theologischen Bedeutung des Kirchenraums“ vertreten). Hier ist die Schwammigkeit der Formulierung Flucht vor der Auseinandersetzung. Wenn „hörbar und spürbar“ für Wort und Sakrament stehen, sind dann die Predigt und das Sakrament, in denen wir Gott erfahren, auch Maßstab des Kirchenbaus? Oder soll der Kirchenbau selbst Gott hörbar und spürbar machen? Das ist ja der Konflikt im Blick auf die kontroverse Formulierung von der „Predigt der Steine“. Hier geht das Papier der notwendigen Auseinandersetzung um die theologische Bedeutung des Kirchenbaus aus dem Wege.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie mit der Sprache Schindluder getrieben wird. Nehmen wir zunächst die Vorlage: Der erste Satz ist ein performativer Selbstwiderspruch. Wenn die These stimmt, ist der Satzanfang falsch formuliert (dann müsste es heißen: Kirchen sind nicht nur unsere Kirchen), wenn der Satzanfang stimmt, stimmt die These nicht. „Unsere“ ist ein Possessivpronomen, ein besitzanzeigendes(!) Fürwort. Ganz abgesehen von der Unbestimmtheit des Wortes „unsere“ in „Unsere Kirchen“ (Für wen steht es: die Gemeinde, die Staatsbürger, die Kirchenleitung, vielleicht sogar alle Menschen ….?). Wenn gemeint ist, dass Kirchen nicht nur den Menschen, sondern auch Gott gehören – darauf deuten einige der folgenden Präzisierungen –, dann würde ich hier starken Diskussionsbedarf anmelden. In der verabschiedeten Fassung heißt es noch widersinniger „Unsere Kirchen gehören nicht uns selbst“. Was könnte gemeint sein? Die Kirchengebäude gehören uns gar nicht? Das wäre nicht uninteressant. Oder gehören die Kirchen nicht den Subjekten, die Kirche und Gemeinde bilden? Wem aber dann? Und warum können wir dann Kirchen verkaufen? Denn angeblich sind wir gar nicht Eigentümer von Kirchen. Statt dessen seien wir, hier sind sich Vorlage und Beschluss einig, Treuhänder. Ein Treuhänder ist eine Person, die zwischen zwei anderen Beteiligten als Instanz eingeschaltet wird. Es muss also eine Instanz A geben, die uns etwas zur treuen Hand gegeben hat und es muss eine Instanz B geben, der gegenüber wir als Treuhänder von A auftreten. Das Papier schreibt genauer: wir sind Treuhänder der Kirchengebäude! Wenn ich die Formulierung richtig verstehe, ist sie fragwürdig, weil sie das Gebäude als Subjekt fasst. Das Gebäude ist in der Satzkonstruktion nicht Verfügungsmasse, sondern das treuhänderisch zu vertretende Subjekt: wir sind ihre(!) Treuhänder heißt es. Das hätte ich gerne einmal konkretisiert und begründet! Der nachfolgende Satz ist meines Erachtens problematisch, insoweit er besagen soll: ohne Berücksichtigung der Geschichte der Kirchengebäude haben wir keine Zukunft. Was hier geschieht, ist nicht einfach die übertriebene verbale Verstärkung des Wunsches, sich intensiver um Kirchengebäude zu kümmern. Hier werden systematisch Gemeinde und Kirchengebäude gegeneinander ausgetauscht. Muss man daher schon an Barmen III und VI erinnern? „Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.“ (Barmen III) Die Geschichte, den Bau und den Erhalt von Kirchengebäude zum Kriterium der Zukunft der Kirche zu machen, ist so gesehen falsche Lehre: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.“ (Barmen VI) Der Schluss dieses Abschnitts stellt eine Verbindung her, die theologisch unsauber ist. Die Tatsache, dass wir daran glauben, dass nach Jesaja 43 „alle Menschen zu Gott gehören und zu ihm gerufen sind“ hat überhaupt nichts mit Kirchengebäuden zu tun. Die ganze Welt ist ein öffentlicher Ort der Transzendenz und nicht etwa nur bestimmte abgegrenzte Räume. Der Ruf Gottes ist ein Ruf zum Glauben und nicht zum Kirchen(gebäude)besuch.
Was bedeutet die Formulierung von der „Kompetenz des Glaubens und der Kirche“? Hier werden wieder eigentlich an Subjekte geknüpfte Dinge wie Kompetenz auf Institutionen und Haltungen übertragen. Ist damit gemeint, dass, wer glaubt, zugleich über Kompetenzen verfügt? Dass, wer zur Kirche gehört, automatisch über Kompetenzen verfügt? Oder verfügt der Glaube selbst über Kompetenzen (im Sinne von: der Glaube kann Berge versetzen)? Verfügt die Kirche über Kompetenzen oder verfügen nur die die Kirche leitenden Menschen über solche? Ich vermute einmal, dass der Glaube eines Menschen immer so etwas wie die Reflexion von Übergängen oder meinetwegen auch Transformationen beinhaltet, nicht zuletzt, weil der Mensch dabei über Vergänglichkeit nachdenkt. Und dass die Kirche jene Versammlung von Gläubigen ist, die darüber immer wieder gemeinschaftlich nachdenkt. Was aber haben diese Reflexionen der Gemeinde über die Veränderungsbedürftigkeit der Welt mit dem Transformationen des Kirchenbaus zu tun? Das ist mehr assoziativ herbeigeredet, als wirklich in der Sache begründet.
Der dritte Punkt der Vorlage und der siebte Punkt der beschlossenen Fassung weisen die größte Differenz auf. Hier wurde die Formulierung in ihr Gegenteil verkehrt und zudem zu einem durch und durch unevangelischen Satz gemacht. Der Satz der Vorlage ist klar und deutlich: Wer sich nur auf die ökonomischen Aspekte konzentriert, übersieht vielleicht andere Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten. Diesen Satz kann man sofort unterschreiben. Der endgültige Beschluss besagt aber etwas völlig anderes: Er spricht von einer „unvermeidlichen Konzentration auf Geld und Wirtschaftlichkeit“. Das ist nicht nur religionswissenschaftlich unsinnig, weil gerade Religionen durch die Außerkraftsetzung scheinbar vordringlicher ökonomischer Regeln charakterisiert sind. Man denke nur an das indianische Potlatch, ja, auch der Kirchenbau selbst ist genau das Gegenteil von Konzentration auf Geld und Wirtschaftlichkeit, insoweit er Raum über die Maße zu nicht funktionalen Zwecken verausgabt. Wenn es nur um Sakrament und Predigt ginge, bräuchte man keine Kirchenräume. Kirchenräume sind eine Verausgabung von Kapital, die sich aus der Kapitallogik gerade nicht begründen lässt – es sei denn mit der einschüchternden Wirkung auf die Gläubigen. Das galt aber eher für das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Heute huldigen nur noch Banken und Versicherungskonzerne dieser Ideologie. Das Ganze ist auch theologisch unsinnig, insoweit der Begriff „Konzentration“ im wörtlichen Sinne in die Irre führt. Wenn unter Konzentration (lat. concentra = Zusammen zum Mittelpunkt) die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit verstanden wird, dann sollte sich die kirchliche Konzentration gerade nicht auf Geld und Wirtschaftlichkeit, sondern auf Jesus Christus fokussieren: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ Es gibt keine unvermeidliche Konzentration in der Kirche neben dieser einen. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Grundsätzlich muss die Diskussion um die Fortführung des Kirchenbaus sich an dem einen Wort Gottes orientieren. Es gehört zu den problematischen Tendenzen der Denkanstöße in der jetzt verabschiedeten Form, dass sie versuchen, mehrfach neben das eine Wort Gottes noch andere Wahrheiten zu setzen: das gilt – wie gerade erwähnt – für die Ökonomie, es gilt aber auch für die Kultur (oftmals tituliert als „unsere Kultur“), die als zwingendes Argument in die theologische Auseinandersetzung eingeführt wird. Das wird im Folgenden deutlich:
Man muss die Situation verstehen, aus der die Abänderung der Vorlage entstanden ist. Der Kirchbautag stand offenkundig unter dem Eindruck eines Vortrags einer Kunsthistorikerin, die deutlich machte, dass Kirchenbauten neben ihrer religiösen bzw. theologischen Bedeutung auch eine historische, politische und kulturelle Bedeutung haben, vor allem deshalb, weil vorreformatorisch ein guter Teil der öffentlichen Kommunikation in Kirchen stattfand. Daher forderte sie, das dieser Tatsache auch in der Wahrnehmung von Kirchengebäuden Rechnung getragen wird. Dieser Forderung wird man wenig entgegen setzen können. Es ist eben nur keine theologische Forderung, sondern eine kulturelle, politische oder gesellschaftliche Forderung. Was der Kirchbautag in seinem Bemühen um Anerkenntnis dieser Forderung dann gemacht hat, ist ein Stück konservativer politischer Theologie. Man muss nur einmal die Formulierung „Kirchengebäude sind Erinnerungsorte für die kulturelle Tradition in unserem Land“ bedenken, um das einzusehen. Was ist eigentlich ‚unser Land’ im Rahmen eines Glaubens an einen Herrn, dessen Reich nicht von dieser Welt ist? Die Floskel „in unserem Land“ soll ja etwas aussagen, da der Satz ohne dieses Anhängsel auch verständlich wäre. „Kirchengebäude sind Erinnerungsorte für die kulturelle Tradition“ – besser wäre „für kulturelle Traditionen“ – ist eine klare Beschreibung. Wenn die Formulierung „in unserem Land“ also eine nähere Spezifikation darstellt, dann können nur die kulturellen Traditionen in Ländern, die nicht unsere sind, als Opposition in Frage kommen. Aus einem deskriptiven Satz wird ein neokonservativ normativer Satz: Neben ‚In unseren Kirchen lernen wir unsere Kultur kennen’ tritt seine staatspolitische Spiegelung: „In unseren Kirchen lehren wir unsere (deutsche) Kultur.“ Es war einmal das spezifische Charakteristikum des Christentums eine kosmopolitische Religion zu sein. Jetzt vermitteln wir aber unsere Kultur in unserem und für unser Land. Das mag der eine oder andere für eine überzogene Schlussfolgerung aus den Formulierungen des Papiers halten, aber dann muss er die folgende Ergänzung gegenüber der Vorlage in den Dortmunder Denkanstößen plausibel erklären:
Das einzige, was ich in diesem Abschnitt positiv finde, ist die Aufnahme des Wortes „religiöse Räume“ in einem kirchlichen Papier zum Kirchenbau. Lange Zeit und bis in die jümgste Gegenwart hatten sich ja große Teile des Fachpublikums dagegen gewehrt, die in der Formulierung „religiöse Räume“ liegende Subjektivierung der Raumkonstruktion anzuerkennen. Statt dessen sprach man weiter von heiligen Räumen oder Orten, von Sakralräumen usw., also von Räumen mit quasi-ontologischen Eigenschaften. Wenn man aber von religiösen Räumen in dem Sinne spricht, wie es programmatisch das Magazin für Theologie und Ästhetik in einer Reihe von Aufsätzen entwickelt hat, dann ist die Gegenübersetzung oder auch Parallelisierung von suchenden und bekennenden Menschen unsinnig. Im Sinne der von mir vertretenen Theologie müsste es heißen: Kirchen sind religiöse Räume für alle Menschen. Das ist deshalb wichtig, weil es den Anschlusssatz der Denkanstöße begrenzt. Kirchengebäude sind zunächst einmal Dienst an und Angebot für alle Menschen, in der bewussten Differenz zum Alltag, quasi in einem Heterotop, sich zu besinnen und die punktuell und temporär ausgegrenzte Welt zu bedenken. Religiös werden diese Räume, wenn sie von den eingeladenen Menschen als solche rezipiert werden. Religiöser Raum ist kein ontologischer Status, sondern ein kommunikatives Geschehen. Dieses Kommunikationsangebot gilt jedem Besucher. Die Begrenzung auf „suchende und bekennende(!) Menschen“ führt in die Irre. In Matthäus 11, 28 heißt es präzis: „So kommt doch alle (!) zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid: Ich will euch ausruhen lassen.“ Der sich anschließende Satz „Kirchen sind öffentliche Räume für alle Menschen, die im Horizont unserer Kultur leben wollen“ ist in seinem ersten Teil selbstverständlich, in seinem Relativsatzteil unerträglich. Wieder verdankt sich der Satz der Reaktion auf den bereits erwähnten Vortrag, da es darum ging, dass auch muslimische Kinder nur durch den Besuch der Reinoldikirche verstehen können, was Dortmunder Stadtgeschichte ist. Ein guter Teil der politischen Heimatgeschichte Dortmunds hat sich in dieser Kirche abgespielt. Es gibt aber einen unguten Unterton in dieser Formulierung, insoweit sie insinuiert, wer im Horizont unserer(?) Kultur leben wolle, sich damit auch zu beschäftigen habe. Ein Schelm, wer dabei an Muslime und die christlich-abendländischen Einbürgerungsprogramme denkt. Das darf nicht dazu führen, dass die Kirche die kulturelle und politische Überlieferung zu einem theologischen Argument macht. Wenn wirklich jeder, der im Horizont dieser Kultur leben will, Zugriff auf die Kirchen als öffentliche Räume haben soll, müssen diese öffentlichen Räume dann nicht von jenen Symbolen und Darstellungen befreit werden, die Andersdenkende und –glaubende ausschließen? Wie steht es dann mit den substitutionstheologischen Synagoga-Darstellungen an christlichen Kirchen? Wäre Analoges an öffentlichen Räumen der Europäischen Union denkbar? Darf in öffentlichen Räumen gegen das Judentum als blinder Religionsgemeinschaft gehetzt werden? Und wie steht es mit vollfigürlichen Darstellungen Gottes und Jesu, die jedem Muslimen, jedem Reformierten und jedem Juden, der die biblischen Gebote ernst nimmt, ein Gräuel sein müssen? Muss ich mir die Gotteslästerung gefallen lassen, wenn ich im Horizont dieser Kultur leben will und daher deren öffentliche Räume aufsuche? Das scheint mir alles noch nicht recht ausgegoren zu sein. Verführerisch ist diese Argumentation nur so lange, wie sich aus ihr finanzielle Forderungen an den Staat ableiten lassen. Wenn Kirchen aber öffentliche Räume im Sinne der staatsbürgerlichen Teilhabe sein sollen und nicht nur Dokumente der Kulturgeschichte, dann hat das eben auch Folgen für die Bildertheologie, die immer auch politische Theologie ist.
An diesem Punkt wird ein wenig geschludert, indem die begrifflichen Differenzierungen zwischen Kirchen als Gebäuden, Kirche als Institution und Kirchen als Gemeinden verwischt werden. Das soziale Handeln der Kirche ist weitgehend nicht an Kirchengebäude gebunden. Es dürfte zu über 90% an anderen Orten stattfinden, in Altersheimen, Diakonischen Werken, Kindergärten usw. Hier erschleicht man sich durch Begriffsverwirrung den Anspruch auf bau-finanzielle Unterstützung. Ein guter Teil der sozial-kulturellen Arbeit der Kirche wird bereits heute staatlich unterstützt und finanziert. Die Kulturarbeit der Kirchen im engeren Sinne müsste sich dagegen auch an der gesellschaftlichen Konkurrenz messen lassen, wenn sie begehrlich auf die öffentlichen Töpfe schielt. Die mögliche finanzielle Verantwortung des Staates für Kirchengebäude will ich dabei gar nicht in Abrede stellen. Sie sollte nur nicht mit den falschen Argumenten eingefordert werden. Wenn der Polis etwas an den Kirchengebäuden liegt, dann soll sie sich auch an deren Finanzierung beteiligen. Wenn sie nicht daran interessiert ist, dann unterliegt sie auch keiner Verpflichtung. Da der Polis heute viel an den Kirchen als Zeichen in der Stadt liegt, sollte sie sich also an den Kosten beteiligen – wie sie das ja auch bei Neubauten von Synagogen und Moscheen macht.
Abgesehen von der katholischen Formulierung „Sinnschätze der christlichen Tradition“ stört mich hieran wenig. Das Wort von der „spirituellen Heimat“ ist mir zu WischiWaschi. Vielleicht wäre es besser, hier der Philosophie Ernst Blochs eingedenk zu sein: „Nicht Heimat suchen, sondern Heimat schaffen! --- Es geht um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war.“ (Ernst Bloch) Anders ausgedrückt: die spirituelle Heimat steht unter eschatologischem Vorbehalt.
Hier ist die Abweichung von der Vorlage interessant, weil sie wieder das ursprünglich Intendierte in sein Gegenteil kehrt. Plötzlich wird das Parochialprinzip eingeschoben, was deutlich die Richtung und das kirchenleitende Interesse anzeigt. Was mich an der Vorlage gestört hat, ist, dass sie in den Begriff der Profilkirche nicht auch die Gemeindekirche integriert. Wir brauchen eigentlich ausschließlich Profilkirchen, zu denen selbstverständlich auch Gemeindekirchen gehören. Eine Gemeindekirche ist aber gegenüber einer Diakoniekirche nicht ausgezeichnet (so wie der Priester nicht gegenüber dem Laien). Der jetzige Beschluss macht aber die Gemeindekirche zum normativen Regelfall, der ergänzend andere Kirchen beigefügt werden können. Das kann man so machen, wäre aber gerade nicht zukunftsweisend. Insoweit unterstellt wird, in der Gemeindekirche wäre man näher im Zentrum der Kirche als in der Jugendkirche, der Diakoniekirche, der Kirche der Evangelischen Studentengemeinde oder der Krankenhauskapelle, würde ich das entschieden bestreiten. Was die Einfügung der Formel „in der Verantwortung für das Evangelium“ bedeuten soll, erschließt sich mir nicht. Das klingt wie ein reflexhaft eingeschobener Satzteil. Wer ist hier für was verantwortlich? Ich verstehe es nicht. Müsste es nicht sinnvoller heißen „in der Verantwortung vor dem Evangelium“? Aber auch dann wäre es nur eine Floskel.
Das sind nette Schlussworte, aber dadurch werden sie nicht wahrer. Wir haben viel zu viele Kirchen und wir haben zu wenige Familienberatungsstätten, wir haben zu viele Gemeindehäuser und zu wenige Krankenhausseelsorger, wir haben zu viel kirchliche Bauverwaltung und zu wenige Schulreferenten. Weiter zu bauen und zu planen ist keinesfalls automatisch ein Zeichen der Hoffnung. Es kann auch der simplen Selbstbestätigung dienen. Umgekehrt kann das Aufgeben von Gebäuden durchaus ein programmatisches Zeichen der Hoffnung sein. Zeichen sind eben lektüreabhängig. Das Aufgeben des Berliner Doms könnte man so als Zeichen der Hoffnung auf eine von der engen Bildung von Thron und Altar frei werdende Kirche lesen. Und der Verkauf von einem Drittel aller Kirchengebäude wäre ein hoffnungsvolles Zeichen, dass sich die Kirche von den Äußerlichkeiten ab- und ihrer Botschaft wieder zuwendet. Nicht umsonst tragen zwei der programmatischen Reden Jesu die Titel Feld(!)predigt und Berg(!)predigt. Schlussfolgerung In der Tendenz dienen die Dortmunder Denkanstöße einer neokonservativen Veränderung der Diskussion um den Kirchenbau. Früher ging es um innovative Impulse, die vom Kirchbautag in die Kirche und auch die Gesellschaft ausstrahlen sollten. Wer die Diskussionsprotokolle früherer Kirchbautage verfolgt, spürt, wie hier Kirche dynamisch gestaltet werden soll – auch im Sinne der Partizipation. Davon ist aktuell wenig zu hören und zu spüren. Indem die Rolle der Kirche als Kulturträger und –vermittler über Gebühr betont wird, ordnet man sich in die begriffliche Abbreviatur der politischen Theologie ein. Indem die Ökonomie zum Zentrum der kirchenbaubegleitenden Reflexionen erklärt wird, unterwirft man sich der Kapitallogik statt sich am Evangelium zu orientieren. Indem man Institutionen und Objekte zu zentralen Handlungsträgern stilisiert, unterschlägt man die aktive Rolle der die Gemeinde bildenden Subjekte. Darum aber geht es meines Erachtens im Kern: die verschwommene Sprache soll verschleiern, wer hier eigentlich welche Entscheidungen trifft. Der wiederholt vernehmbare Hinweis aus Kreisen der EKD, man möge doch berücksichtigen, dass die Gesellschaft sich geändert habe, unterschlägt, von wem sie verändert wurde. Für die die Gemeinde bildenden Subjekte sind die Dortmunder Denkanstöße eher entmutigend. Die Anonymisierung historischer Vorgänge überdeckt, was wirklich geschieht und in den Dortmunder Denkanstößen ihren ideologischen Ausdruck findet: die beabsichtigte Transformation der Kirche von einer bottom-up-Initiative zu einem top-down-Betrieb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/56/am263.htm
|
