Kirchenbau Regulativ
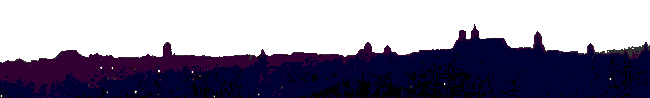
Evangelische Kirchbauprogramme von 1856 bis 2008
Andreas Mertin
 Kirchenbauprogramme sind seit ihren Anfängen ein Dokument der sich globalisierenden Kultur. Sie zeugen von dem Bemühen, über regionale Grenzen hinweg Einheitlichkeit zu erzwingen oder doch zu bewirken. Insofern sind sie immer schon ein Teil der Bemühungen um das Corporate Identity der Evangelischen Kirche. Kein Wunder also, dass in den letzten Jahren die entsprechenden Papiere an Zahl zulegen, so wie sie auch Mitte des 19. Jahrhunderts, als es um die nationale organisatorische Verbindung des Protestantismus ging, zugenommen haben. Kirchenbauprogramme sind seit ihren Anfängen ein Dokument der sich globalisierenden Kultur. Sie zeugen von dem Bemühen, über regionale Grenzen hinweg Einheitlichkeit zu erzwingen oder doch zu bewirken. Insofern sind sie immer schon ein Teil der Bemühungen um das Corporate Identity der Evangelischen Kirche. Kein Wunder also, dass in den letzten Jahren die entsprechenden Papiere an Zahl zulegen, so wie sie auch Mitte des 19. Jahrhunderts, als es um die nationale organisatorische Verbindung des Protestantismus ging, zugenommen haben.
Zunächst einmal sind Kirchbauprogramme herausragende Momente des Zeitgeistes. Anders als es die Verfasser meinen, sind ihre objektiven Darlegungen – das wird zumindest in der Rückschau deutlich – weitgehend dem Geist der jeweiligen Zeit geschuldet. Zum anderen sind diese Programme aber auch auf paradoxe Weise ambivalent und amüsant, weil sie in einem geradezu verzweifelten Gestus Dinge erzwingen und festschreiben wollen, die nicht fixierbar sind.  Denn das „Ecclesia reformata semper reformanda” steht in einem programmatischen Widerspruch zu allen bauästhetischen Normierungsbemühungen. Amüsant sind diese Regulative, Leitsätze, Empfehlungen usw. auch deshalb, weil das, was das eine Papier als Unmöglichkeit im Kirchenbau beschreibt, das nächste schon den Bauherrn dringlich ans Herz legen möchte. In der Sache bräuchte man überhaupt keine derartigen Programme, sondern sollte das Ganze zwischen Gemeinde und Architekten verhandeln lassen. Aber da wir die Programme nun mal haben, mag es sich lohnen, einen subjektiven Blick aus heutiger Perspektive darauf zu werfen. Denn das „Ecclesia reformata semper reformanda” steht in einem programmatischen Widerspruch zu allen bauästhetischen Normierungsbemühungen. Amüsant sind diese Regulative, Leitsätze, Empfehlungen usw. auch deshalb, weil das, was das eine Papier als Unmöglichkeit im Kirchenbau beschreibt, das nächste schon den Bauherrn dringlich ans Herz legen möchte. In der Sache bräuchte man überhaupt keine derartigen Programme, sondern sollte das Ganze zwischen Gemeinde und Architekten verhandeln lassen. Aber da wir die Programme nun mal haben, mag es sich lohnen, einen subjektiven Blick aus heutiger Perspektive darauf zu werfen.
Bevor man das tut, sollte man einen Blick auf den protestantischen Kirchenbau vor den evangelischen Kirchbauprogrammen werfen, um zu erkennen, wozu bzw. wogegen sich die Programme eigentlich verhalten. Da das an dieser Stelle nicht geleistet werden kann, verweise ich auf das Buch „Evangelischer Kirchenbau“ von Kathrin Ellwardt, das anhand von zahlreichen Beispielen in das Thema sachkompetent einführt. [Siehe dazu auch die Rezension in diesem Heft von Tà katoptrizómena.]
1. 1856 - Dresden (Bestimmungen der liturgischen Konferenz)
Das erste Kirchbau-Papier aus dem Jahr 1856 sucht offenkundig den protestantischen Kirchenbau an die Tradition der Kirche anzuschließen. Er eröffnet mit dem Satz „Die alte Sitte (X) darf bei Anlegung neuer Kirchen nicht übersehen werden, damit die alte Sitte (Y) nicht gestört werde. X und Y beziehen sich dabei auf die Ostung der Kirche. "Bloß keine Experimente" könnte man auch sagen.
Und das gilt auch für alles Weitere. Der Altarraum muss sich über dem Gemeinderaum ebenso erheben wie der Geistliche über die Gemeinde. Warum? Das wird nicht gesagt, wie überhaupt die Mehrzahl aller Bauprogramme in ihren Bestimmungen und Konkretionen merkwürdig begründungslos bleiben – und das nicht nur in theologischer Hinsicht. Auf die Idee, dass das allgemeine Priestertum aller Gläubigen auch abweichende Raumgestaltungen denkbar sein lässt, kommt man erst gar nicht. Nicht einmal „für die Gemeinde bestimmtes Gestühle“ darf es im Altar- bzw. Chorraum geben. Wenn es ein Bild am Altar gibt, dann muss es „eines der grossen Hauptthatsachen des Heils“ darstellen und nicht einfach nur eine biblische Geschichte oder gar ein Moment der Kirchengeschichte.
Ganz und gar ausgeschlossen („geradezu widersinnig“) seien Kanzelaltäre. Das ist überraschend, kommt doch die Denkmalpflege 100 Jahre später zu der Erkenntnis „daß der Kanzelaltar nachweislich der gewichtigste und eigenständigste Beitrag zum protestantischen Kirchenbau ist“ (Michael Neumann). Er ist zugleich ein Ausdruck der Verbindung von Thron und Altar, hebt er den Geistlichen doch auf die Höhe der Fürstenloge. Auch weitere Ausführungen des Papiers (z.B. zu den Emporen) lassen darauf schließen, dass den Verfassern die dominante Orientierung an den Fürsten nicht geheuer war. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten. Glocken gehören zum Kirchenbau hinzu, sollen aber nur zum gottesdienstlichen Gebrauch und in Notlagen Verwendung finden (was dafür spricht, dass es auch einen anderen Gebrauch gab).
2. 1860 - Barmen („Thesen" des deutschen evangelischen Kirchentages)
Vier Jahre später gibt es „Thesen“ des deutschen evangelischen Kirchentages. Dieser ist anders als das nachfolgende Eisenacher Regulativ noch kein kirchenleitendes Dokument, sondern eher basisorientiert. Die Thesen sind mehr als doppelt so lang wie die vorherigen Bestimmungen. Auch hier wird gleich zu Anfang „die Rücksicht auf die geschichtlich entwickelte christliche Bauweise“ hervorgehoben, stärker als zuvor wird der protestantische Stil bzw. die Orientierung am evangelischen Bekenntnis hervorgehoben. Auch dieser Text ist von einer deutlichen Gegenüberstellung von Laien und Geistlichen charakterisiert. Interessant ist die Aussage, dass ein "Crucifix nach reformierter Lehre zulässig und wünschenswerth"(!) sei. Das dürfte wohl kaum zutreffend sein und könnte sich allenfalls auf Kreuze beziehen. Die Kanzel hinter dem Altar ist nicht erwünscht, weil „sie denselben in unanständiger Weise überragt“.
Der Chor, der in den Thesen eine ganz besondere Rolle spielt, wird als „durch das Altarsakrament geheiligter Bautheil“ bezeichnet – was sicher nur in lutherischer Perspektive zutreffen dürfte. Hochinteressant im Blick auf die abzuwehrenden Bauentwicklungen ist der Satz: „ Eine Kirche ohne Chor ist wie eine Kirche ohne Altar, nichts weiter als ein blosser Betsaal, und verdient den historischen Namen Kirche nicht.“ Eine Begründung dafür gibt es nicht. Die Orgel dürfe nicht zu üppig ausfallen und gehöre auf keinen Fall in den Chor.
Die §§ 15ff. widmen sich nun den in Frage kommenden Baustilen, die Ausdruck „einer tiefsinnigen Symbolik des christlichen Glaubens“ seien. Offenkundig geht die Verfasser der Thesen davon aus, dass man aus diesen Baustilen frei wählen kann und empfehlen dabei zunächst die Orientierung an den regionalen Gewohnheiten, dann aber vor allem das längliche Rechteck mit zwei Querarmen, damit sich eine Kreuzesform ergibt. Die Rotunde wird schon aus Gründen der Akustik abgelehnt. Allgemein wird die Notwendigkeit der Orientierung an der Zahlensymbolik hervorgehoben. Und schließlich wird die Gründung christlicher Kunstvereine empfohlen.
Als Bauform empfiehlt das Papier in Beachtung „architektonischer Würde“ „einen oblongen oder in’s lateinische Kreuz gestellten Grundriss, nicht aber … die Formen der Rotunde und des Vielecks“. In jedem Fall aber sei einheitlich zu bauen, bis dahin, dass die kirchlichen Geräte zum Baustil passen müssen. Insgesamt ist das Bemühen deutlich erkennbar, den protestantischen Kirchenbau in die historische Entwicklung einzugliedern und so etwas wie Einheitlichkeit zu erreichen. Die Frontstellung zu bestimmten barocken Bauformen ist erkennbar, ein Reflex auf die zeitgenössische Diskussion in der Architektur (z.B. den historistischen Renaissancestil) weniger.
Insgesamt ist das Papier nach meinem Empfinden stark pfarrerorientiert und traditionsbewusst. Eine Neigung zu Experimenten oder Öffnungen ist nicht erkennbar. Selbst dort wo Künstler mit einbezogen werden sollen, geschieht dies vor allem um der „Styllosigkeit“ bzw. „Stylmengerei“ entgegenzuwirken.
3. 1861 – Eisenach (Eisenacher Regulativ für den evangelischen Kirchenbau)
Mit dem Eisenacher Regulativ kommen wir zum ersten folgenreichen Kirchbauprogramm. Es umfasst 16 Punkte, ist wesentlich systematischer entworfen und greift erkennbar die Überlegungen der vorherigen Papiere auf und ordnet sie: „"Die Würde des christlichen Kirchenbaues fordert Anschluss an einen der geschichtlich entwickelten christlichen Baustyle und empfiehlt in der Grundform des länglichen Vierecks neben der altchristlichen Basilika und der sogenannten romanischen (vor-gothischen) Bauart vorzugsweise den sogenannten germanischen (gothischen) Styl." Daran hat sich der Kirchenbau in der Folge gehalten. Der Altarraum soll erhöht sein, aber nicht durch Schranken vom Kirchenschiff getrennt. Der Altar ist (außer für die Reformierten) mit einem Crucifix zu schmücken. Falls ein Gemälde aufgestellt wird, muss es „eine der Hauptthatsachen des Heils“ darstellen. Auch in der Kanzelfrage folgt das Regulativ seinen Vorgängern. Der letzte Punkt betont den normativen Charakter: „Vorstehende Grundsätze ... sind von den kirchlichen Behörden auf jeder Stufe geltend zu machen, den Bauherren rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen und der kirchenregimentlichen Überprüfung, beziehungsweise Berichtigung, welcher sämtliche Baurisse unterstellt werden müssen, zugrunde zu legen“. Damit wird erstmals im Protestantismus eine verbindliche Form für die Gestaltung von Kirchen gefunden. Auffallend ist, dass hier in keiner Hinsicht theologische Fragen eine Rolle spielen bzw. nicht im Papier zur Geltung gebracht werden. Statt dessen wird vor allem die Orientierung an der Tradition betont. Ein Ergebnis dieses Programms ist z.B. die Stuttgarter Johanneskirche.

Zum Eisenacher Regulativ führt Langmaack noch ein Gutachten des preußischen Ministeriums an, das vor allem in zwei abweichenden Punkten interessant ist: zum einen in der liberaleren Haltung zum Kanzelalter und zum anderen in der liberaleren Haltung zur Frage der Emporen. Beides sind aber Phänomene, die eng mit dem im Kirchenbau zum Ausdruck kommenden Verhältnis von Thron und Altar zu tun haben.
4. 1876 – Leipzig/Berlin (Allgemein giltige Regeln beim Bau christlicher Kirchen aller Konfessionen)
Die Regeln von 1876 sind von erfrischender Kürze und sehr statuarisch. Neu ist der Punkt, dass Kirchen auf einem freien Platz und möglichst erhöht gebaut werden sollen. Der Kirchenbau selbst wird nun stark allegorisiert (Arche Noah, Stiftshütte, Tempel Salomonis, neues Jerusalem, Kreuz Christi, herabführende Stufen als Demütigung vor Gott, schmale Türen, „denn der Weg zum Himmel ist enge und schmal“). Lustig der Hinweis „Auch dachten sich die Alten die Welt viereckig und die Kirche soll Abbild der Welt sein“ - nun, die Alten dachten sich die Welt auch als Scheibe ...
Den Altarraum wünscht man sich nun, anders als noch im Eisenacher Regulativ, vom Kirchenschiff durch Schranken getrennt. Neu ist die Bestimmung: „Über der Altarplatzschranke erhebe sich der Triumphbogen.“ In die gleiche Richtung zielt auch der letzte Punkt des Papiers: „Dass eine Kirche in Bezug auf Konstruktion und Form sich über die Profanbauten erheben und monumental durchgeführt werden muss, bedarf eigentlich kaum der Erwähnung.“
Dieses Papier ist in seinem triumphalistischen Zuschnitt und seiner allegorischen Lesart erkennbar ein Rückschritt im Bemühen um den evangelischen Kirchenbau. Evangelisch ist daran wenig und in seiner ostentativen Gestik gegenüber der Profanität und den Laien geradezu unangenehm. Aber es macht die Kirchen zu Leuchttürmen in der Gesellschaft und sorgt in seiner simplen Lesbarkeit für eine gewisse Corporate Identity.
5. 1891 – Berlin (Wiesbadener Programm)
Das Wiesbadener Programm von 1891 umfasst sage und schreibe nur vier Punkte und ist in der Sachaussage das absolute Gegenstück zu den Regeln von 1876. Zum allerersten Mal wird theologisch argumentiert. Erstmals spielt auch das Konfessionelle, das im Kirchenbau zum Ausdruck kommen müsse, eine Rolle: nicht ein Gotteshaus im katholischen Sinne, sondern Versammlungshaus der feiernden Gemeinde solle Kirche sein. In der Raumgestalt müsse das allgemeine Priestertum deutlich werden. Das Abendmahl müsse mitten in der Gemeinde stattfinden. Die Kanzel soll „mindestens als dem Altar gleichwertig“ erscheinen. Interessant ist das Programm auch darin, was es alles nicht festlegt: darin offenbart sich eine Abkehr von der hierarchischen Fixierung und eine Öffnung zur evangelischen Freiheit. Die Verfasser dieses inoffiziellen Programms, der Pfarrer Emil Veesenmeyer und der Architekt Johannes Otzen, treibt offenkundig die Frage um, was eigentlich evangelisch am Kirchenbau ist und wie das Evangelische bauästhetisch eine Gestalt finden kann. Erst 40 Jahre später wird die evangelische Besinnung auf den Kirchenbau auf gleicher Höhe argumentieren. Nach den Ideen des Wiesbadener Programms wird dann die Wiesbadener Ringkirche gebaut. In der Folge stritten die Anhänger des Eisenacher Regulativs und des Wiesbadener Programms auf mehreren Kirchbautagen heftig miteinander.

6. 1898 – Eisenach (Rathschläge der XXIII. Deutschen evangelischen Kirchen-Konferenz)
Gegenüber dem Wiesbadener Programm sind die Eisenacher Rathschläge von 1898, die eigentlich nur eine geringfügige Überarbeitung des Eisenacher Regulativs darstellen, ein extremer Rückfall. Als habe es zwischenzeitlich überhaupt keine anderen Überlegungen gegeben, wird an den triumphalistischen und obrigkeitsstaatlichen Bestimmungen der alten Papiere angeknüpft bzw. werden diese einfach fortgeschrieben.
 Wieder bestimmen Begriffe wie „Würde“ und „Sitte“ den sprachlichen Stil. Ein „einheitlicher, ansehnlicher Raum“ müsse geschaffen werden. Exemplarisch ist ein Satz wie der folgende: „Die Würde des evangelischen Kirchengebäudes verlangt ernste und edle Einfachheit in Gestalt und Farbe, welche am Sichersten durch Anschluss an die älteren, geschichtlich entwickelten und vorzugsweise im Dienst der Kirche verwendeten Baustile erreicht wird.“ Damit ist die bauästhetische Ideologie in nuce entwickelt: Abgrenzung vom Profanbau, Orientierung an den historischen Kirchenbauten, würdig, einfach und ernst. Negativ findet die Fachwerkkirche Erwähnung. Der Altarraum ist erhoben, aber nicht durch Schranken vom Kirchenschiff abgetrennt. Der Altar soll massiv sein. Hinsichtlich des Crucifixes und des Altarbildes schließen sich die Rathschläge den Vorgängern an. Der Kanzelaltar wird wieder ausgeschlossen. Die Rathschläge legen noch vieles fest, unter anderen – gerade im Blick auf heutige Diskussionen nicht uninteressant – Folgendes: „Weitere Nebenräume, insbesondere die bauliche Verbindung der Kirche mit Pfarrhaus, Küsterwohnung und Gemeindehaus sind auszuschliessen.“(!) Wieder bestimmen Begriffe wie „Würde“ und „Sitte“ den sprachlichen Stil. Ein „einheitlicher, ansehnlicher Raum“ müsse geschaffen werden. Exemplarisch ist ein Satz wie der folgende: „Die Würde des evangelischen Kirchengebäudes verlangt ernste und edle Einfachheit in Gestalt und Farbe, welche am Sichersten durch Anschluss an die älteren, geschichtlich entwickelten und vorzugsweise im Dienst der Kirche verwendeten Baustile erreicht wird.“ Damit ist die bauästhetische Ideologie in nuce entwickelt: Abgrenzung vom Profanbau, Orientierung an den historischen Kirchenbauten, würdig, einfach und ernst. Negativ findet die Fachwerkkirche Erwähnung. Der Altarraum ist erhoben, aber nicht durch Schranken vom Kirchenschiff abgetrennt. Der Altar soll massiv sein. Hinsichtlich des Crucifixes und des Altarbildes schließen sich die Rathschläge den Vorgängern an. Der Kanzelaltar wird wieder ausgeschlossen. Die Rathschläge legen noch vieles fest, unter anderen – gerade im Blick auf heutige Diskussionen nicht uninteressant – Folgendes: „Weitere Nebenräume, insbesondere die bauliche Verbindung der Kirche mit Pfarrhaus, Küsterwohnung und Gemeindehaus sind auszuschliessen.“(!)
Abgeschlossen werden die Rathschläge mit Hinweisen zur künstlerischen Ausstattung, die künftig mehr zu fördern sei, wobei freilich Bauherrn und Baumeister gleich vor „der hier drohenden Gefahr der Geschmacksverirrung“ gewarnt werden.
7. 1908 – Eisenach (Leitsätze der XXIX. Deutschen Evangelischen Kirchen-Konferenz)
Mit den Eisenacher Leitsätzen von 1908 wird zum ersten Mal die Industrialisierung und Urbanisierung Deutschlands spürbar: „Namentlich ist darauf zu sehen, daß der Gottesdienst durch die Nachbarschaft nicht Belästigungen durch aussergewöhnlich geräuschvolle Gewerbebetriebe ausgesetzt ist.“ Hier befindet sich die Kirche erstmalig auf dem Rückzug. Auch hier spielt die Berufung auf die alte Sitte noch eine Rolle. Bezüglich des Altarraumes sollte dieser leicht erhöht und geräumig sein. Auf den Altar gehören wieder Kruzifix und evtl. ein Bild mit den Haupttatsachen des Heils.
Eine Veränderung gibt es nun hinsichtlich von Pfarrhaus, Küsterwohnung und Gemeindehaus. Deren Anschluss ist nun plötzlich nicht mehr zu beanstanden. Schon in der vorherige Bauordnung war auf die Heizbarkeit Wert gelegt worden. Das findet nun seine Fortsetzung. Heizung soll sein, aber ohne Einbuße an der „kirchlichen Würde des Bauwerks“. Der 17. und damit letzte Punkt widmet sich wieder den Künsten. Angemessen sollte die Ausgestaltung sein und nicht zu katholisch. Möglichst nur biblische Geschichten und diese systematisch. Erstmalig auch der Hinweis auf die erforderlichen Finanzmittel für hoch qualitative Werke der Kunst.
8. 1928 – Magdeburg (Leitsätze des dritten Kirchenbaukongresses)
 Ziemlich steil steigen die Leitsätze von 1928 ein: „Der evangelische Kultraum ist nicht schlechthin 'Predigtkirche', sondern Stätte einer Selbstkundgebung Gottes und des Verkehrs mit ihm und daher als Ganzes sakraler Raum“. Das dürfte wohl kaum einer theologischen Prüfung standhalten. Auch die auf das Luthertum zielende Hervorhebung des Altars als Gnadenmitelstätte (der „symbolischen Repräsentanz des in Christi Todesopfer gegebenen objektiven Heiles“ unter Abwertung der Kanzel („da die Predigt nur eine ... Darbietungsform von Gotteswort ist“) wirkt sehr steil aufgesetzt. Den Taufstein situiert das Papier im Altarraum als Stätte des Sakramentes. Trotz allem wird in einer beiläufigen Bemerkung die notwendige 'innige' Verbindung von Gemeinderaum und Altarraum betont. Ziemlich steil steigen die Leitsätze von 1928 ein: „Der evangelische Kultraum ist nicht schlechthin 'Predigtkirche', sondern Stätte einer Selbstkundgebung Gottes und des Verkehrs mit ihm und daher als Ganzes sakraler Raum“. Das dürfte wohl kaum einer theologischen Prüfung standhalten. Auch die auf das Luthertum zielende Hervorhebung des Altars als Gnadenmitelstätte (der „symbolischen Repräsentanz des in Christi Todesopfer gegebenen objektiven Heiles“ unter Abwertung der Kanzel („da die Predigt nur eine ... Darbietungsform von Gotteswort ist“) wirkt sehr steil aufgesetzt. Den Taufstein situiert das Papier im Altarraum als Stätte des Sakramentes. Trotz allem wird in einer beiläufigen Bemerkung die notwendige 'innige' Verbindung von Gemeinderaum und Altarraum betont.
Das Ganze geschieht in einer Zeit intensiver neuer kirchlicher Bautätigkeit, die neue Formen und Elemente erprobt (wie z.B. an der Berliner Kirche am Hohenzollernplatz erkennbar wird). Davon ist in den Leitsätzen wenig zu spüren.
9. 1931 - Dresden (Richtlinien für evangelische Gestaltung (Kunst-Dienst)
Die wieder etwas umfassenderen Richtlinien von 1931 sind klar in Struktur, Ausrichtung und Begründung. Zugleich wenden sie sich polemisch gegen unnützen Prunk und Monumentalbauten, allgemein: gegen Ostentation. Zum ersten Mal wird hier aber auch deutlich, dass man gegen die Architektur des globalisierten Kapitalismus nicht antreten kann. Daher heißt es konsequent, es sei „eine Verkennung der religiösen Aufgabe, den Kirchbau in einen Wettstreit mit den profanen Monumentalbauten der Großstädte treten lassen.“ Konsequent wird alles der Prüfung unterzogen, was sich nicht an die Voraussetzungen „Einfachheit, Wahrheit und Bescheidenheit“ hält. Alles andere sei „Selbstbetrug im Hinblick auf die ernste, religiöse Situation.“
Es ist ein fast expressionistischer Gestus, der die Richtlinien durchzieht. Erstmalig wird hier in einem geradezu ästhetisch-philosophischen Sinne vom „Raum“ als zentraler Kategorie gesprochen, eine Erkenntnis, die bis heute kaum im kirchlichen Bewusstsein angekommen ist. Kirchbau, das hämmern die Richtlinien von 1931 ein, muss sich von Innen nach Außen entwickeln. Daher sind z.B. Kirchtürme als Element reiner Äußerlichkeit überflüssig und seien nur Ausdruck eines „dekorativen Motivs“.
Gleichzeitig sind diese Richtlinien die ersten, die von einem bewusst reflektierten Bauwillen sprechen und die weiten Teilen der zeitgenössischen kirchlichen Baukultur vorwerfen, bloß einen „unheilvollen Kompromiss von oberflächlichem Modernismus und historischen Erinnerungen“ zu pflegen. So werde das Material des Betons allzu oft hinter Klinkerverblendungen versteckt.
Auch im Blick auf das kontroverse Thema von Kanzel und Altar findet man hier zu ersten Mal eine ausgereifte Stellungnahme, die nicht einfach das eine oder andere dekretiert, sondern deren Verhältnis als Ausdruck der protestantischen Situation der Gegenwart einsichtig zu machen versucht. Dieses „aufgeklärte“ Denken wird auch im Blick auf das Verhältnis von Pfarrer und Gemeinde in Anschlag gebracht. Einen Satz wie den Folgenden wünschte man sich dringlichst auch in der aktuellen Kirchbaudiskussion: Es könne nicht sein, „Kanzel und Altar der Gemeinde mit Hilfe von Form- und Lichtzauber gleichsam als Götzenbild gegenüberzustellen“. Man wird gerade im evangelischen Bereich einräumen müssen, dass die jüngsten Kirchbauten diesen Erkenntnisstand zugunsten der Wiederverzauberung des Kirchbaus vernachlässigt haben. Hier wäre eine Re-Lektüre des Dresdner Papiers dringend angesagt.
Eine ähnlich aufklärerische Haltung (im Sinne des Enlightment“) findet sich dann auch zum Thema „Licht“, das im Papier einen eigenen Abschnitt hat (länger als der zum Taufstein oder der zur Orgel). Gegen die „nicht ungefährliche Romantik der Orientierung an der mittelalterlichen Glasmalerei und am „mystischen Halbdunkel“ setzt das Papier auf Klarheit und Helle. Die gleiche Radikalität beim Thema der Orgel. Hier könne man versuchen, künftig auf Orgelprospekte zu verzichten, was neben der Kostenersparnis auch zu mehr Klarheit führen würde.
Hochinteressant schließlich die abschließenden Bestimmungen zur Bildenden Kunst. Man beschreibt zunächst die jüngere Zurückhaltung beim Einsatz bildender Künstler im Kirchenbau, warnt vor vorschneller erneuter Einbeziehung der Künstler (vor allem religiöser Maler oder expressionistischer Christusdarstellungen!). Man müsse es der Zukunft und der Entwicklung von Kunst und Architektur überlassen, wie eine Zusammenarbeit von Kunst und Kirchenbau denkbar sei. Erkennbar ist hier, dass das Papier an diesem Punkt eher aus der Sicht von Architekten und Theologen, als aus der Sicht avancierter Kunst argumentiert. Die dezidierte Abwendung von religiös verbrämter Malerei und Gestaltung ist allerdings programmatisch sinnvoll.
10. 1951 – Rummelsberg (Grundsätze für die Gestaltung des gottesdienstlichen Raumes der evangelischen Kirchen)
Die Rummelsberger Grundsätze von 1951 sind die letzten, die Gerhard Langmaack in seinem Buch „Evangelischer Kirchenbau im 19. und 20. Jahrhundert“ dokumentiert hat. Sie sind die bis dahin umfassendsten Bestimmungen zum Thema, greifen zum ersten Mal systematisch die Differenz von lutherischem und reformiertem Kirchbau auf und sind wiederum dezidiert theologisch gehalten. Zugleich finden sich hier zum ersten Male selbstreflexive Sätze, insofern explizit auf die Begrenztheit der bisherigen Kirchbauprogramme eingegangen wird ( z.B. „die Verirrung der neugotischen Kirchbauten“ in Folge des Eisenacher Regulativs). Daher werden die Rummelsberger Grundsätze ausdrücklich als Rahmensetzungen und nicht als Gesetz vorgestellt. In Folge des II. Weltkrieges sieht sich die evangelische Bautätigkeit vor Herausforderungen, wie sie es in der 400-jährigen Geschichte bisher nicht gegeben habe. Von daher stelle sich ganz grundsätzlich die Frage nach dem „Wesen des Kirchbaues“. Dieses wird dann im Abschnitt B „Allgemeines zum gottesdienstlichen Bau und Raum“ angegangen.
An dieser Stelle zeigt sich freilich auch der Preis der Re-Theologisierung des Kirchbaus, sind doch die historisch-theologischen Bestimmungen derart divergent, dass sie nicht mehr in einen Rahmen gebracht werden können – diese Erkenntnis kommt dann aber erst 40 Jahre später in den 'postmodernen' Wolfenbütteler Empfehlungen zur Geltung. Die Rummelsberger Grundsätze möchten sowohl an Luthers Erkenntnis festhalten, dass man Gottesdienst überall feiern kann, als auch, die kirchlichen Räume so gestalten, dass sie klar von der Profanität abgegrenzt sind, ja sie sollen „gleichnishaft Zeugnis von dem geben, was sich in und unter der gottesdienstlich versammelten Gemeinde begibt: nämlich die Begegnung mit dem gnadenhaft in Wort und Sakrament gegenwärtigen heiligen Gott.“ Deshalb schließe sich z.B. die Verwendung eines Gemeindesaales als Kirchenraum“ als Regelfall aus, sie sei allenfalls als „Notmaßnahme zulässig. Man spürt instinktiv den Widerspruch zwischen der einen und der anderen Bestimmung. Letztlich besagen die Darlegungen ja nur, dass Gottesdienst überall gefeiert werden kann – aber nur im Notfall. Damit wird der Gottesdienst außerhalb des besonderen Raumes der Kirche theologisch abgewertet. Das dürfte so nicht haltbar sein. Der protestantische Weg der Heiligung der Welt, der wenige Jahre später so bedeutsam werden sollte („Kirchen in nachsakraler Zeit“), wird hier versperrt.
Die verbleibenden beiden Abschnitte wenden sich nun den „wesentlichen Bestandteilen des gottesdienstlichen Raumes nach lutherischem Verständnis“ (Abschnitt C) und dem „besonderen Anliegen der reformierten Kirche“ (Abschnitt D) zu. Das ist sicher dem Erstarken reformierter Theologie nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus zu verdanken. Trotzdem bleibt es bemerkenswert, wie in der sprachlichen Form bereits Wertungen einfließen, wenn etwa das lutherische Verständnis als Norm und das reformierte als „besonderes“ Anliegen charakterisiert wird.
Bezüglich des lutherischen Verständnisses wird nun die Kanzel so beschrieben, dass sie gut sichtbar sein soll. Der Altar darf nicht beweglich sein und soll in Form, Masse und Werkstoff seiner sakramentalen Bedeutung gerecht werden. Entgegen der einleitend geäußerten Intention wird das Papier an dieser Stelle sehr normativ, etwa wenn für den Altar festgelegt wird, dass dessen Platte (MENSA) aus einem Stück Naturstein bestehen müsse. „Die Verwendung von Kunststoff, wie z.B. Betonplatten, Eternit, Faserplatten oder Sperrholz, ist abzulehnen.“ Stahl als Konstruktionsmaterial kommt trotz aller fortschreitenden Industrialisierung nicht vor. Kanzel und Altar sollen gleichwertig zugeordnet werden, ohne dass man den genaueren Ort der Kanzel festlegen will. Nur der Kanzelaltar und die Platzierung der Kanzel an der Seitenwand im Mittelschiff werden abgelehnt. Produktiv aber ist der Hinweis, dass Altar und Kanzel als „Brennpunkte des Raumes in Erscheinung treten“ sollten. Hier hätte man (auch liturgisch) mutiger weiterdenken können und sollen.
Der folgende Satz ist für mich als Theologen in reformierter Tradition in seiner Ambivalenz schwer nachvollziehbar und kaum einsichtig: „Lutherische Gemeinden werden in der Darstellung des gekreuzigten und auferstandenen Christus im Kirchenraum einen Hinweis auf die Gegenwart des Herrn bei seiner Gemeinde sehen wollen und darum schwerlich auf eine solche Darstellung verzichten.“ Nahezu jedes Wort ist mir hier fraglich. Reichen denn die Sakramente nicht aus, um sich der Gegenwart des Herrn zu vergewissern? Hier kommen dingmagische Vorstellungen zum Tragen, die kaum erklärbar sind und mit der Erklärung von Dresden 1931 auch überwunden sein sollten. Erstmalig tauchen auch Blumen als Gestaltungselemente des Gottesdienstes in einem Kirchbauprogramm auf. Ein klarer Rückschritt ist auch folgende Bestimmung: „Auch Paramente Bildwerke, Glasfenster und Wandteppiche vermögen bei rechter Gestaltung der Verkündigung zu dienen.“ Diese Haltung zur Kunst als dienender Magd hatte die säkulare Welt zu diesem Zeitpunkt bereits 200 Jahre überwunden.
Subjektiv grotesk finde ich die Formulierung, dass die Orgel „im lutherischen Gottesdienst eine dem Altardienst korrespondierende Funktion“ habe. Wie immer man das Wort „korrespondierend" auslegt, es kommt eine biblisch-theologisch kaum begründete Aufwertung der Orgel dabei heraus. Hier kommt jene innerkirchliche Ideologie zur Geltung, die dann auch zu Bachkonzerten in der Kirche die Glocken läutet. Ganz im Sinne der Hervorhebung der Orgel wird nun auch wieder die Notwendigkeit von Orgelprospekten betont.
Die Ausführungen zum „besonderen Anliegen der reformierten Kirche“ kann ich nur mit distanzierter Ironie lesen. „Der Cruzifixus und andere plastische oder gemalte Darstellungen, die die Wahrheit des Evangeliums sinnenfällig zu bezeugen suchen, sind nach dem zweiten Gebot (in der Zählung des Heidelberger Katechismus) im gottesdienstlichen Raum nicht erlaubt.“ Ehrlicherweise hätte man präzise sagen müssen, es sind Götzenbilder. Aber immerhin wird nicht mehr kirchenamtlich behauptet, Cruzifixe seien reformierterseits erlaubt und wünschenswert. Der Abendmahlstisch soll bei den Reformierten zwei Stufen höher als die Gemeinde platziert werden, auf ihn gehöre nichts außer einer „genügend großen Bibel“ - bei Lutheranern darf sie offensichtlich kleiner sein.
Das war der klassische Kanon evangelischer Kirchbauprogramme der Moderne. Alle folgenden Papiere entstehen unter der condition postmoderne, wie Horst Schwebel es in seinem seinerzeitigen Beitrag zu den Wolfenbütteler Empfehlungen geschrieben hat, den wir in diesem Heft von Tà katoptrizómena dokumentieren.
11. 1991 – Wolfenbüttel (Wolfenbütteler Empfehlungen: Der evangelische Kirchenraum)
Die im Anschluss an den Wolfenbütteler Kirchbautag von 1989 erarbeiteten Empfehlungen sind fast so umfangreich wie die Rummelsberger Grundsätze. In ihnen tritt zum ersten Mal ein resignativer Ton auf: „Heute besteht nur in besonderen Fällen Bedarf nach einem Kirchenneubau“. Gleichzeitig ist die Phase der Gemeindezentren schon wieder abgeschlossen, ohne dass es dazu ein Kirchenbauprogramm gegeben hätte. Nun geht es vorrangig um Nutzungsänderungen und Umbauten. Grundsätzlich wird der Gottesdienstraum in seinen basalen Funktionen benannt, ohne neue Perspektiven zu erschließen oder alte zu verbauen. Außerordentlicher Wert wird auf die Heranziehung von Fachleuten gelegt – viel stärker als dies in früheren Entschließungen getan wurde. Der Punkt „Umgang mit vorhandenen Räumen“ zeigt deutlich die Kehrtwende. Möglichst reversible Lösungen unter Einbezug der Gemeinderäume in den Gottesdienstraum werden im Falle notwendiger Umbauten empfohlen. Der Altar soll nun „möglichst inmitten der Versammlung der Gemeinde stehen und kann transportabel sein.“ Der Zugang alter und behinderter Menschen zum Abendmahlstisch (sic!) muss gewährleistet sein. Ein eigener Punkt widmet sich der Denkmalpflege, die besonders hervorgehoben wird, auch wenn der Abschnitt damit endet, „dass bei Entscheidungen über Denkmäler, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken dienen, die kirchlichen Belange im Vordergrund stehen.“ Für den Kirchenneubau werden so allgemeine Bestimmungen festgelegt, dass sie für alles oder nichts zutreffen. Als Reaktion auf das Scheitern mancher Aspekte der Gemeindezentren findet sich der Satz: „Dem Wunsch der Gemeinden nach einem vor allem gottesdienstlich genutzten Raum sollte künftig entsprochen werden.“ Der letzte Abschnitt befasst sich dann mit der zeitgenössischen Kunst und fordert hohe künstlerische Qualität und allgemein eine Zuwendung der Gemeinden zur Gegenwartskunst.
Damit ist das Kapitel der klassischen Kirchbauprogramme abgeschlossen. Allgemeiner, als es in den Wolfenbütteler Empfehlungen geschehen ist, kann man kaum noch formulieren. Nun ist das Feld des „Anything goes“ eröffnet. In Anerkenntnis des eingetretenen Pluralismus verzichtet der Kirchbautag auf eine Programmatik. Zugleich wird im Duktus des Papiers bereits etwas von der Larmoyanz der folgenden Verlautbarungen spürbar.
12. 1996 – Magdeburg (Magdeburger Manifest: Rettet die Kirchengebäude in unserem Lande)
Sechs Jahre nach der Wiedervereinigung wird deutlich, dass die Kirche die Lasten der Bauerhaltung langfristig nicht tragen kann. Was Experten schon lange vorher klar war, wird nun offen diskutiert, ohne jedoch die rechten Konsequenzen daraus zu ziehen. Das Magdeburger Manifest möchte die öffentliche Hand in die Pflicht nehmen und wendet sich appellativ an Bundestag, Bundesregierung und Bundesländer, einen Teil der Lasten mit zutragen. „Für die Erhaltung sind alle gesellschaftlichen Gruppen verantwortlich ... Wir fordern ein eigenes staatliches Förderprogramm Kirchenbau.“ Im Papier selbst kein Ton davon, dass es auch andere Lösungen als den Erhalt der Kirchenbauten gibt. Statt dessen versichert man sich: „Kirchengebäude sind ein großes Potential für den christlichen Glauben. Sie wollen (sic!) von mehr Menschen als bisher zu einer neuen Identifikation und zu geistlicher Motivation genutzt werden.“
13. 2002 – Leipzig (Leipziger Erklärung: Nehmt Eure Kirchen wahr!)
Konnte man dem Magdeburger Manifest noch etwas Chuzpe im Einfordern öffentlicher Gelder zugestehen, so werden die folgenden Texte immer rührseliger und zugleich noch subjektloser. Es ist wie das Pfeifen im Wald, wenn es in der Leipziger Erklärung heißt: „Wir empfehlen, selbstbewusst und mutig die Chancen unserer sakralen Räume zu nutzen, mit diesem Pfund zu wuchern und die uns überkommenen Gebäude verlässlich zu erhalten“. Bemerkenswert die Rückkehr zur Formulierung „sakrale Räume“, welche spätestens seit Mitte der 60er-Jahre (aber eigentlich seit Luther) überwunden sein sollte. Andere Formulierungen sind sogar weitaus fragwürdiger, wenn etwa fahrlässig die Differenz von Kirche als ecclesia und Kirche als Gebäude sprachlich nivelliert wird: „Wir wissen, dass unsere Kirchengebäude hilfreiche Zeichen des Anderen in einer diesseitigen Welt und Wegweiser für Sinn in einer fragenden Welt sind.“ Meint man das ernsthaft: Kirchengebäude als Wegweiser für Sinn in einer fragenden Welt? Das sind Sätze aus dem hohlen Bauch, aus purer Verzweiflung geboren und von protestantischer Theologie wohl kaum gedeckt. Wie steht es da mit der protestantischen Heiligung der Welt? Aber es kommt noch dicker: Kirchengebäude seien „’Seelen und Gedächtnis’ der Dörfer und Städte sowie des Gemeinwesens, worin wir wurzeln.“ Diese schwurbelige Sprache ist kaum erträglich.
Das Leipziger Papier bestimmt dann Kirchen zunächst als Versammlungsorte, nicht ohne einen kleinen Schlenker ins Metaphorische: „Mit ihren Glocken sagen sie eine andere Zeit an.“ Ich hoffe doch, das geschieht durch Gottesdienst und Predigt! Erschreckend dann die Rückkehr wider besseren Wissens zur Formulierung der „heiligen Räume“: „Durch das, was in ihnen geschieht … werden sie erst zu ‚heiligen’ Räumen.“
Dann werden die Kirchen in katholischer Terminologie als „Schatzkammern des christlichen Glaubens“ bezeichnet. Hier bekommt das Papier im Sprachduktus einen unmittelbaren Traktatcharakter: „Ihre Mauern und Steine predigen, mit ihren Räumen sind sie ein Asyl für die letzten Dinge, ihre Altäre stiften Gemeinschaft, mit ihren Orgeln und Glocken loben sie Gott, mit ihren Kunstwerken legen sie Zeugnis ab und erzählen die Geschichte unserer Kultur, mit ihren Kerzen erinnern und mahnen sie, mit ihrem Schmuck danken sie für alle guten Gaben des Schöpfers. Lassen Sie uns unsere größten Schätze treu bewahren, sie bewusst wahrnehmen und ihre Botschaft vermitteln.“ Bei der Lektüre solcher Sätze schäme ich mich, evangelisch zu sein.
Nein, Mauern und Steine predigen nicht!
Nein, die Räume sind kein Asyl für die letzten Dinge!
Nein, nicht Altäre, sondern das gemeindliche Geschehen um sie herum stiften Gemeinschaft!
Nein, Kunstwerke legen kein Zeugnis ab!
Nein, Kerzen ermahnen und erinnern uns nicht! Und – hier stockt einem wirklich der Atem –
nein, mit Schmuck dankt man nicht für alle guten Gaben des Schöpfers.
Und was sind eigentlich diese größten Schätze, die wir treu bewahren und deren Botschaft wir vermitteln sollen: unsere Kirchengebäude mit ihren Mauern, Räumen, Altären, Kunstwerken, Kerzen und ihrem Schmuck? Nein, nein, nein! Warum gab es eigentlich eine Reformation, wenn sich knapp 500 Jahre später niemand mehr daran hält? Man merkt diesem Papier an, dass Rainer Volp an ihm nicht mehr mitgewirkt hat, er hätte so etwas nicht zugelassen. Es wird Zeit, dass wieder vernünftige Theologen beim Kirchbautag mitwirken.
Als dritten Punkt benennt das Papier die Kirchen als Kraftorte: „Sie bauen an unserer Innerlichkeit. Sie erbauen uns, sie reden mit uns, sie heilen uns.“ Ja geht’s noch? Das Kirchengebäude baut an meiner Innerlichkeit? Das verbitte ich mir aber. Das Kirchengebäude redet mit mir? Es heilt mich? Wem fällt so ein Schwachsinn ein? Warum überlassen wir die evangelische Kirche dann nicht gleich Reinhard Bonnke oder einem Schamanen? Mir treibt so etwas den Blutzucker hoch.
Erst der vierte Punkt benennt Kirchen als gestaltete Räume – bemerkenswert bei einer Verlautbarung des Kirchbautages. Und auch hier finden sich extrem konservative Bestimmungen: „Der Erhalt der ursprünglichen, von der Liturgie bestimmten Gestaltungsintention bewahrt dem Gebäude seine Sprachgestalt.“ Blubb, Blubb. Da möchte man doch mit Horst Schwebel von der „Diktatur der Liturgie“ sprechen und sich seiner schon 1968 geäußerten These anschließen: „der Kirchenbau darf sich nicht länger in den Dienst der Liturgie stellen; vielmehr sollten umgekehrt die Anregungen schöpferischer Architektur liturgisch nutzbar gemacht werden.“
Der fünfte und letzte Punkt beschreibt Kirchen als Freiräume, nicht ohne – ganz erschrocken vom eigenen Wagemut – hinzuzufügen, „dass nicht jedes Experiment nützt und es zum Schaden aller gereicht, wenn unsere Räume Gegenstand einseitiger Schlagzeilen werden.“ Ganz ernst war es mit der Öffnung eh’ nicht gemeint, wenn man dazu auffordert, „das Gespräch aus evangelischer Perspektive(!) mit Künstlerinnen und Künstlern zu suchen“. Ich hatte auf ein offenes Gespräch gehofft.
In der Geschichte der evangelischen Äußerungen zum Kirchenbau ist dieses Papier sicher ein absoluter Tiefpunkt. Es ist so reflexionslos wie besinnungslos, es ist das rasende Gefasel der Gegenaufklärung. Letztlich sucht eine bestimmte theologische Schule und eine bestimmte kirchliche Richtung alle anderen mit blumigen Worten zu ersticken. Es wird wohl einem Vorsitzenden geschuldet sein, der meint „ein Schuss Katholizität tut uns Protestanten gut.“ Dass sich der Evangelische Kirchbautag darauf eingelassen hat, ist ein interessantes Symptom seiner Geistesverfassung. Andererseits können die Teilnehmer der Tagung, die ich dazu befragt habe, sich auch gar nicht daran erinnern, dass das Papier diskutiert und verabschiedet wurde, so dass es sein könnte, dass es sich nur um eine Verlautbarung des Arbeitsausschusses des Kirchbautages handelt. Dann wäre zu fragen, wie es dazu kommt, dass in der Öffentlichkeit die Verlautbarung als eine des Kirchbautages ausgegeben wird. Einen einzigen Satz dieses Papier kann ich vorbehaltlos unterschreiben. Er lautet: „Es ist höchste Zeit für den Aufbruch.“ Alles Andere gehört auf den Müll der Geschichte.
14. 2004 – Leipzig (EKD-Synode: Der Seele Raum geben)
 Erstmalig hat sich 2004 die Synode der EKD mit dem Thema des Kirchenbaus beschäftigt und dabei die Leipziger Erklärung des Vorjahres aufgegriffen und zugleich in ihren schlimmsten Auswüchsen abgemildert. Zum kirchbauprogrammatischen Kern spricht die Synode den lapidaren Satz: „Kirchen dienen der christlichen Gemeinde zum Gottesdienst.“ So ist es und damit hätte man es bewenden lassen können. Nun aber setzt der größere Teil der Erklärung ein, denn Kirchen „sind mehr: Sie haben eine Ausstrahlungskraft weit über die Gemeinden hinaus, denen sie gehören.“ Was darunter zu verstehen ist, erläutert die Kundgebung so: „Wer eine Kirche aufsucht, betritt einen Raum, der für eine andere Welt steht. Ob man das Heilige sucht, ob man Segen und Gottesnähe sucht oder schlicht Ruhe, ob ästhetische Motive im Vordergrund stehen - immer spricht der Raum: Durch seine Architektur, seine Geschichte, seine Kunst, seine Liturgie. Kirchen sind Orte, die Sinn eröffnen und zum Leben helfen können, Orte der Gastfreundschaft und Zuflucht. Sie sind Räume, die Glauben symbolisieren, Erinnerungen wach halten, Zukunft denkbar werden lassen, Beziehungen ermöglichen: zu sich selbst, zur Welt, zu Gott.“ Das ist der Gemischtwarenladen für jedermann, garniert mit der Subjektivierung der Dinge: der Raum spricht, er symbolisiert, er hält wach, er ermöglicht Beziehungen. Auch hier gilt: das ist haarscharf an der Wahrheit vorbei. Nicht der Raum an sich spricht, sondern er kann ansprechend wirken, wenn ich ihn unter bestimmten kulturellen Codes betrachte. Nicht der Raum an sich symbolisiert, aber im Kontext eines menschlichen Symbolsystems kann ich den Raum entsprechend einordnen. Nicht der Raum ermöglicht Beziehungen, sondern dieser Raum kann genutzt werden, um Beziehungsgeschehen in Gang zu setzen oder zu erhalten. Als nächstes beschreibt die Kundgebung verschiedene Nutzungsformen von Kirchengebäuden. Aber es schränkt ein: „Kirche muss freilich immer als Gottesdienstraum erkennbar bleiben.“ Eine Begründung wird dafür nicht geliefert – anders als bei den Wolfenbütteler Empfehlungen, die auf die Wünsche der Gemeinden verwiesen hatte. Zurückfragen müsste man dann jedoch: woran erkennt man denn einen Gottesdienstraum im reformatorischem Verständnis? Die umstandslose Rede von Sakralgebäuden – so sie denn nicht als architekturtheoretischer Topos Verwendung findet – sollte jedenfalls stutzig machen. Klar benennt die EKD auch die Möglichkeit, eine Kirche aufzugeben: „In diesem Fall soll darauf geachtet werden, dass die neue Nutzung zu der Würde, die ein Gotteshaus einmal gehabt hat und für viele Menschen behält, nicht in krassen Gegensatz gerät.“ Muss ich es an dieser Stelle noch wiederholen? Ein Gotteshaus hat keine Würde! Als Würde bezeichnen wir im Deutschen einen Wert, der die Qualität des Handelns und Seins eines Menschen (sic!) bezeichnet. Wenn wir mit einem Kirchenraum würdelos umgehen, dann beschädigen wir nicht die Würde des Raumes, sondern unsere eigene. Erstmalig hat sich 2004 die Synode der EKD mit dem Thema des Kirchenbaus beschäftigt und dabei die Leipziger Erklärung des Vorjahres aufgegriffen und zugleich in ihren schlimmsten Auswüchsen abgemildert. Zum kirchbauprogrammatischen Kern spricht die Synode den lapidaren Satz: „Kirchen dienen der christlichen Gemeinde zum Gottesdienst.“ So ist es und damit hätte man es bewenden lassen können. Nun aber setzt der größere Teil der Erklärung ein, denn Kirchen „sind mehr: Sie haben eine Ausstrahlungskraft weit über die Gemeinden hinaus, denen sie gehören.“ Was darunter zu verstehen ist, erläutert die Kundgebung so: „Wer eine Kirche aufsucht, betritt einen Raum, der für eine andere Welt steht. Ob man das Heilige sucht, ob man Segen und Gottesnähe sucht oder schlicht Ruhe, ob ästhetische Motive im Vordergrund stehen - immer spricht der Raum: Durch seine Architektur, seine Geschichte, seine Kunst, seine Liturgie. Kirchen sind Orte, die Sinn eröffnen und zum Leben helfen können, Orte der Gastfreundschaft und Zuflucht. Sie sind Räume, die Glauben symbolisieren, Erinnerungen wach halten, Zukunft denkbar werden lassen, Beziehungen ermöglichen: zu sich selbst, zur Welt, zu Gott.“ Das ist der Gemischtwarenladen für jedermann, garniert mit der Subjektivierung der Dinge: der Raum spricht, er symbolisiert, er hält wach, er ermöglicht Beziehungen. Auch hier gilt: das ist haarscharf an der Wahrheit vorbei. Nicht der Raum an sich spricht, sondern er kann ansprechend wirken, wenn ich ihn unter bestimmten kulturellen Codes betrachte. Nicht der Raum an sich symbolisiert, aber im Kontext eines menschlichen Symbolsystems kann ich den Raum entsprechend einordnen. Nicht der Raum ermöglicht Beziehungen, sondern dieser Raum kann genutzt werden, um Beziehungsgeschehen in Gang zu setzen oder zu erhalten. Als nächstes beschreibt die Kundgebung verschiedene Nutzungsformen von Kirchengebäuden. Aber es schränkt ein: „Kirche muss freilich immer als Gottesdienstraum erkennbar bleiben.“ Eine Begründung wird dafür nicht geliefert – anders als bei den Wolfenbütteler Empfehlungen, die auf die Wünsche der Gemeinden verwiesen hatte. Zurückfragen müsste man dann jedoch: woran erkennt man denn einen Gottesdienstraum im reformatorischem Verständnis? Die umstandslose Rede von Sakralgebäuden – so sie denn nicht als architekturtheoretischer Topos Verwendung findet – sollte jedenfalls stutzig machen. Klar benennt die EKD auch die Möglichkeit, eine Kirche aufzugeben: „In diesem Fall soll darauf geachtet werden, dass die neue Nutzung zu der Würde, die ein Gotteshaus einmal gehabt hat und für viele Menschen behält, nicht in krassen Gegensatz gerät.“ Muss ich es an dieser Stelle noch wiederholen? Ein Gotteshaus hat keine Würde! Als Würde bezeichnen wir im Deutschen einen Wert, der die Qualität des Handelns und Seins eines Menschen (sic!) bezeichnet. Wenn wir mit einem Kirchenraum würdelos umgehen, dann beschädigen wir nicht die Würde des Raumes, sondern unsere eigene.
Im Folgenden geht es darum, was in den Kirchenräumen geschehen darf. Musik natürlich und Konzerte. Einschränkung: „Die Veranstaltungen müssen sich jedoch mit dem Charakter eines christlichen Gotteshauses vertragen und zum Dialog mit dem Raum bereit sein.“ Welchen „Charakter“ hat ein „christliches Gotteshaus“? Wenn – was ich einmal unterstelle – unter Charakter nicht Persönlichkeit, sondern Merkmal verstanden wird, müsste es dann nicht heißen: „mit den Charakteren“ eines Kirchenbaus?
Es ist ein Charakteristikum solcher Papiere, das sie etwas Gutes ausdrücken wollen und doch das Falsche sagen. So auch bei folgender Formulierung: „Oft stehen Kirchen mitten im Ort. Dort gehören sie auch hin, weil die christliche Gemeinde in der Mitte der Gesellschaft ihren Ort hat - hellhörig für das, was Menschen bewegt und in ihrer Hörweite, um ihnen das Wort zu sagen, das wie die Kirchtürme auf eine andere Dimension unseres Lebens weist: das Wort Gottes.“ Das bleibt also vom Wort Gottes übrig, dass es „wie die Kirchtürme auf eine andere Dimension unseres Lebens weist“. Merken die Verfasser nicht, wie sie im Bemühen, noch die Kirchtürme theologisch zu retten, das Wort Gottes beschädigen? Muss man an die Äußerungen zum Kirchenbau von 1931 erinnern, dass Kirchtürme als Element reiner Äußerlichkeit überflüssig und nur Ausdruck eines „dekorativen Motivs“ sind?
Der bis dato immer kritisch gebrauchte Hinweis, dass die Menschen in Krisensituationen in die Kirche strömen („Not lehrt beten“), wird nun im Interesse der Bestandserhaltung der Kirchenräume apologetisch gewendet. „In besonderen Stunden haben sich unsere Kirchen immer wieder als Stätten gemeinsamen Empfindens, gemeinsamer Freude und Ermutigung im Leid bewährt.“ Aber verschwiegen wird dabei, dass dies auch anlässlich von Kriegseintritten, Führergeburtstagen, Kulturhauptstadteröffnungen und Fußballweltmeisterschaften geschehen ist, ohne dass die Menschen sich hier explizit unter Gottes Wort gestellt hätten oder es zum Teil sogar missbräuchlich beschworen haben: „Mit Gott und Vaterland“. Und mit der Not selbst ist es so seine Sache: war „die Not vorbei, war auch vorbei das Beten“ sollte man mit Grillparzer wissen. Und darüber hinaus bedarf es auch keiner kulturgeschichtlich oder ästhetisch ausgezeichneten Räume, um in der Not gemeinsam zu beten, es bedarf nicht einmal der Kirchenräume: in der Not tut’s ein Kuhstall oder die Wiese im Freien. Jedenfalls ist die kommunikative Seite des Evangeliums strikt von der Raumgestalt zu trennen, zumindest in dem Sinne, dass erste nicht von letzterer abhängig ist.
15. 2008 - Dortmund (Dortmunder Denkanstöße)
 Von der blumigen Sprache der Leipziger Erklärung von 2002 wechselt der Sprachduktus nun in die passivierte Sprache, welche die die Gemeinde tragenden Subjekte vom aktiven Geschehen ausschließt. Über die Dortmunder Denkanstöße aus dem Jahr 2008 habe ich mich in Tà katoptrizómena bereits ausführlich geäußert. Das braucht an dieser Stelle nicht wiederholt zu werden. Eine inhaltliche Änderung zeichnet sich allenfalls mit der Programmatik der Transformation ab, die aber so unbestimmt bleibt, dass sie wie eine Floskel wirkt. „Architektur ist Transformation“ ist ein ebenso unbestimmter Satz wie „Kunst ist Transzendenz“. Ansonsten diffundiert das Ganze in beredte Sprachlosigkeit. Von der blumigen Sprache der Leipziger Erklärung von 2002 wechselt der Sprachduktus nun in die passivierte Sprache, welche die die Gemeinde tragenden Subjekte vom aktiven Geschehen ausschließt. Über die Dortmunder Denkanstöße aus dem Jahr 2008 habe ich mich in Tà katoptrizómena bereits ausführlich geäußert. Das braucht an dieser Stelle nicht wiederholt zu werden. Eine inhaltliche Änderung zeichnet sich allenfalls mit der Programmatik der Transformation ab, die aber so unbestimmt bleibt, dass sie wie eine Floskel wirkt. „Architektur ist Transformation“ ist ein ebenso unbestimmter Satz wie „Kunst ist Transzendenz“. Ansonsten diffundiert das Ganze in beredte Sprachlosigkeit.
Von dem, was einmal evangelische Kirchbauprogramme – bei aller notwendigen Kritik ihrer konkreten Gestalt – bedeutet haben, ist am Ende nichts mehr übrig geblieben. Das ist die wahre Transformation der Zeit: Sie drückt „zermalmend den unendlichen Tempel zu einer Gottesacker-Kirche zusammen“ (Jean Paul). Und so wird sich das nächste Kirchbaupapier sicher ganz unironisch mit Kolumbarien beschäftigen, denn am Ende bleibt immer: der Tod. Six feet under lässt grüßen.
15. 1968 - Einlösung der vergangenen Hoffnung: Eine Lektüre-Empfehlung
 Auch ich empfehle die Rückbesinnung, wie das anfangs dafür gescholtene Dresdner Papier von 1856, freilich auf eine andere ganz Tradition. Es ist meines Erachtens endlich Ernst zu machen mit dem, was Hans-Eckehard Bahr 1968 in dem von ihm herausgegebenen Buch „Kirchen in nachsakraler Zeit“ gefordert hat: die Prinzipien einer nachsakralen Kirche zu entwerfen. Und überhaupt ist Hans-Eckehard Bahrs einleitender Aufsatz zum seinerzeitigen Buch von einer Aktualität, die einem manchmal den Atem raubt. Wie Peitschenhiebe prasseln seine Sätze auf das geronnene Bewusstsein der Sakralfetischisten, aber er geißelt mit scharfen Worten auch uns als jene, die bloß passiv, bloß „zulassende Akteure“ sind, die wir uns also die vernebelnde Sprache von den Kirchen als Schatzkammern und Kraftorten gefallen lassen. Es ist, als hätte er es für die heutige Zeit geschrieben, als hätte er die ganze Entwicklung vorausgesehen. Aber vielleicht hat sich seit damals auch einfach nur nichts geändert. Auch ich empfehle die Rückbesinnung, wie das anfangs dafür gescholtene Dresdner Papier von 1856, freilich auf eine andere ganz Tradition. Es ist meines Erachtens endlich Ernst zu machen mit dem, was Hans-Eckehard Bahr 1968 in dem von ihm herausgegebenen Buch „Kirchen in nachsakraler Zeit“ gefordert hat: die Prinzipien einer nachsakralen Kirche zu entwerfen. Und überhaupt ist Hans-Eckehard Bahrs einleitender Aufsatz zum seinerzeitigen Buch von einer Aktualität, die einem manchmal den Atem raubt. Wie Peitschenhiebe prasseln seine Sätze auf das geronnene Bewusstsein der Sakralfetischisten, aber er geißelt mit scharfen Worten auch uns als jene, die bloß passiv, bloß „zulassende Akteure“ sind, die wir uns also die vernebelnde Sprache von den Kirchen als Schatzkammern und Kraftorten gefallen lassen. Es ist, als hätte er es für die heutige Zeit geschrieben, als hätte er die ganze Entwicklung vorausgesehen. Aber vielleicht hat sich seit damals auch einfach nur nichts geändert.
|

