
Differenz - Dissidenz |
|
Die Angst der Kirche vor der Gegenwart
ReloadedJörg Mertin
Ich möchte jetzt aufgrund weiterer Erfahrungen und Beobachtungen meine Überschrift und meine These aus dem Jahr 2000 wiederholen, aber auch neu formulieren. Mir scheint es verstärkt so zu sein, dass die (ev.) Kirche und zahlreiche Menschen in ihr vor der Gegenwart Angst haben, dass sie sich als stark verunsichert erleben angesichts der schnellen Veränderungen, die in der Gesellschaft vor sich gehen und Sorge um den Verlust der so genannten kirchlichen Identität haben. Und dies zeigt sich eben vor allem am Umgang mit der zeitgenössischen Kunst. Es ist bemerkenswert, dass Ähnliches auch in der katholischen Kirche beobachtet wird. Ich zitiere eine Meldung der katholischen Nachrichtenagentur über den Abschied von Friedhelm Mennekes von der Kunststation St. Peter in Köln im Juni 2008:
Wenn man von Angst spricht, redet man über die Vorbehalte des kirchlichen Milieus, sich auf zeitgenössische Kunst einzulassen. Praktisch begegnet die Angst öfter als Unverständnis oder sogar Aggression, wenn man durch bestimmte Projekte mit der Kunst ungewollt konfrontiert wird. Nun zeigt ein Blick in die Entwicklung der letzten 30 Jahre allerdings, dass viel geschehen ist. Im erwähnten Artikel über Mennekes heisst es, dass der Gegensatz zwischen moderner Kunst und Kirche nicht mehr wie vor 30 Jahren bestehe. Das mag stimmen. Ende der siebziger Jahre war die Reaktion der Kirchen auf die ersten Interventionen eine Art ungläubiges Staunen, dass zeitgenössische Kunst und Kirche überhaupt etwas miteinander zu tun haben sollten. Ein besonderes Reizwort war damals (und ist im Grunde auch noch heute) der Begriff der Autonomie der Kunst. In einem schlichten theologischen Kurzschluss wurde der Kunst allenfalls Dienstcharakter zuerkannt. Nichts durfte sich in der Kirche autonom nennen, denn das war Sünde. Zwischen damals und heute liegen 30 Jahre Debatten, documenta-Begleitausstellungen, Kirchentagsausstellungen, Interventionen in einzelnen Kirchen, die Gründung der Gesellschaft für Gegenwartskunst und Kirche. Es gibt also inzwischen immer mal wieder den Kontakt und die Intervention, die die Kunst das Ihre sagen läßt, es gibt durchaus einen Diskurs, allerdings einen eingeschränkten und nicht besonders geförderten. Aber man kann auch noch heute das gleiche erleben wie damals, eine strikte Ablehnung der Kunst, die eigenständig ist und als der kirchlichen Kultur fremd erlebt wird, Widerstand gegen einzelne Projekte, Ignoranz gegenüber manchem, was die Kunst in die Kirchen gebracht hat. Dass dies auf der Ebene von Kirchengemeinden geschieht, kann man aufgrund der Milieudifferenz zwischen Kirche und Kunst und der durchaus zutreffenden Verortung zeitgenössischer Kunst als elitärem Phänomen des Bürgertums noch eher nachvollziehen als eine andere Entwicklung: nämlich dass die Kirchenleitungen deutschlandweit eine Kehrtwendung im Verhältnis zur Gegenwartskultur gemacht haben. Hatte man 2002 mit der Kulturdenkschrift der EKD „Räume der Begegnung“ Kultur in die Kirche bringen wollen, so wird das heute im Sinne des Impulspapiers der EKD aus dem Jahre 1999 umgedreht: Evangelische Kirche wird als Kulturträger präsentiert. Dass das so vertretene Programm theologisch höchst problematisch ist, soll an anderer Stelle ausführlicher diskutiert werden. Es geht jedenfalls um kirchliche Identität (man kann auch sagen: Ideologie), die letztlich ohne theologische Differenzierung mit der historischen kulturellen Ausprägung der Kirche in Mitteleuropa identifiziert wird. Nur was sich in diese Formation einfügen lässt, kann als kirchliche Kultur gelten. Daraus ergibt sich ein Kontrollbedürfnis von Kirchenleitungen im Hinblick auf die Kunst: Nur Künstler, die das kirchliche Parteibuch haben (Ev. Kirche v. Berlin-Brandenburg-Oberlausitz) bzw. die kirchliche Programmatik vertreten, sollen für die Kirche arbeiten dürfen. Wenn das durchgesetzt würde, wäre es für die Qualität der künstlerischen Arbeit in der Kirche verheerend. Vor zehn Jahren noch waren Kirchenleitungen mutiger und setzten eher auf den Gewinn, den unabhängige Kunst an Zeitgenossenschaft und prophetischer Diagnostik verspricht. Heute aber hat sie der Mut verlassen, sie agieren ängstlich-defensiv und versuchen, kirchliche Erosion durch Festhalten am Konventionellen zu verlangsamen. Die Freiheit, sich auf zeitgenössische Kunst einzulassen, wird von ihnen weithin nicht mehr realisiert. Was mit der Kunst gewonnen werden könnte an aufgeklärter Zeitgenossenschaft, bleibt unentdeckt. Deutlich ist: Die Kirche fühlt sich angegriffen und nimmt Verteidigungshaltungen ein. Und der Missionsgedanke, der kirchliches Denken und Handeln immer stärker bestimmt, ist genauso verteidigungsorientiert, wie ja der Volksmund sagt: Angriff ist die beste Verteidigung. Der Umgang mit der zeitgenössischen Kunst aber erfordert das Gegenteil: nämlich Gelassenheit, Selbstvertrauen, Neugier, relative Angstfreiheit: sämtlich Einstellungen, die dem geglaubten Wirken des Heiligen Geistes ausgezeichnet entsprechen würden. Ich will das durch einen weiteren Gedankengang noch etwas vertiefen. Überall, wo die Kirche zeitgenössische Kunst als fremd empfindet oder sie domestizieren will, ist auch ein unbewusstes Verstehen wirksam. Denn Kunst stellt eine kirchenunabhängige, und schon deswegen oft vordergründig als konkurrent empfundene, grundsätzlich eigenständige, ursprüngliche, präzise, autonome und alternative Wahrnehmung der Wirklichkeit in der Durchformung von Material vor Augen. Ob die Kirchen sich damit auseinandersetzen wollen, scheint seit längerem deswegen fraglich, weil sie etwas anderes vor Augen führen möchten, nämlich eine stabile, traditions- und wertorientierte Institution. Doch ist das nicht so einfach, weist doch der Grundimpuls des christlichen Glaubens in eine andere Richtung. Denn er realisiert sich als Religion der alltäglichen Lebenspraxis, in der äußere institutionelle Formen und innere institutionelle Bemächtigung allenfalls Hilfsmittel und grundsätzlich zweitrangig sind. Die biblischen Schriften und auch die historischen Rückbesinnungen darauf etwa in der Reformation zeigen, dass diese Religion der Lebenspraxis etwas zutiefst Innerliches ist. Glauben äußert sich nicht in äußeren, materiellen Formationen, sondern in der Lebensführung nach inneren Maßstäben. Gewiss ergeben sich kulturelle Manifestationen, doch unterliegen diese immer dem Kriterium der Lebenspraxis. Wenigstens haben die Reformatoren das so gesehen. Aus diesem Grund waren ihnen in Übereinstimmung mit der Bibel die Gebäude bei weitem nicht so wichtig wie die Praxis. Die reformatorische wie die biblische Tradition lassen keinen Zweifel daran, dass das Äußere relativ gleichgültig ist. (Eine andere Stellung dazu hat die römisch-katholische Kirche.) Das aber wird heute als Schwäche angesehen. So entsteht ein Problem mit der Kunst, als die Kirchen sich auf die bürgerliche Öffentlichkeit beziehen und sich also auf die äußere Erscheinung ausrichten. Äußeres, der Anschein, die äußeren Zeichen werden als identitätsverbürgend angesehen und sollen für Erkennbarkeit sorgen. Dieses Problem verschärft sich im 19. Jahrhundert im Zuge der sich entfaltenden Warenwirtschaft, weil nun alles, auch Ideen, zur Ware wird und auf dem Markt angepriesen werden muss. Hier liegt auch der Ursprung des Designs. Ich meine, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Eigentlich geht es um Design und Stil. Was ist der Stil, an dem man Kirche erkennt? Die kirchliche Stilfrage war wahrscheinlich bereits im Barock als dem Design der Gegenreformation virulent, ist aber eben modern erstmals im 19. Jahrhundert gestellt worden. Eine Antwort waren die überaus zahlreichen neugotischen und neoromanischen Kirchen beider Konfessionen, die zu dieser Zeit gebaut worden sind. Stilistisch haben die Kirchen sich damit auf eine ferne Vergangenheit bezogen. Nur zögerlich und vereinzelt akzeptierten und realisierten sie zeitgenössische Entwicklungen, zum Beispiel den Jugendstil. Zur kulturellen Gegenwart auf Abstand gehen und sich eher auf Vergangenes beziehen ist seither zum kirchlichen Habitus in Sachen Ästhetik geworden. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen: beispielsweise im Kirchenbau die Arbeiten von Otto Bartning. In der Tendenz aber lässt sich die kirchliche Ästhetik seit dem 19. Jahrhundert in Architektur und kirchlich-christlicher Kunst als eine Art von Design verstehen, als Illustration von religiösen Gedanken und symbolischen Konventionen, die Erfahrung weniger befördern und freisetzen als vielmehr auf Bekanntes, Gewusstes und kirchlich Approbiertes zurückführen. Wenn das stimmt, dann würde damit auch erklärt werden können, warum gegenwärtig das Design für die Kirche so wichtig ist, warum die Kirchen meist zu Design anstatt zur Kunst greifen: Kirchliches Design antwortet auf die heutige Stilfrage im entfesselten Markt und verspricht für alle Marktteilnehmer erkennbar zu machen, was der Inhalt der Idee ist. Zeitgenössische Kunst aber tut, verkürzt gesagt, etwas ganz anderes: sie sucht nach der Wahrheit, indem sie eine genaue Wahrnehmung der Wirklichkeit ausdrückt. Dabei befragt sie natürlich alle Sicherheit, die vom Design nur unterstrichen wird. Sie experimentiert mit Wahrnehmungen, sie fordert das Individuum. Sie erstellt keine Zeichen und Symbole, und wenn, dann um mit ihnen zu spielen und sie zu verrücken. Kunst funktioniert nicht, sie folgt nicht der Funktion. Auch da hat es die Kirche mit dem Design viel einfacher. Beim Design stimmt scheinbar alles, Design kann man abstimmen, Design unterstreicht Vorgaben und Inhalte. Alles das tut wahre Kunst nicht, sie stimmt nicht, über sie kann man nicht abstimmen, sie illustriert keine Vorgaben und ästhetisiert keine Inhalte, sie ist oft „daneben“, wie eben Menschen auch nicht selten „daneben“ sind. Design macht sicher, gibt zeichen- und symbolhaft klare Orientierung, Kunst ist eine Diagnose. Design bestätigt und verschönt die Welt, Kunst erschafft eine Welt. Design steuert und fokussiert Reaktionen, macht vermeintlich Ideen und Inhalte erkennbar, in Wirklichkeit aber nur identisch wiedererkennbar. Kunst hingegen setzt Erfahrungen frei, die man nicht vorwegnehmen kann und die neue Erkenntnis bilden. Kunst hat es immer mit kreativer, überschreitender, radikaler Wahrheitssuche zu tun. Da es den Kirchen aber um deutliche Identifizierbarkeit des Vorhergewussten geht, setzen sie auf Zeichen, Symbole, Erkennbarkeit, Deutlichkeit, und da sind sie am besten beim Design aufgehoben, das für die Dimension des Menschlichen auch noch das „emotionale Design“ anbieten kann. Dementsprechend sehen die Kirchen heute nicht nur die bildende Kunst, sondern die Kultur generell wieder als ancilla ecclesiae an: ein grundkatholischer Gedanke, den die evangelischen Kirchen mit ihrer totalen Instrumentalisierung der Kultur als reines Mittel zum Zweck, als Medium der Glaubensvermittlung, übernehmen. Der neuzeitliche Differenzierungs- und Emanzipationsprozess lässt sich jedoch nicht wegzaubern und leugnen. Er ist so bestimmend, dass den Kirchen längst kein Anspruch auf absolute Wahrheit und Verbindlichkeit mehr zuerkannt wird. So ist das Ergebnis kirchlicher Kultur nur noch der Ausdruck eines Milieus. Es ist alles wiederzuerkennen, aber in einem viel beschränkteren Sinne, als die Kirchen es wollen. Es ist also einerseits ein Missverständnis: Die Kirchen verstehen nicht, dass es der Kunst um etwas ganz anderes geht. Aber es ist vielleicht auch wieder ein Verstehen: Weil man der Frage nach der Wahrheit und dem Reichtum individueller Erfahrungen ausweicht. Denn entweder ist man im Besitz der Wahrheit oder ihr einziger Hüter, oder man muss sich selbst in Frage stellen lassen. Kunst wäre auch die Frage an die Kirche, ob sie weiter auf der Suche ist nach dem, was die Wahrheit in der Zeit ist, ob sie individuelle Erfahrungen ermöglichen will oder sie möglichst begrenzen will. Ja, auch ob die Kirche in der Institution aufgeht oder etwas zu glaubendes ist. Kein Kunstwerk der Welt will Menschen zum Glauben bringen, (und kein Design kann es, auch wenn es das will), das kann ausschließlich der Heilige Geist, und der bedient sich bekanntlich auch jener Mittel, die nicht institutionskonform erscheinen. Zurück zur Angst: Die Angst entspringt der Verunsicherung und einem Sicherheitsbedürfnis in einer tatsächlich fast rettungslos unübersichtlichen Zeit. Mit der Kirche verbundene Menschen sehen in ihrer Kirche und Gemeinde einen sicheren Ort, den sie brauchen, Heimat, geistiges Eigentum. In diesem Ort darf nichts grundlegend verändert werden, er darf nicht angetastet werden. In ihm muss alles wiedererkennbar sein. Zeichen und Symbole machen sicher, weil man sie lesen kann, weil man sie erkennt. Es geht um etwas, was einem heilig ist und um das Tabu, dies anzurühren. Design verspricht Sicherheit und Erkennbarkeit, ja auch Zeitgemäßheit und Modernität. Aber es ist ein falsches Versprechen. Scheinbar paradox geht nämlich gerade die zeitgenössische Kunst von der Kraft der Religion aus, mutet ihr die Suche nach der Wahrheit zu, lehrt sie wahrzunehmen, während das Design die Bedürftigkeit der Religion in Sachen Marktpräsenz unterstellt, sie hübsch macht und anzupreisen versucht. Die Angst der Kirche vor der Kunst/Kultur/Gegenwart ist mit den Händen zu greifen. Kann man mit ihr umgehen lernen und sie als Chance zur Entwicklung verstehen? Helfen könnte dabei gute Kunst, jene Kunst also, deren Qualität im zeitgenössischen Kunstdiskurs anerkannt wird. Sie zeigt den Kirchen wirkliche Wahrnehmung der Zeit. Doch wo ist die dafür nötige Gelassenheit zu finden? Eine merkwürdige Frage an eine Institution, die eigentlich wissen könnte, dass sie sich nicht selbst erhalten kann. Eine aktuelle Perspektive wird sich auf längere Sicht nur quer zur Institution erschließen lassen. |
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/56/jm8.htm
|
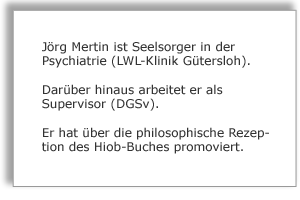 Vor nunmehr acht Jahren habe ich im
Vor nunmehr acht Jahren habe ich im